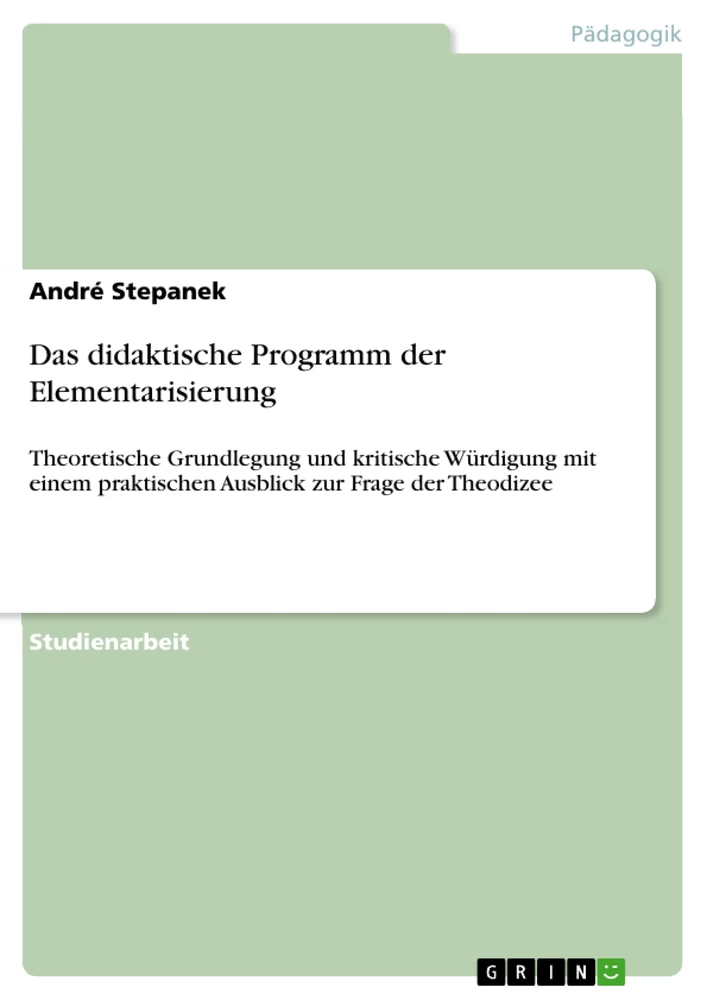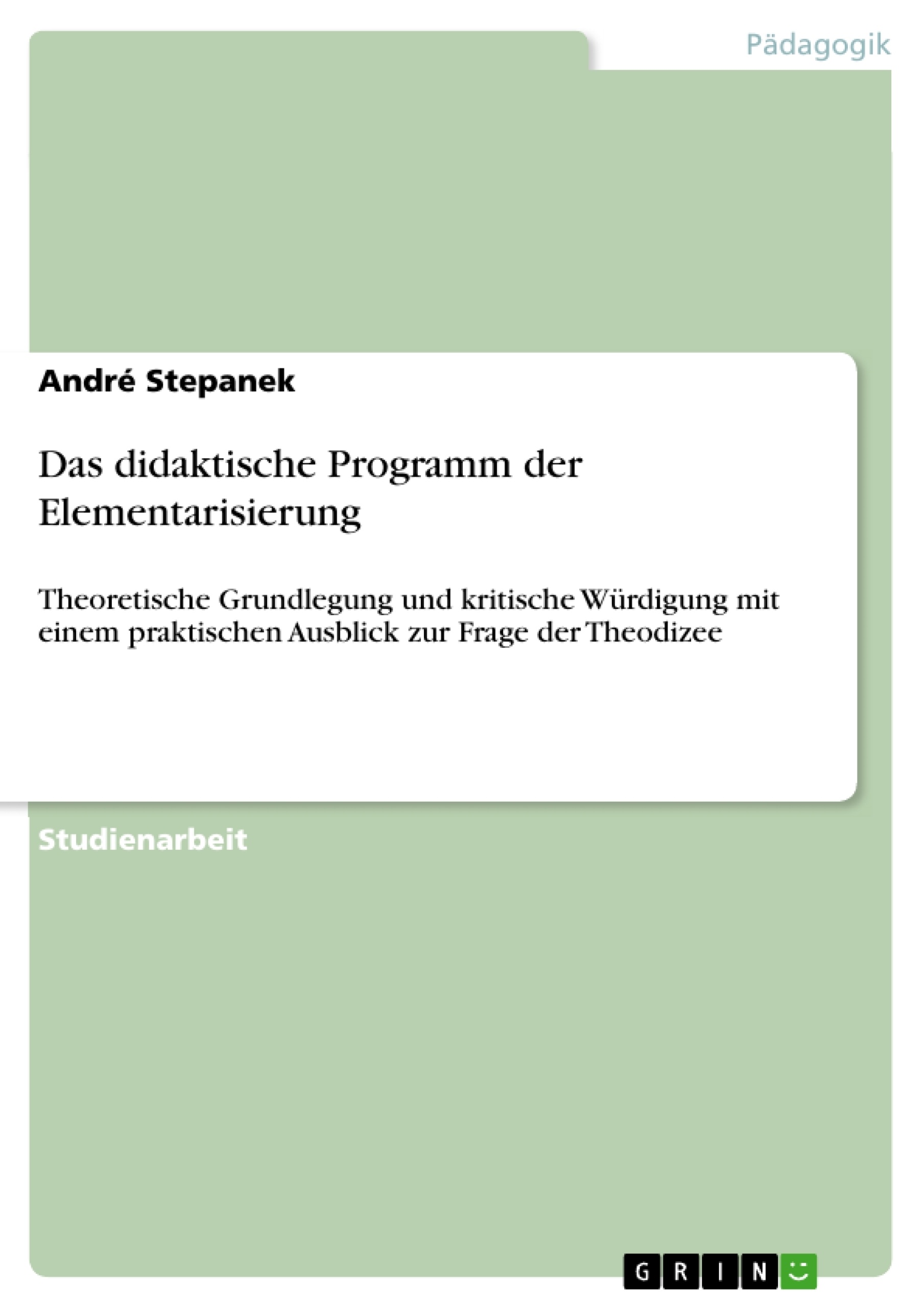Im Laufe dieser Arbeit soll das didaktische Konzept der Elementarisierung zuerst in einem theoretischen Rahmen näher betrachtet werden, um daran anschließend, in einem praktischen Ausblick, die fünf Dimensionen der Elementarisierung nach Friedrich Schweitzer und Karl Ernst Nipkow anhand des Themas der Theodizee zu betrachten.
Einleitend soll nun betrachtet werden, was der Begriff der Elementarisierung meint, wo die Wurzeln dieses Ansatzes liegen und wie er sich weiterentwickelt hat.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Begriffsklärung und Entwicklung der Elementarisierung
3. Elementarisierungsansatz bei Friedrich Schweitzer und Karl Ernst Nipkow
3.1. Die fünf Dimensionen der Elementarisierung
4. Elementarisierungsansatz bei Godwin Lämmermann und Kritik am Ansatz Schweitzers und Nipkows
4.1. Elementarisierungsschritte bei Lämmermann
5. Praktischer Ausblick
6. Schluss
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Elementarisierung in der Religionspädagogik?
Elementarisierung ist ein didaktisches Konzept, das komplexe theologische Inhalte für Lernende zugänglich macht, indem es sie auf ihre wesentlichen, elementaren Strukturen reduziert.
Welche fünf Dimensionen nennen Schweitzer und Nipkow?
Die Dimensionen umfassen elementare Strukturen, Erfahrungen, Zugänge, Wahrheiten und Lernformen.
Wie wird das Thema Theodizee elementarisiert?
Das Problem des Leidens in der Welt wird anhand der fünf Dimensionen so aufbereitet, dass Schüler einen persönlichen und reflektierten Zugang zur Frage nach Gott finden.
Was ist der Unterschied zum Ansatz von Godwin Lämmermann?
Lämmermann setzt eigene Akzente und kritisiert teilweise die Gewichtung bei Schweitzer und Nipkow, indem er spezifische Elementarisierungsschritte definiert.
Wo liegen die historischen Wurzeln der Elementarisierung?
Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung des Begriffs von seinen Ursprüngen in der klassischen Pädagogik bis hin zur modernen Religionsdidaktik.
- Quote paper
- André Stepanek (Author), 2011, Das didaktische Programm der Elementarisierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/264106