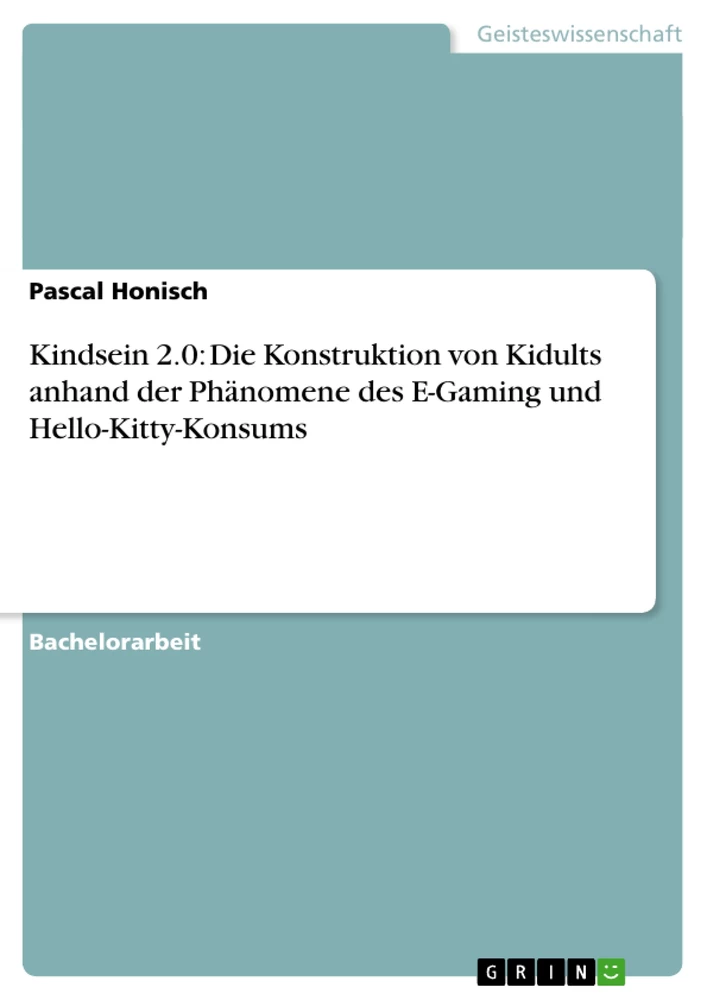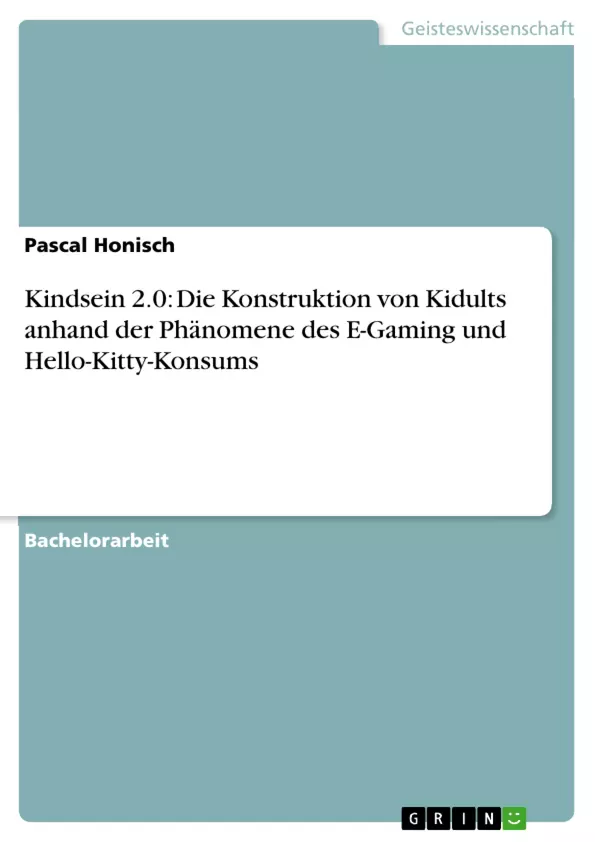Bedenkt man, dass das 21. Jahrhundert erst knapp ein Jahrzehnt alt ist, mag es wohl nach Ansicht Vieler noch in den Kinderschuhen stecken. Dennoch rechtfertigen Errungenschaften, wie die Erfindung von Social Networks oder die Etablierung eines weltweiten Internetzugangs, bereits jetzt seinen Status als bedeutende Epoche in der Geschichte der Menschheit.
Vor allem in Bezug auf westliche Gesellschaften, in denen diese Entwicklungen wohl am stärksten zu spüren sind, folgt es damit in gewisser Weise auch einem der neuesten Trends des noch jungen Jahrtausends. Nämlich dem vom Kind, „das zu schnell erwachsen wird“.
Begleitet von der Grundidee, dass Dinge wie modisches Bewusstsein, Emanzipation und Sex durch das fortgeschrittene Alter prädeterminiert sind, müssen Eltern dabei zunehmend die schockierende Erfahrung machen, dass der eigene Nachwuchs eher nach dem deklarierten Feindbild der „anzüglichen US-Teenie-Stars“, denn Vater und Mutter gerät.
Als Antithese dazu geben sich immer mehr quasi Erwachsene jugendaffin, zieren sich mit Plüschaccessoires à la Hello Kitty oder verbringen Stunden spielend vor dem Computer. Zeichen der Zeit, wie Viele meinen und obwohl diese konträren Entwicklungen gewissermaßen erneut ein Gleichgewicht zwischen den Generationen zu schaffen scheinen, werden sie doch im Grundton zumeist negativ bewertet.
...
Diese stetig wachsende Masse an Menschen, die sich schwerlich einer einzigen Generation zuordnen lässt, wird gerne mit Mixbegriffen wie Kidults, Pre-Teens, Tweensters oder Boomerangkids (vgl. Urban 2011) umschrieben. Wobei bereits der Umstand, dass die genannten Begriffe nur allzu oft fälschlich für dasselbe gehalten werden, Anzeichen für die Ankunft in einem definitorischen Nirwana ist.
...
Obgleich Kidults ein weltweites Phänomen darstellen, scheint der Begriff vor allem in der westlichen Wohlstandsgesellschaft des 21. Jahrhunderts Fuß gefasst zu haben. Aus diesem Grund stellt sie auch den Referenzraum für die nachfolgenden Überlegungen dar.
Des Weiteren möchte der Autor anhand der Phänomene des E-Gaming und Hello Kitty Konsums, die explizit mit Kidultsein assoziiert werden (s.a. Furedi 2003), die Konstruktion von Kidults veranschaulichen und gleichsam deren Rolle in den unterschiedlichen Gesellschaften erläutern. Hello Kitty und Computerspiele dienen dabei nur als Fallbeispiele, bieten ob ihrer internationalen Omnipräsenz allerdings würdige Erklärungsmodelle für diesen opaken Themenkomplex.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Im Auftrag dieser Arbeit
- 3. Ein Definitionsversuch
- 3.1. Die Mechanismen einer synthetischen Jugendkultur
- 4. Adoleszenz und die Suche nach Identität
- 5. E-Gaming als Sinnfrage
- 6. Computerspielen im Zeichen der „Kindgebliebenen“
- 6.1. Vom ludischen Charakter der westlichen Gesellschaft
- 7. Farblos zum Massenphänomen
- 7.1. Kitty und Kidultsein
- 8. "Hello Kitty has no mouth but hey, cocaine goes up your nose"
- 9. Entstehung und Erzeugnis der Kulturindustrie
- 10. Conclusio
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der Kidults anhand der Konsumgüter Hello Kitty und E-Gaming. Ziel ist es, die soziale Konstruktion von Kidults zu veranschaulichen und deren Rolle in der westlichen Gesellschaft zu erläutern. Die Arbeit stützt sich auf sozialanthropologische Theorien zur Adoleszenz und Identität.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs "Kidult"
- Analyse des Konsumverhaltens von Kidults im Kontext von Hello Kitty
- Untersuchung von E-Gaming als Freizeitaktivität von Kidults
- Die Rolle von Adoleszenz und Identitätssuche im Kidult-Phänomen
- Der Einfluss der Kulturindustrie auf die Konstruktion von Kidults
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Kidults ein und stellt den Kontext des 21. Jahrhunderts mit seinen Entwicklungen wie Social Networks und dem Internet heraus. Sie kontrastiert das vermeintlich zu schnell erwachsende Kind mit dem Phänomen der erwachsenen Menschen, die jugendlichere Verhaltensweisen und Konsummuster pflegen. Die Arbeit fokussiert sich auf Kidults und deren soziale Rezeption, wobei E-Gaming und Hello Kitty als Fallbeispiele dienen, um die Konstruktion von Kidults zu veranschaulichen. Der Fokus liegt auf der westlichen Wohlstandsgesellschaft.
2. Im Auftrag dieser Arbeit: Dieses Kapitel beschreibt den methodischen Ansatz der Arbeit. Es skizziert die verwendeten Quellen, insbesondere den Artikel von Frank Furedi ("The children who won't grow up") und weitere Literatur zu den Themen Adoleszenz und Identität. Das Kapitel bereitet den Leser auf die nachfolgenden Analysen vor und erläutert die Rolle der verwendeten Literatur.
3. Ein Definitionsversuch: Dieses Kapitel unternimmt einen Versuch, den Begriff "Kidult" zu definieren und von ähnlichen Begriffen wie Pre-Teens oder Boomerangkids abzugrenzen. Es analysiert die Mechanismen einer synthetischen Jugendkultur und ihre Bedeutung im Kontext des Kidult-Phänomens. Das Unterkapitel 3.1 vertieft die Analyse der Mechanismen dieser Kultur und erklärt die Faktoren, die zu ihrer Entstehung beitragen.
4. Adoleszenz und die Suche nach Identität: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung von Adoleszenz und Identitätssuche im Kontext des Kidult-Phänomens. Es wird analysiert, wie die Kidults ihren Platz in der Gesellschaft finden und wie sich ihre Identität im Kontext ihres Konsumverhaltens ausprägt.
5. E-Gaming als Sinnfrage: Dieses Kapitel behandelt E-Gaming als Freizeitbeschäftigung von Kidults und beleuchtet dessen Bedeutung für ihre Identität und soziale Einbindung. Es analysiert den Aspekt des Spielens im Kontext der Sinnfindung und Identitätsbildung dieser Gruppe.
6. Computerspielen im Zeichen der „Kindgebliebenen“: Dieses Kapitel untersucht das Phänomen des Computerspielens im Kontext des Kidultseins. Es analysiert den ludischen Charakter der westlichen Gesellschaft und dessen Einfluss auf das Verhalten und das Selbstverständnis der Kidults. Unterkapitel 6.1 fokussiert sich auf den ludischen Charakter der westlichen Gesellschaft und dessen Rolle im Zusammenhang mit dem Kidult-Phänomen.
7. Farblos zum Massenphänomen: Dieses Kapitel analysiert Hello Kitty als Massenphänomen und dessen Assoziation mit dem Kidultsein. Es untersucht den kulturellen und sozialen Kontext dieses Konsumgutes und dessen Bedeutung im Leben von Kidults. Unterkapitel 7.1 konzentriert sich auf die Verbindung zwischen Hello Kitty und der Kidult-Identität.
8. "Hello Kitty has no mouth but hey, cocaine goes up your nose": Dieses Kapitel analysiert einen kritischen Aspekt der Hello Kitty-Kultur. Es beleuchtet mögliche ironische oder subversiv-kritische Aneignungen des Motivs im Kontext von Kidultsein und hinterfragt den unschuldigen Schein.
9. Entstehung und Erzeugnis der Kulturindustrie: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss der Kulturindustrie auf die Konstruktion und Perpetuierung des Kidult-Phänomens. Es analysiert die Mechanismen der Produktion und Vermarktung von Produkten, die mit dem Kidult-Lifestyle assoziiert werden.
Schlüsselwörter
Kidults, E-Gaming, Hello Kitty, Adoleszenz, Identität, Jugendkultur, Konsumverhalten, Kulturindustrie, westliche Gesellschaft, Synthetische Jugendkultur, Ludischer Charakter.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Kidults, E-Gaming und Hello Kitty
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Phänomen der Kidults, also erwachsener Menschen mit jugendlich geprägten Verhaltensweisen und Konsummustern. Im Fokus stehen dabei die Konsumgüter Hello Kitty und E-Gaming als Fallbeispiele, um die soziale Konstruktion von Kidults und deren Rolle in der westlichen Gesellschaft zu analysieren.
Welche Methodik wird verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf sozialanthropologische Theorien zur Adoleszenz und Identität und verwendet einen methodischen Ansatz, der im zweiten Kapitel detailliert beschrieben wird. Es werden verschiedene Quellen herangezogen, insbesondere der Artikel von Frank Furedi ("The children who won't grow up") und weitere Literatur zu Adoleszenz und Identität.
Wie wird der Begriff "Kidult" definiert?
Das dritte Kapitel unternimmt einen Versuch, den Begriff "Kidult" zu definieren und von ähnlichen Begriffen wie Pre-Teens oder Boomerangkids abzugrenzen. Die Analyse umfasst die Mechanismen einer synthetischen Jugendkultur und deren Bedeutung im Kontext des Kidult-Phänomens.
Welche Rolle spielen Adoleszenz und Identitätssuche?
Das vierte Kapitel untersucht die Bedeutung von Adoleszenz und Identitätssuche im Kontext des Kidult-Phänomens. Es analysiert, wie Kidults ihren Platz in der Gesellschaft finden und wie sich ihre Identität im Kontext ihres Konsumverhaltens ausprägt.
Welche Bedeutung hat E-Gaming für Kidults?
Das fünfte Kapitel beleuchtet E-Gaming als Freizeitbeschäftigung von Kidults und dessen Bedeutung für ihre Identität und soziale Einbindung. Der Aspekt des Spielens im Kontext der Sinnfindung und Identitätsbildung wird analysiert.
Wie wird Hello Kitty im Kontext von Kidults betrachtet?
Die Kapitel sieben und acht analysieren Hello Kitty als Massenphänomen und dessen Assoziation mit dem Kidultsein. Es wird der kulturelle und soziale Kontext des Konsumgutes und dessen Bedeutung im Leben von Kidults untersucht. Kapitel acht beleuchtet zudem kritische und ironische Aneignungen des Hello Kitty-Motivs.
Welche Rolle spielt die Kulturindustrie?
Das neunte Kapitel untersucht den Einfluss der Kulturindustrie auf die Konstruktion und Perpetuierung des Kidult-Phänomens. Es analysiert die Mechanismen der Produktion und Vermarktung von Produkten, die mit dem Kidult-Lifestyle assoziiert werden.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kidults, E-Gaming, Hello Kitty, Adoleszenz, Identität, Jugendkultur, Konsumverhalten, Kulturindustrie, westliche Gesellschaft, Synthetische Jugendkultur, Ludischer Charakter.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit ist in zehn Kapitel gegliedert, die von der Einleitung über die Definition von Kidults bis hin zur Rolle der Kulturindustrie reichen. Jedem Kapitel ist eine Zusammenfassung im HTML-Dokument zugeordnet, die den Inhalt detailliert beschreibt.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Studenten und alle, die sich für die Themen Jugendkultur, Konsumverhalten, Identität und die Rolle der Kulturindustrie in der westlichen Gesellschaft interessieren.
- Arbeit zitieren
- Pascal Honisch (Autor:in), 2011, Kindsein 2.0: Die Konstruktion von Kidults anhand der Phänomene des E-Gaming und Hello-Kitty-Konsums, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/263507