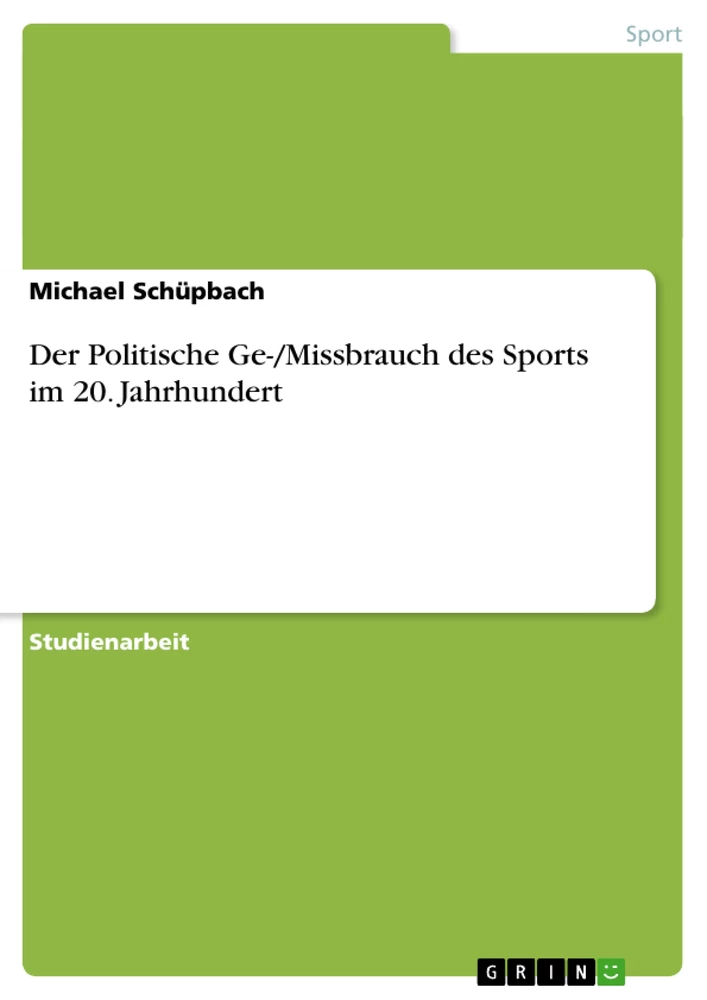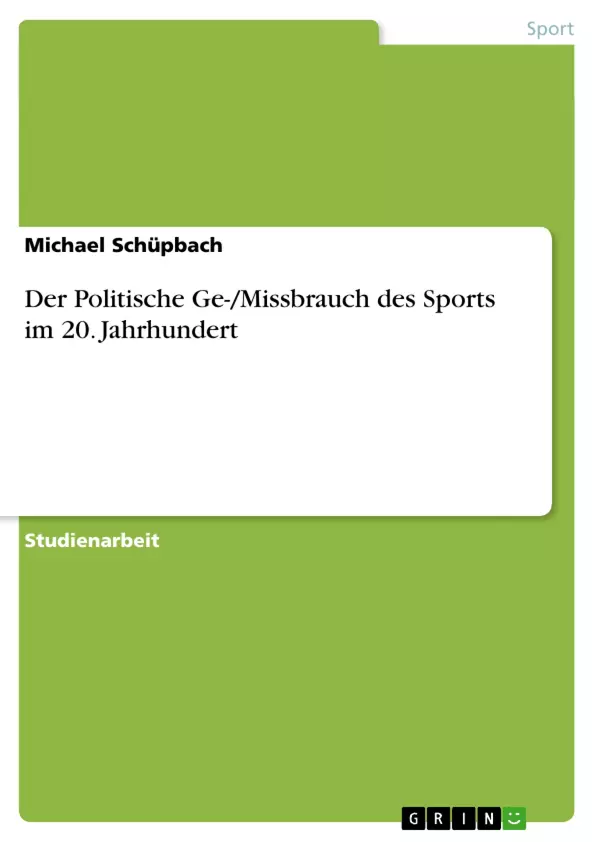"Man gebe der Deutschen Nation sechs Millionen sportlich tadellos trainierte Körper, alle von fanatischer Vaterlandsliebe durchglüht und zu höchstem Angriffsgeist erzogen, und ein nationaler Staat wird aus ihnen, wenn notwendig, in nicht einmal zwei Jahren eine Armee geschaffen haben" (Hitler, 1934, S. 184-185). Pabst (1980) ist der Meinung, dass der politische Charakter der nationalsozialistischen Auffassung von Sport durch nichts besser bewiesen werden kann, als durch dieses Zitat aus Adolf Hitlers 'Mein Kampf'. Ausserdem nimmt er an, dass sich der Sport, auch wenn von der breiten Masse als Gegenpol zur Leistung und nicht in geringstem Masse als politisch betrachtet - obwohl "als integraler Teil der Gesellschaft per se politische Wirkkraft" (S. 20) besitzend - nicht von der Politik trennen lässt. Denn der Sport ist eng mit der jeweiligen konkreten historischen Situation verknüpft und stellt somit keinen gesellschaftlichen Freiraum dar. Ausserdem bedienen sich viele politische Systeme, über die systembedingte Einengung des Aktionsradius hinaus, des Sports als Instrument der Politik. Dies ist in allen sozialistischen Staaten, den meisten Ländern der Dritten Welt, aber auch in einigen totalitären Regimen sowie in westlichen Demokratien der Fall (Pabst, 1980).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Fragestellung
- Forschungsstand
- Zustände zur Zeit der SBZ (1945-1949)
- Zustände zur Zeit der DDR (ab 7. Oktober 1949)
- Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Einwirkungen der Politik in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und der DDR auf den Sport. Sie analysiert, wie diese Einwirkungen den Sport prägten und in welchem Maße er von politischen Zielen beeinflusst wurde.
- Politische Instrumentalisierung des Sports in der SBZ und DDR
- Die Rolle des Sports als Mittel der Macht und Legitimation
- Die Nutzung des Sports für die politische Propaganda und zur Stärkung des Nationalgefühls
- Die Auswirkungen der politischen Einflussnahme auf die Entwicklung des Sports und die Sportkultur
- Die Grenzen des politischen Einflusses und die Möglichkeiten des individuellen Erlebens von Sport
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung und Fragestellung
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor: Wie wirkten sich die Politik der SBZ und der DDR auf den Sport aus? Das Zitat von Adolf Hitler aus „Mein Kampf“ verdeutlicht die enge Verknüpfung von Sport und Politik. Pabst (1980) argumentiert, dass der Sport per se politische Wirkkraft besitzt und eng mit der jeweiligen historischen Situation verbunden ist.
Forschungsstand
Zustände zur Zeit der SBZ (1945-1949)
In der SBZ wurden die Sportbeziehungen zur UdSSR und anderen sozialistischen Ländern besonders gefördert. Der Sport wurde nach sowjetischem Vorbild organisiert und war eng mit der gesellschaftlichen Politik verknüpft. Die Sowjetische Militäradministration (SMAD) enteignete Sportvereine und unterordnete den Sport der SED.
Zustände zur Zeit der DDR (ab 7. Oktober 1949)
Die DDR nutzte den Sport für außenpolitische Zwecke und um die eigene politische Systemüberlegenheit zu demonstrieren. Der Deutsche Turn und Sportbund (DTSB) wurde gegründet, um den Sport unter staatliche Kontrolle zu bringen. Neben dem Leistungssport spielte der Massensport eine wichtige Rolle, der durch das Sportabzeichen gefördert wurde. Doping wurde als Mittel zur Steigerung der sportlichen Leistung eingesetzt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Sportpolitik, DDR, SBZ, staatliche Einflussnahme, politische Instrumentalisierung, Massensport, Leistungssport, Doping, Körperkultur, nationale Identität, Identifikationsfiguren.
- Quote paper
- Michael Schüpbach (Author), 2009, Der Politische Ge-/Missbrauch des Sports im 20. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/263040