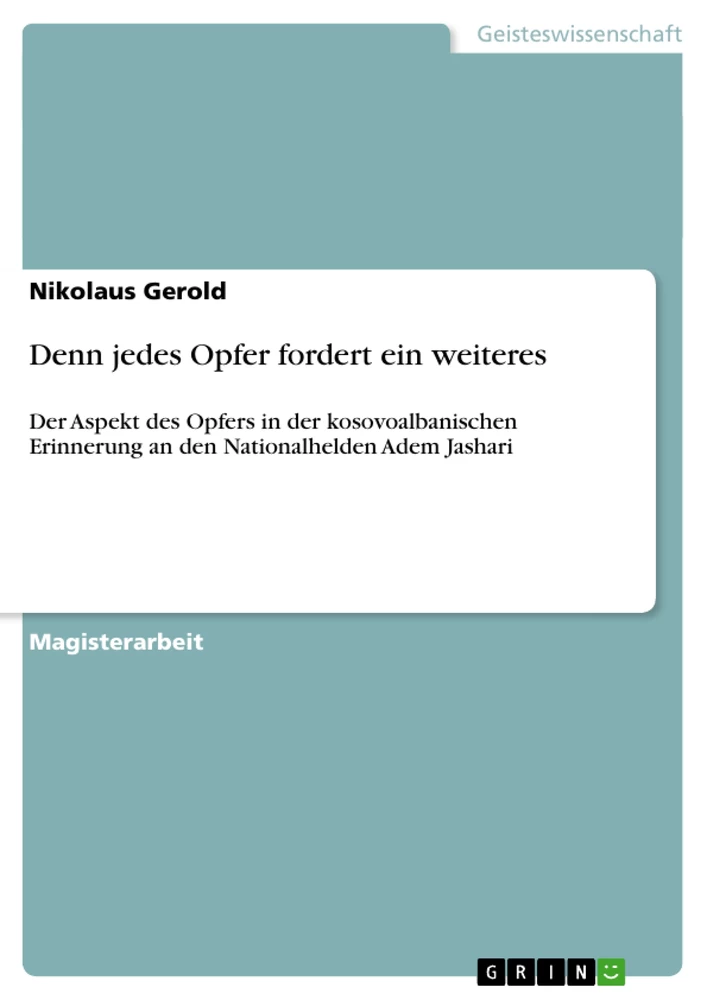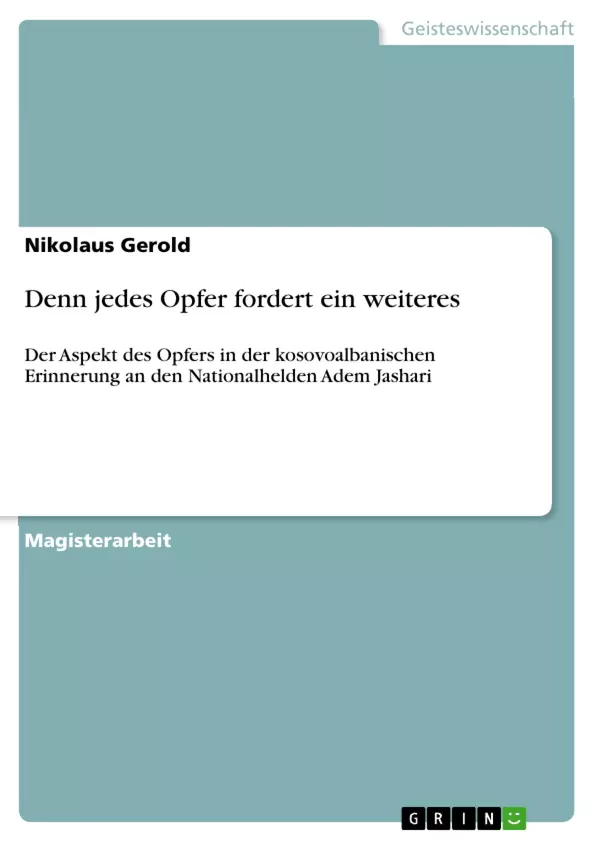Die kosovoalbanische Gesellschaft befindet sich als eine Nachkriegsgesellschaft in reichlich desolater sozioökonomischer sowie immer noch relativ ungefestigter politischer Lage, und schmerzliche Erfahrungen der sehr kurzen, dennoch äußerst grausamen Kriegszeit 1998/99, als auch der in den Jahren zuvor massiv zunehmenden Repressionen durch den serbischen Staat, artikulieren sich im Alltag auf unterschiedlichste Art und Weise. Eine davon ist eine ausgeprägte Gedenkkultur hinsichtlich der in den letzten Jahren der 90er im Kampf Getöteten, welche als „Märtyrer der Nation“ erinnert werden.
Im Mittelpunkt dieses Gedenkens, und gleichzeitig der gesamten kosovoalbanischen Märtyrergedenkkultur, steht einer der Gründer der UÇK, Adem Jashari, auch bekannt als „komandant legjendar“, dessen Tod - in Anlehnung an das Christusopfer - als ein „sublimes Selbstopfer“ für die Nation erinnert wird. Dieses „messianische Selbstopfer“, das die „Straße der Freiheit“ für die KosovoalbanerInnen eröffnet haben soll, stellt ein hybrides Konzept dar, welches sowohl von Ideen familiärer Solidarität und Ehre innerhalb eines patriarchalen Kulturmusters, als auch von Elementen christlicher Opfertheologie beeinflusst ist. Durch diese Verschmelzung traditioneller nordalbanischer Kulturelemente mit dem Opfermythos Christi generiert sich eine mächtige Opfer-Erzählung, die das gegenwärtige nationale Selbstverständnis in Teilen der kosovoalbanischen Gesellschaft nachhaltig prägt. Warum aber steht genau der Aspekt des Opfers im Zentrum der Erinnerung? Warum starben die FreiheitskämpferInnen nicht einfach, oder wurden ermordet, sondern „opferten sich“ auf dem „Altar des Vaterlands“? Und warum ist gleichzeitig kaum von zivilen „Opfern“ die Rede? Dahinter scheint so etwas wie eine spezifische Opferlogik zu stecken, die es so verlockend erscheinen lässt, den Tod in ein „Selbstopfer“ zu verwandeln. Das Ziel dieser Arbeit soll aber nicht sein, einen Entwurf einer „blutleeren“ Opferlogik anzufertigen. Ebenso wenig geht es um ein oberflächliches Aufzeigen von kulturellen Traditionen, die sich in jenem kosovoalbanischen Mythos vermengen. Vielmehr ist das Anliegen des Autors, mit einem ethnologischen Blick das Spezifische dieser kosovoalbanischen Opfererzählung zu entdecken. Denn erst durch eine Einbettung in den soziokulturellen Kontext, in dem er erzählt wird, gibt der Mythos sich preis, wird er verständlich.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Erinnerung - Mythos - Identität
- 2.1 Erinnerung
- 2.1.1 Begriffsklärung
- 2.1.2 Der Gedächtnisbegriff bei Jan Assmann
- 2.2 Mythos
- 2.2.1 Mythos, Wahrheit & Identität
- 2.2.2 Mythos & Flexibilität
- 2.2.3 Mythos & Hybridität
- 2.3 Zusammenfassung
- 3. Methodik & Feldforschung
- 3.1 Untersuchungsgegenstand & Methodik
- 3.2 Die Konstruktion des Forschers
- 4. Ein geschichtlicher Abriss oder Wie Adem Jashari zum „komandant legjendar“, und ein Massaker zum „flijim sublim“ wurde
- 4.1 Die 90er Jahre – Eine Spirale der Gewalt
- 4.2 Die Konstruktion einer Meistererzählung innerhalb des mythischen Geschichtsbilds der Albaner
- 5. Helden, Märtyrer, Opfer
- 5.1 Definition & Unterscheidung
- 5.2 Arbeitsdefinition „Opfer“
- 5.2.1 Die „Illusion des Opfers“
- 5.2.2 Mauss' „Rätsel der Gabe“: Geben - Nehmen - Erwidern
- 5.3 Exkurs: Kosovoalbanische rurale Lebenswelten
- 5.3.1 Die traditionelle kosovoalbanische Lebensweise zwischen den beiden Weltkriegen
- 5.3.2 Die heutige Situation im Raum Drenica
- 6. Deskription des „flijim sublim“
- 6.1 Das Opferschema
- 6.2 Opferlogik und Gesellschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Aspekt des Opfers in der Erinnerung an den kosovoalbanischen Nationalhelden Adem Jashari. Ziel ist es, die Konstruktion des „Opfers“ im Kontext des kosovoalbanischen Geschichtsbildes zu analysieren und die Rolle von Mythos und Erinnerung in diesem Prozess zu beleuchten. Dabei wird der Fokus auf die spezifischen kulturellen und gesellschaftlichen Faktoren gelegt, die die Wahrnehmung und Interpretation von Jasharis Tod prägen.
- Die Konstruktion von Erinnerung und Mythos um Adem Jashari
- Die Rolle des Opfers im kosovoalbanischen Nationalismus
- Die Analyse des „flijim sublim“ (erhabenes Opfer) als Konzept
- Der Einfluss traditioneller kosovoalbanischer Lebenswelten auf die Opferthematik
- Die Verbindung zwischen Opfer, Identität und Nation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Gedenkens an Kriegstote ein und beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven und Debatten, die sich um dieses Thema drehen, besonders im Kontext von „postheroischen Gesellschaften“. Sie stellt die Frage nach der kulturspezifischen Gestaltung des Totengedenkens und leitet zur zentralen Fragestellung der Arbeit über: die Analyse des Aspekts des Opfers in der Erinnerung an Adem Jashari im Kosovo.
2. Erinnerung - Mythos - Identität: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit. Es definiert die Begriffe Erinnerung und Mythos und diskutiert deren Bedeutung für die Konstruktion von Identität. Besonderes Augenmerk wird auf den Gedächtnisbegriff nach Jan Assmann gelegt und die Interaktion zwischen Mythos, Wahrheit und Identität beleuchtet. Das Kapitel dient als methodische Grundlage für die spätere Analyse der Erinnerung an Adem Jashari.
3. Methodik & Feldforschung: Hier wird die Methodik der Arbeit erläutert, einschließlich des Untersuchungsgegenstandes und der angewandten Forschungsmethoden. Der Abschnitt beleuchtet die Herausforderungen und Besonderheiten der Feldforschung im Kontext des Themas und reflektiert die Position des Forschers selbst.
4. Ein geschichtlicher Abriss oder Wie Adem Jashari zum „komandant legjendar“, und ein Massaker zum „flijim sublim“ wurde: Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über die Ereignisse der 1990er Jahre im Kosovo und analysiert die Konstruktion der „Meistererzählung“ um Adem Jashari im Kontext des mythischen Geschichtsbildes der Albaner. Es beschreibt den Prozess der Heroisierung und Mythisierung von Jashari und seinem Tod.
5. Helden, Märtyrer, Opfer: Das Kapitel definiert und differenziert die Begriffe Held, Märtyrer und Opfer. Es entwickelt eine Arbeitsdefinition von „Opfer“ und analysiert die „Illusion des Opfers“ sowie das Konzept der Gabe nach Mauss. Weiterhin beleuchtet es die traditionellen kosovoalbanischen Lebenswelten und deren Einfluss auf die Wahrnehmung von Opfer und Heldentum.
6. Deskription des „flijim sublim“: Dieses Kapitel analysiert das Konzept des „flijim sublim“ (erhabenes Opfer) im Detail. Es untersucht das Opferschema, die Rolle der Freiheit als Empfängerin, den Akt des Opferns selbst und die Bedeutung von Ehre und Familie in diesem Kontext. Der Bezug zu christlichen Opferkonzepten wird hergestellt und die Rolle von Adem Jashari als Erlöser und die Nation als Familie wird erörtert. Der Abschnitt beleuchtet zudem die Opferlogik und deren gesellschaftliche Implikationen.
Schlüsselwörter
Adem Jashari, Kosovo, Erinnerung, Mythos, Identität, Opfer, Heldenkult, Märtyrer, Nationalismus, „flijim sublim“, traditionelle Lebenswelten, Gewalt, Geschichtskonstruktion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Erinnerung, Mythos und Opfer - Adem Jashari im kosovoalbanischen Geschichtsbild
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit analysiert die Konstruktion des „Opfers“ im Kontext des kosovoalbanischen Geschichtsbildes am Beispiel von Adem Jashari. Sie untersucht die Rolle von Mythos und Erinnerung in diesem Prozess und beleuchtet die kulturellen und gesellschaftlichen Faktoren, die die Wahrnehmung und Interpretation von Jasharis Tod prägen.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die zentralen Themen sind die Konstruktion von Erinnerung und Mythos um Adem Jashari, die Rolle des Opfers im kosovoalbanischen Nationalismus, die Analyse des „flijim sublim“ (erhabenes Opfer), der Einfluss traditioneller kosovoalbanischer Lebenswelten auf die Opferthematik und die Verbindung zwischen Opfer, Identität und Nation.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und was ist ihr Inhalt?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Thematik ein; Kapitel 2 (Erinnerung - Mythos - Identität) legt die theoretischen Grundlagen; Kapitel 3 (Methodik & Feldforschung) beschreibt die angewandte Methodik; Kapitel 4 (Ein geschichtlicher Abriss...) bietet einen historischen Überblick und analysiert die Heroisierung Jasharis; Kapitel 5 (Helden, Märtyrer, Opfer) definiert und differenziert die Begriffe und analysiert traditionelle Lebenswelten; Kapitel 6 (Beschreibung des „flijim sublim“) analysiert das Konzept des erhabenen Opfers im Detail.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Hausarbeit erläutert die angewandte Methodik, einschließlich des Untersuchungsgegenstandes und der Forschungsmethoden. Es wird auch die Position des Forschers reflektiert und die Herausforderungen der Feldforschung im Kontext des Themas beleuchtet.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet theoretische Ansätze aus den Bereichen Erinnerungskultur, Mythosforschung und Identitätskonstruktion. Besonderes Augenmerk wird auf den Gedächtnisbegriff nach Jan Assmann und das Konzept der Gabe nach Mauss gelegt.
Was ist das „flijim sublim“ und welche Rolle spielt es in der Arbeit?
Das „flijim sublim“ (erhabenes Opfer) ist ein zentrales Konzept der Arbeit. Es wird detailliert analysiert, einschließlich des Opferschemas, der Opferlogik und deren gesellschaftlichen Implikationen. Der Bezug zu christlichen Opferkonzepten und die Rolle von Adem Jashari als Erlöser werden erörtert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Adem Jashari, Kosovo, Erinnerung, Mythos, Identität, Opfer, Heldenkult, Märtyrer, Nationalismus, „flijim sublim“, traditionelle Lebenswelten, Gewalt, Geschichtskonstruktion.
Welche Zielsetzung verfolgt die Hausarbeit?
Die Hausarbeit zielt darauf ab, die Konstruktion des „Opfers“ im Kontext des kosovoalbanischen Geschichtsbildes zu analysieren und die Rolle von Mythos und Erinnerung in diesem Prozess zu beleuchten. Der Fokus liegt auf den kulturellen und gesellschaftlichen Faktoren, die die Wahrnehmung und Interpretation von Jasharis Tod prägen.
- Arbeit zitieren
- Nikolaus Gerold (Autor:in), 2013, Denn jedes Opfer fordert ein weiteres, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/262688