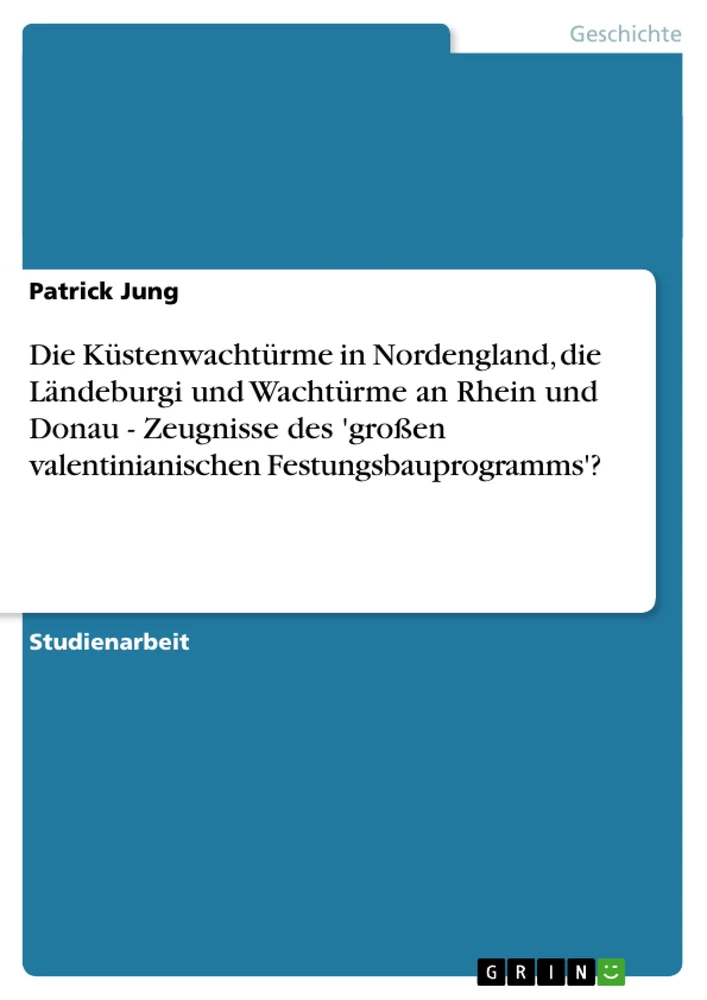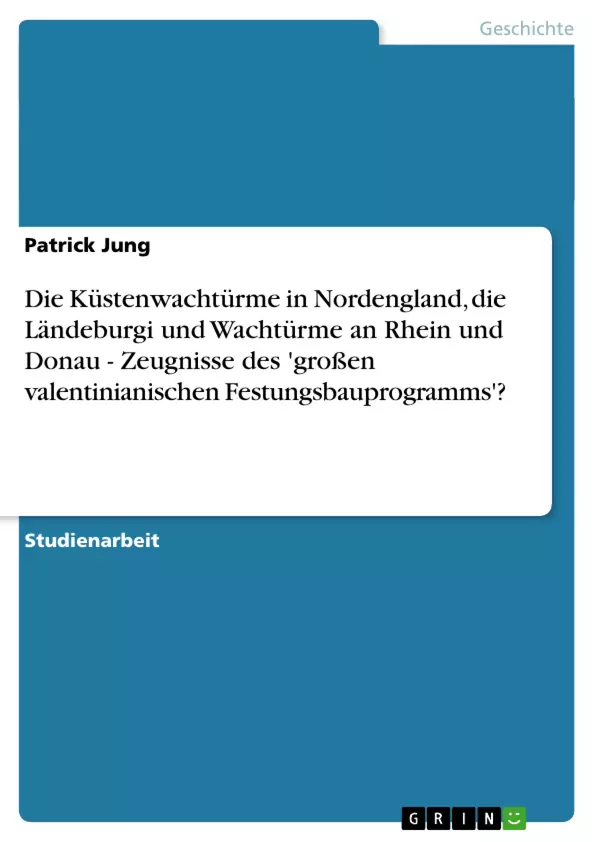„Zu dieser Zeit erklangen fast in der ganzen römischen Welt die Kriegstrompeten. Die wildesten Völker wurden aufgeboten und zogen durch die Grenzgebiete in ihrer Nähe. Die Alamannen verwüsteten gleichzeitig Gallien und Raetien, die Sarmaten und Quaden die pannonischen Länder, die Pikten und Sachsen, die Scotten und Attascotten suchten die Britannier mit stetem Unglück heim, die Austorianer und andere Maurenstämme verübten schlimmere Einfälle als sonst in Afrika, und die Räuberhaufen der Goten plünderten Thrakien.“ 1
Die Spätantike war eine Zeit der Grenzen. Das imperium sine fine des Vergil 2 existierte längst nicht mehr. Die Römer waren von der lange praktizierten expansiven Außenpolitik in die Defensive geraten. An allen Fronten bedrängten die Feinde des Reiches dessen Grenzen. So auch an Rhein und Donau. Germanen, Hunnen, Alanen, Sarmaten und andere aggressive Nachbarn machten es notwendig, daß die Römer ihr Territorium absicherten. Zu den Verteidigungslinien an den beiden großen Flußgrenzen gehörten neben der zivilen Infrastruktur militärische Bauten unterschiedlicher Art: Legionslager, Kastelle, aber auch kleinere Fortifikationen verschiedener Form und Zweckbestimmung. Diese Signalstationen, Wachtürme (Burgi) und befestigte Anlandemöglichkeiten für Flußschiffe (Ländeburgi) sollen in dieser Arbeit untersucht werden.
Als Quellenmaterial stehen uns dazu vor allem die archäologischen Hinterlassenschaften zur Verfügung. Zwar sind verwertbare Befunde und Funde in großer Zahl vorhanden, doch man stößt bei ihrer Interpretation in Bezug auf Fragen der Datierung und Funktion häufig auf Grenzen. Für die Problematik der zeitlichen Einordnung sind vor allem Ziegelstempel und Bauinschriften, also epigraphische Zeugnisse, von großer Bedeutung. Die schriftlichen Quellen schließlich beschränken sich auf wenige Autoren. In erster Linie ist Ammianus Marcellinus zu nennen, ein Geschichtsschreiber und Panegyriker (Lobredner) griechischer Herkunft. Ihm haben wir das letzte große Geschichtswerk der Antike zu verdanken.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Küstenwachtürme in Nordengland
- Beschreibung und Rekonstruktion der Befunde
- Funktion
- Datierung
- Ländeburgi an Rhein und Donau
- Verbreitung
- Lage
- Beschreibung und Rekonstruktion der Befunde
- Datierung
- Wachtürme an Donau und Rhein
- Donauknie (Valeria)
- Obere Donau (Pannonia I und Noricum Ripense)
- Donau-Iller-Rheinlimes (Raetia II und Maxima Sequanorum)
- Ober- bis Niederrhein (Maxima Sequanorum, Germania I und Germania II)
- Die Sicherung der Flußgrenzen in der Spätantike: Zur Funktion der Ländeburgi und Wachtürme an Rhein und Donau
- Zusammenfassung.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Küstenwachtürmen in Nordengland, den Ländeburgi und Wachtürmen an Rhein und Donau und untersucht deren Rolle im spätrömischen Verteidigungssystem. Ziel ist es, die archäologischen Befunde zu analysieren und die Funktion und Datierung dieser Bauwerke zu erforschen.
- Beschreibung und Rekonstruktion der Küstenwachtürme in Nordengland
- Analyse der Funktion und Datierung der Ländeburgi an Rhein und Donau
- Untersuchung der Funktion und Datierung der Wachtürme an Donau und Rhein
- Die Bedeutung der Ländeburgi und Wachtürme für die Sicherung der Flußgrenzen in der Spätantike
- Einordnung der Bauwerke in das spätrömische Verteidigungssystem
Zusammenfassung der Kapitel
- Das einführende Kapitel liefert einen Überblick über die historische Situation in der Spätantike und die Bedrohungen, denen das Römische Reich an seinen Grenzen ausgesetzt war.
- Das Kapitel zu den Küstenwachtürmen in Nordengland beschreibt die Bauweise und den Aufbau dieser Anlagen und analysiert ihre Funktion im Verteidigungssystem der römischen Provinz Britannia.
- Das Kapitel über die Ländeburgi an Rhein und Donau befasst sich mit der Verbreitung, Lage und Bauweise dieser Anlagen. Die Analyse der Funde ermöglicht Rückschlüsse auf die Datierung und Funktion der Ländeburgi.
- Das Kapitel zu den Wachtürmen an Donau und Rhein behandelt die einzelnen Abschnitte des römischen Limes und stellt die verschiedenen Arten der Wachtürme vor. Die Untersuchung der archäologischen Befunde gibt Aufschluss über die Funktion und die zeitliche Einordnung der Bauwerke.
- Das Kapitel zur Sicherung der Flußgrenzen in der Spätantike beleuchtet die strategische Bedeutung der Ländeburgi und Wachtürme für die Verteidigung des römischen Reiches.
Schlüsselwörter
Spätantike, Küstenwachtürme, Ländeburgi, Wachtürme, römischer Limes, Verteidigungssystem, Flußgrenze, Rhein, Donau, Britannia, Pannonien, Raetien, Germania, Archäologie, Datierung, Funktion.
- Quote paper
- Patrick Jung (Author), 2001, Die Küstenwachtürme in Nordengland, die Ländeburgi und Wachtürme an Rhein und Donau - Zeugnisse des 'großen valentinianischen Festungsbauprogramms'?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/26068