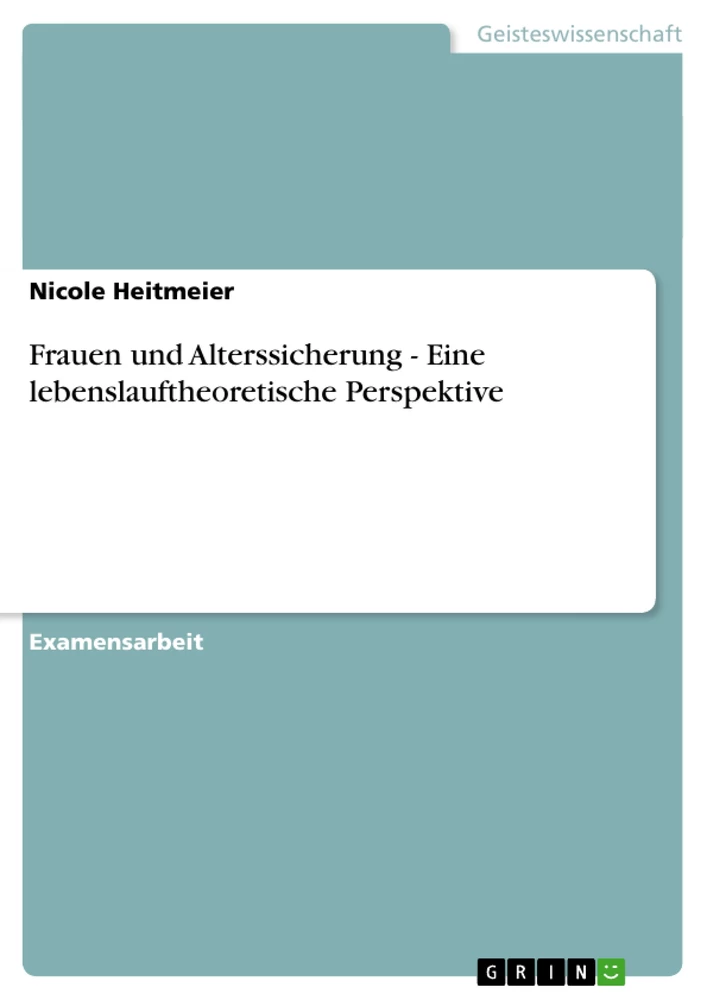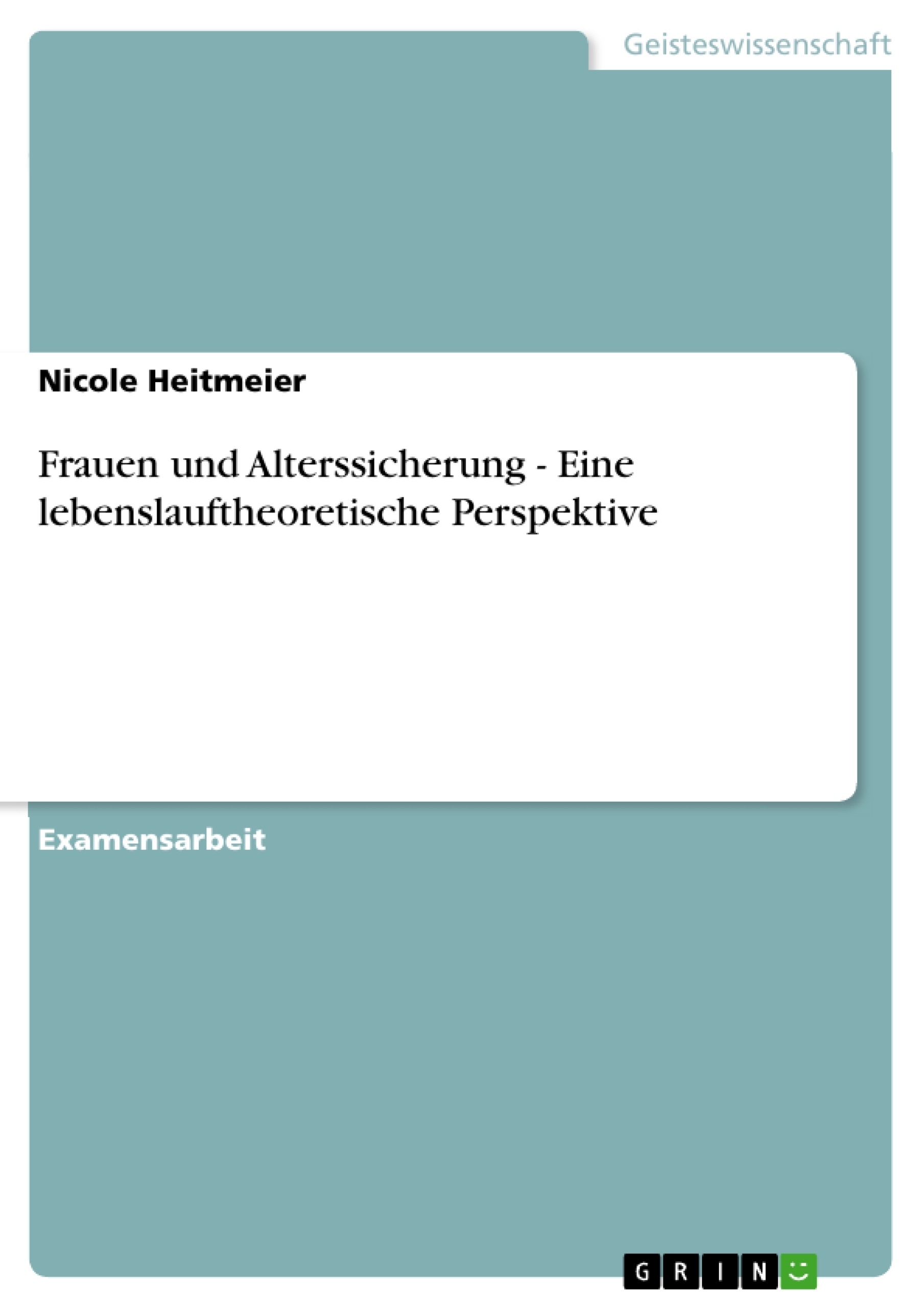Die vorliegende Ausarbeitung beschäftigt sich mit der Frage nach der Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. Im Mittelpunkt der (folgenden) Ausführungen steht die gesetzliche Altersvorsorge in Deutschland. Sie erzeugt aus lebenslauftheoretischer Perspektive heraus gewisse Erwartungshaltungen an einen finanziell gesicherten Ruhestand. Die ausgezahlte Rente in der Ruhephase des Lebenslaufs spiegelt eine sozialstaatliche Leistung wieder, die als Ergebnis der bis dahin erbrachten Leistungen im Lebensverlauf der Individuen zu interpretieren ist. Mit den rentenrechtlichen Vorgaben und Zugangsvoraussetzungen wird die an den Bürger gerichtete Leistung wohlfahrtsstaatlich definiert. Die Kriterien Erwerbsarbeit und Ehe stellen den Kern eines Rentensystems dar, welches auf dem Leitbild eines männlichen Haupternährers beruht. Aus diesen sozialstaatlichen Strukturen können soziale Ungleichheiten für Frauen entstehen. Im Zusammenhang mit gesellschaftlichem Wandel wird dieses System in Frage gestellt, nicht zuletzt, weil das Armutsrisiko von Frauen in Deutschland in den letzten Jahren gestiegen ist.
Für eine ausführliche Beschreibung des Geschlechterverhältnisses am Beispiel der gesetzlichen Rentenversicherung, ist eine knappe Erläuterung des Terminus „Geschlecht“ erforderlich. Das Verhältnis zwischen den Geschlechtern wird auf unterschiedlichste Art diskutiert und beschreibt in erster Linie die Geschlechterzugehörigkeit zu bestimmten Tätigkeiten im alltäglichen Leben. So kann das Verhältnis als traditionelles verstanden werden, wenn sich das männliche Geschlecht in die Rolle des Familienernährers und das weibliche in die Rolle der Hausfrau und Mutter ein-ordnen lässt oder es kann ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen den Geschlechtern vorliegen, wenn sowohl der Mann als auch die Frau an den Bereichen Familie und Arbeitsmarkt gleichermaßen partizipieren. Der Begriff enthält aber mehr als eine bloße Beschreibung beobachtbarer Verhältnisse, er verdeutlich zum einen wie eine bestimmte Gesellschaft sich über diesen Begriff verständigt hat, zum anderen werden damit die Spuren aufgedeckt, wie Geschlecht und speziell Geschlechterdifferenzen legitimiert und verbreitet wurden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Lebenslauf
- Die Grundlagen der soziologischen Lebenslaufbetrachtung
- Die lebenslauftheoretische Perspektive
- Die wichtigsten Leitbegriffe in der Lebenslauftheorie
- Das Lebenslaufkonzept und Geschlecht
- Die Lebenslaufverflechtung und Institutionalisierung
- Einflussfaktoren für die Lebenslaufgestaltung
- Die Verflechtungsstruktur in der Familie
- Der Lebenslauf als Institution
- Der Wandel der Lebensverläufe und das Geschlechterverhältnis
- Zusammenfassung
- Die Grundlagen der soziologischen Lebenslaufbetrachtung
- Die Lebenslaufpolitik
- Theorien des Wohlfahrtsstaats und das Geschlechterverhältnis
- Der Wohlfahrtsstaat und seine Entwicklung
- Die Typologie des Wohlfahrtsstaates und Geschlecht
- Geschlechterdifferenzen im Zusammenhang kultureller und institutioneller Rahmenbedingungen
- Lebenslaufpolitik und Geschlecht
- Die problematische Beziehung zwischen Sozialpolitik und Geschlecht
- Die Ebenen der Benachteiligung weiblicher Lebensläufe
- Die Wirkung geschlechterdifferenter Sozialpolitik auf den weiblichen Lebenslauf
- Zusammenfassung
- Theorien des Wohlfahrtsstaats und das Geschlechterverhältnis
- Die Alterssicherung von Frauen
- Die gesetzliche Rentenversicherung Deutschlands – Ein historischer Überblick
- Die Verknüpfungslogik zwischen Alterssicherungssystem und Lebenslauf
- Erwerbstätigkeit im Zusammenhang mit der Alterssicherung
- Ehe und Kinder im Zusammenhang mit der Alterssicherung
- Das soziokulturelle Leitbild im Zusammenhang mit der Alterssicherung
- Zusammenfassung
- Die geschlechtsspezifische Ungleichheit in der Alterssicherung
- Die Differenzen im Alterseinkommen im Kontext gespaltener Lebensverläufe
- Die institutionalisierte Ungleichheit für Frauen im Rentensystem
- Die Berücksichtigung weiblicher Lebensläufe in unterschiedlichen Alterssicherungsmodellen
- Die Reform 2001 – Was hat sich für den weiblichen Lebenslauf geändert?
- Die Spaltung und Verflechtung von Lebensläufen – ein Produkt deutscher Rentenpolitik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Examensarbeit untersucht die geschlechtsspezifische Ungleichheit in der deutschen gesetzlichen Altersvorsorge aus lebenslauftheoretischer Perspektive. Ziel ist es, die Entstehung und Persistenz dieser Ungleichheit aufzuzeigen und zu analysieren, wie sie sich in den verschiedenen Phasen des weiblichen Lebenslaufs manifestiert.
- Lebenslauftheoretische Betrachtung der Alterssicherung
- Geschlechtsspezifische Ungleichheiten im deutschen Rentensystem
- Einfluss von Ehe und Mutterschaft auf die Rentenhöhe von Frauen
- Die Rolle des Wohlfahrtsstaates und seiner geschlechterdifferenten Politiken
- Analyse der Rentenreform von 2001 und deren Auswirkungen auf Frauen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der geschlechtsspezifischen Ungleichheit in der Altersvorsorge ein und skizziert den Ansatz der Arbeit, der auf einer lebenslauftheoretischen Perspektive basiert. Sie hebt die Problematik des traditionellen Rollenverständnisses im Kontext des deutschen Rentensystems hervor und stellt die Frage nach der Legitimationskraft eines Systems, das soziale Ungleichheit produziert. Der Begriff „Geschlecht“ wird differenziert betrachtet, mit Bezug auf die Unterscheidung zwischen sex und gender.
Der Lebenslauf: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der lebenslauftheoretischen Betrachtungsweise dar. Es definiert zentrale Konzepte und analysiert die Verflechtung von individuellen Lebensläufen mit gesellschaftlichen Strukturen und Institutionen. Der Einfluss von Geschlechterrollen auf die Gestaltung von Lebensläufen wird herausgearbeitet, insbesondere im Hinblick auf die unterschiedlichen Erwartungen und Möglichkeiten für Frauen und Männer. Der Wandel der Lebensverläufe und das sich verändernde Geschlechterverhältnis werden ebenfalls beleuchtet.
Die Lebenslaufpolitik: Dieses Kapitel befasst sich mit den Theorien des Wohlfahrtsstaats und dem Einfluss des Geschlechterverhältnisses auf die Gestaltung von Sozialpolitik. Es analysiert, wie geschlechterdifferente Rahmenbedingungen und institutionelle Strukturen zu Benachteiligungen im weiblichen Lebenslauf führen. Die problematische Beziehung zwischen Sozialpolitik und Geschlecht wird detailliert untersucht und die verschiedenen Ebenen der Benachteiligung von Frauen im Kontext der Sozialpolitik werden aufgezeigt.
Die Alterssicherung von Frauen: Dieses Kapitel analysiert die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland aus historischer Perspektive und untersucht die Verknüpfung zwischen Alterssicherungssystem und Lebenslauf. Es beleuchtet die geschlechtsspezifische Ungleichheit in der Alterssicherung, die sich aus unterschiedlichen Erwerbstätigkeitsbiografien, Familienstrukturen und soziokulturellen Leitbildern ergibt. Die Auswirkungen der Rentenreform von 2001 auf den weiblichen Lebenslauf werden ebenfalls diskutiert.
Schlüsselwörter
Lebenslauftheorie, Alterssicherung, Geschlechterverhältnis, Rentenversicherung, Sozialpolitik, Frauen, Ungleichheit, Wohlfahrtsstaat, Rentenreform, Erwerbstätigkeit, Ehe, Mutterschaft, Gender, Sex.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Geschlechtsspezifische Ungleichheit in der deutschen Altersvorsorge
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Examensarbeit untersucht die geschlechtsspezifische Ungleichheit in der deutschen gesetzlichen Altersvorsorge aus lebenslauftheoretischer Perspektive. Das Ziel ist es, die Entstehung und Persistenz dieser Ungleichheit aufzuzeigen und zu analysieren, wie sie sich in den verschiedenen Phasen des weiblichen Lebenslaufs manifestiert.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: lebenslauftheoretische Betrachtung der Alterssicherung, geschlechtsspezifische Ungleichheiten im deutschen Rentensystem, Einfluss von Ehe und Mutterschaft auf die Rentenhöhe von Frauen, die Rolle des Wohlfahrtsstaates und seiner geschlechterdifferenten Politiken sowie die Analyse der Rentenreform von 2001 und deren Auswirkungen auf Frauen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel „Einleitung“, „Der Lebenslauf“, „Die Lebenslaufpolitik“ und „Die Alterssicherung von Frauen“. Jedes Kapitel enthält detaillierte Unterpunkte, die die jeweiligen Themenbereiche vertiefen.
Was sind die zentralen Konzepte des Kapitels „Der Lebenslauf“?
Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der lebenslauftheoretischen Betrachtungsweise dar. Es definiert zentrale Konzepte wie die Verflechtung von individuellen Lebensläufen mit gesellschaftlichen Strukturen und Institutionen und analysiert den Einfluss von Geschlechterrollen auf die Gestaltung von Lebensläufen, insbesondere im Hinblick auf die unterschiedlichen Erwartungen und Möglichkeiten für Frauen und Männer. Der Wandel der Lebensverläufe und das sich verändernde Geschlechterverhältnis werden ebenfalls beleuchtet.
Worüber handelt das Kapitel „Die Lebenslaufpolitik“?
Dieses Kapitel befasst sich mit den Theorien des Wohlfahrtsstaats und dem Einfluss des Geschlechterverhältnisses auf die Gestaltung von Sozialpolitik. Es analysiert, wie geschlechterdifferente Rahmenbedingungen und institutionelle Strukturen zu Benachteiligungen im weiblichen Lebenslauf führen. Die problematische Beziehung zwischen Sozialpolitik und Geschlecht wird detailliert untersucht und die verschiedenen Ebenen der Benachteiligung von Frauen im Kontext der Sozialpolitik werden aufgezeigt.
Was wird im Kapitel „Die Alterssicherung von Frauen“ behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland aus historischer Perspektive und untersucht die Verknüpfung zwischen Alterssicherungssystem und Lebenslauf. Es beleuchtet die geschlechtsspezifische Ungleichheit in der Alterssicherung, die sich aus unterschiedlichen Erwerbstätigkeitsbiografien, Familienstrukturen und soziokulturellen Leitbildern ergibt. Die Auswirkungen der Rentenreform von 2001 auf den weiblichen Lebenslauf werden ebenfalls diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Lebenslauftheorie, Alterssicherung, Geschlechterverhältnis, Rentenversicherung, Sozialpolitik, Frauen, Ungleichheit, Wohlfahrtsstaat, Rentenreform, Erwerbstätigkeit, Ehe, Mutterschaft, Gender, Sex.
Wie wird der Begriff „Geschlecht“ in der Arbeit verwendet?
Der Begriff „Geschlecht“ wird differenziert betrachtet, mit Bezug auf die Unterscheidung zwischen sex und gender.
Welche Methode wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine lebenslauftheoretische Perspektive, um die geschlechtsspezifische Ungleichheit in der Altersvorsorge zu analysieren.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zeigt auf, wie sich geschlechtsspezifische Ungleichheiten in den verschiedenen Phasen des weiblichen Lebenslaufs manifestieren und wie diese durch das deutsche Rentensystem verstärkt werden. Es wird analysiert, inwiefern traditionelle Rollenverständnisse und geschlechterdifferente Politiken zu dieser Ungleichheit beitragen.
- Quote paper
- Nicole Heitmeier (Author), 2003, Frauen und Alterssicherung - Eine lebenslauftheoretische Perspektive, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/25949