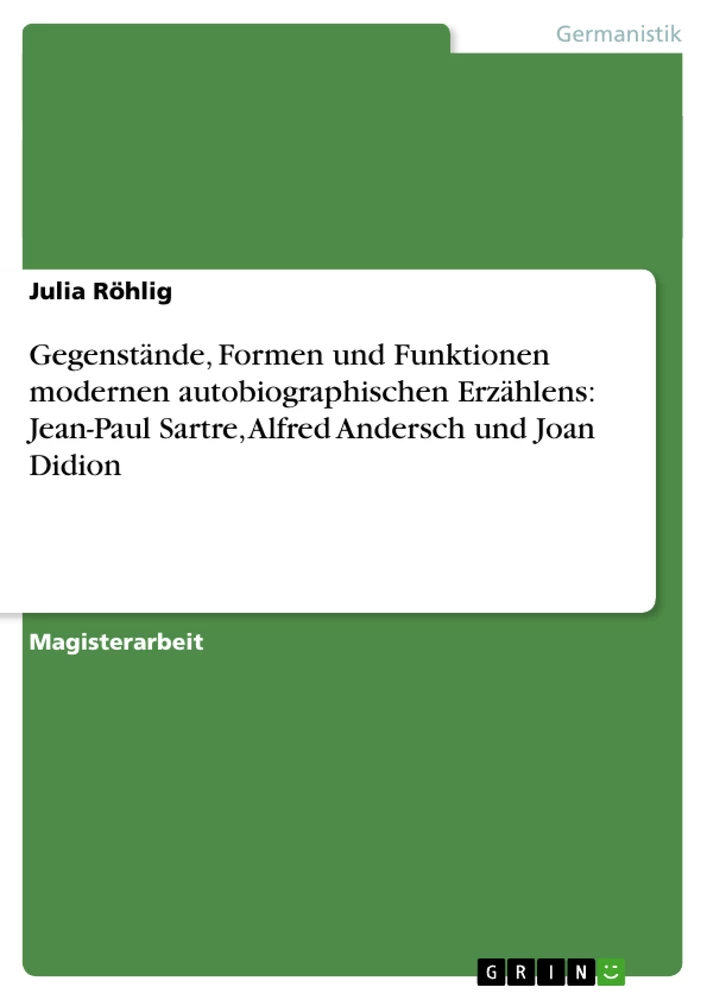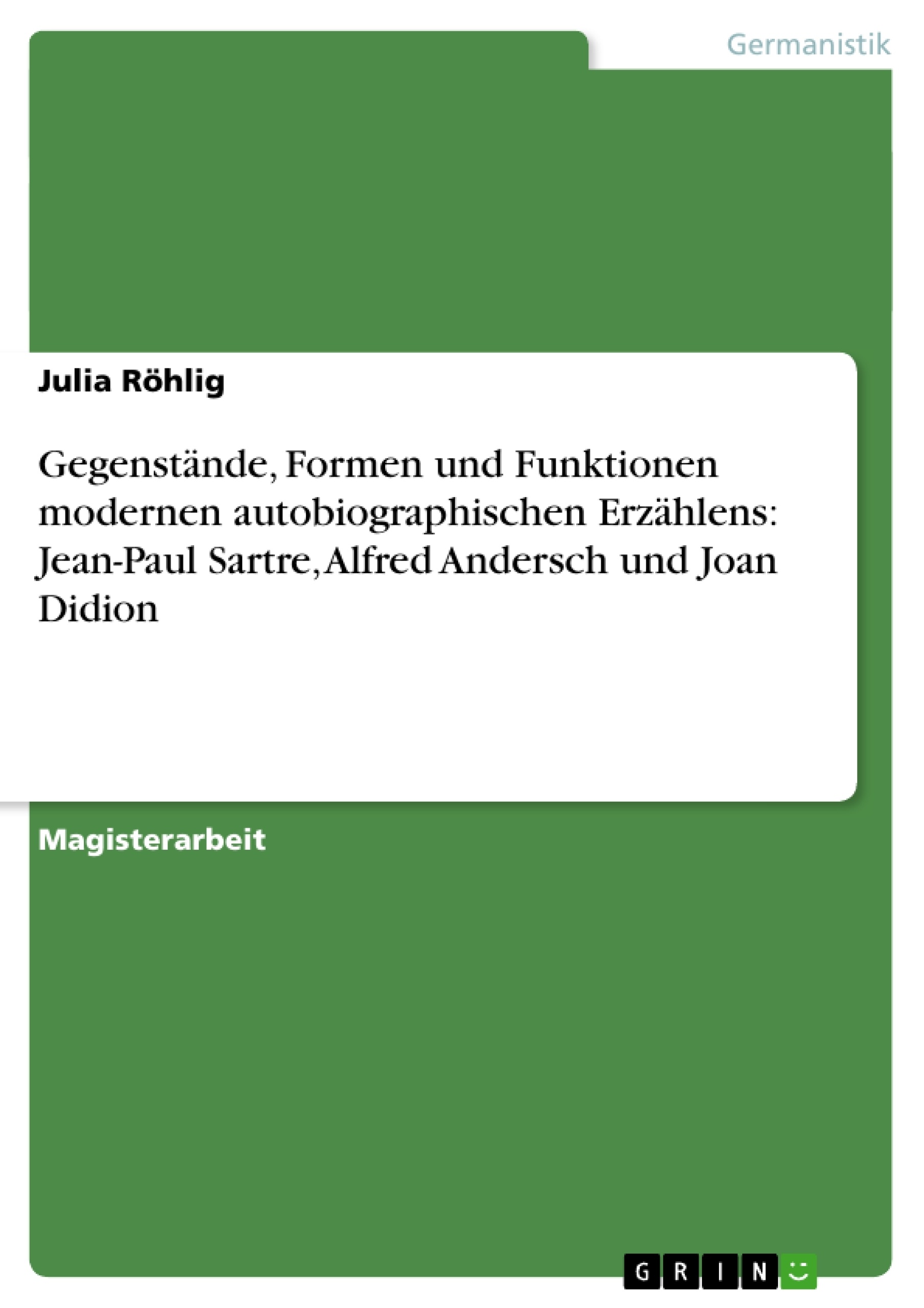[...] Zum Vorgehen: Trotz der anfangs genannten Einschränkungen hinsichtlich der theoretischen Reichweite dieser Arbeit wird es nötig sein, den konkreten Textanalysen einige theoretische und allgemeine Überlegungen voranzustellen (Kap. 2): So sollen zunächst die Begriffe ‚autobiographisch’ bzw. ‚Autobiographie’ und ‚Erzählen’ im literaturwissenschaftlichen Sinn definiert werden, um den gattungstypologischen Standort der Texte zumindest grob zu bestimmen und für die folgenden Analysen das nötige begriffliche ‚Rüstzeug’ bereitzustellen (Kap. 2.1). Daran fügen sich einige Überlegungen zur existentiellen Funktion autobiographischen Erzählens im allgemeinen sowie zu den Hintergründen, Bedingungen und typologischen Merkmalen der Akzentverschiebung im modernen autobiographischen Erzählen im besonderen an, mit denen die oben aufgestellten Thesen vertieft und differenziert werden sollen (Kap. 2.2). Der dritte Teil der Arbeit umfaßt die Analysen der Texte. Aufgrund ihrer Verschiedenheit werde ich die Texte getrennt behandeln (Kap. 3.1, 3.2, 3.3). In den einzelnen Untersuchungen fließen jeweils zwei Interessenrichtungen zusammen. Die eine richtet sich generell auf den Zusammenhang zwischen der existentiellen Funktion, die das autobiographische Erzählen jeweils für die Autoren erfüllt, und der spezifischen Selektion, Anordnung und Präsentation des Lebensstoffes. Die Gliederung meines Vorgehens in den einzelnen Text-Kapiteln wird sich nach dieser Fragestellung richten: Für jeden Text möchte ich untersuchen, welche Funktion er für seinen Autor hat (Kap. 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1), wie sich diese Funktion in den Formen und Gegenständen des Erzählens manifestiert (Kap. 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2) und welchen Ausgang bzw. welches Ergebnis die autobiographische Suche hat (Kap. 3.1.3, 3.2.3, 3.3.3). Die zweite Interessenrichtung bezieht sich auf die Modernität und Innovativität der Texte im oben erläuterten Sinne: Inwiefern heben sich die Texte von der Tradition ab und inwiefern sind sie darin miteinander vergleichbar? Diese Fragen bestimmen die Untersuchungs- und Deutungsschwerpunkte bei den Analysen der Texte, das heißt, ich werde natürlich nur diejenigen inhaltlichen und formalen Besonderheiten behandeln, die mir im Hinblick auf die Entwicklungen der modernen Autobiographik bedeutsam erscheinen. Die entsprechenden Einordnungen und Abgrenzungen werden in die Analysen einfließen und in einem abschließenden Resümee noch einmal in geraffter Form rekapituliert. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Theoretischer Teil
- 2.1 Begriffsbestimmungen
- 2.1.1 Die Autobiographie und ihre Nachbargattungen
- 2.1.2 Erzählen..........\n
- 2.2 Funktionen, Formen und Gegenstände (modernen) autobiographischen Erzählens-grundsätzliche Überlegungen...\n
- 2.2.1 Die existentielle Funktion autobiographischen Erzählens.
- 2.2.1.1 Autobiographisches Erzählen und personale Identität.
- 2.2.1.2 Identitätsungewißheit und existentielle Haltlosigkeit als Ausgangspunkte modernen autobiographischen Erzählens .\n
- 2.2.2 Konsequenzen der modernen Identitätsproblematik für das autobiographische Erzählen\n
- 3. Drei moderne autobiographische Erzähltexte.....\n
- 3.1 Jean-Paul Sartre: Les Mots
- 3.1.1 Autobiographisches Erzählen als Instrument analytischer Erkenntnis und idealtheoretischer Selbst-Konstruktion.\n
- 3.1.2 Erzählen unter der,Diktatur des Sinns'.
- 3.1.2.1 Aufbau: Dialektik im Gewand einer Geschichte..\n
- 3.1.2.2 Gegenstand ...
- 3.1.2.2.1 Der vermeintliche Bruch von 1916: metadiskursive Nachschöpfung des Wahnsinns in, Verschiebungen'\nund, Entstellungen'\n
- 3.1.2.2.2 Klassische Elemente der Kindheitserzählung im Dienst der Dialektik\n
- 3.1.2.3 Figuren als Rollenträger.\n
- 3.1.2.4, Der Mann im Kind': Perspektive und Stellung des autobiographischen Subjekts..\n
- 3.1.2.5 Stil und Darstellung: Ein abtrünniger Meister der,belles-lettres' ...
- 3.1.3 Das Ergebnis der autobiographischen Suche: existentielle Bestimmungslosigkeit als positives Lebensaxiom...\n
- 3.2 Alfred Andersch: Der Seesack. Aus einer Autobiographie..\n
- 3.2.1 Autobiographisches Erzählen als Selbstversuch und Selbstsuche\n
- 3.2.2 Erzählen als Widerspiegelung eines ungewissen Such-Prozesses
- 3.2.2.1 Aufbau: Ein,ungeordnetes Buch, das kein Buch ist'\n
- 3.2.2.2 Gegenstand..\n
- 3.2.2.2.1 Eine Situation existentieller Ungewißheit als Anhaltspunkt der Identitäts-Suche\n
- 3.2.2.2.2 Begebenheiten, Begegnungen, Augenblicke und ‚Fremdmaterial” mit möglichem Erkenntnisgewinn .....\n
- 3.2.2.3 Stellung des autobiographischen Subjekts:\nEin dominanter Sprecher.\n
- 3.2.2.4,Tupfen-Stil' und,Flickenteppich': Stil, Redeweisen,\nRedegestik\n
- 3.2.3,Ergebnis' und existentieller Stellenwert der autobiographischen Suche: ein Versuch mit geringem Erfolg?\n
- 3.3 Joan Didion: The White Album..\n
- 3.3.1 Autobiographisches Erzählen als Akt elementarer existentieller Selbstbehauptung\n
- 3.3.2 Eine Erzählung (von) der Krise des Erzählens.........\n
- 3.3.2.1 Aufbau: „,not a movie but a cutting-room experience“\n
- 3.3.2.2 Gegenstand ..\n
- 3.3.2.2.1 Einseitige Materialauswahl und -darstellung\nExkurs: The White Album - eine Reportage über die,Sixties'?.\n
- 3.3.2.2.2,,Here are some particulars” - zum Stellenwert und zur Funktion des Konkreten und Einzelnen im White Album .....
- 3.3.2.3 Stellung des autobiographischen Subjekts:\nEine unzuverlässige Erzählerin\n
- 3.3.2.4 Zeigen statt Sagen: Stil, Rhetorik und Redegestik als zentrale Bedeutungs-Träger\n
- 3.3.3 Ergebnis?.....\n
- 4. Zusammenfassung.\n
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Zusammenhängen zwischen Gegenständen, Formen und Funktionen modernen autobiographischen Erzählens und möchte somit einen Beitrag zur Ausweitung erzähltheoretischer Fragestellungen leisten, insbesondere im Bereich des autobiographischen Erzählens. Sie analysiert drei moderne autobiographische Erzähltexte – von Jean-Paul Sartre, Alfred Andersch und Joan Didion – und untersucht, welche Rolle die existenzielle Funktion, die Form und der Inhalt des jeweiligen Textes im Kontext der modernen Identitätsproblematik spielen.
- Die existentielle Funktion autobiographischen Erzählens im Spannungsfeld von persönlicher Identität und Identitätsungewissheit.
- Die Bedeutung von Form und Inhalt in modernen autobiographischen Erzählungen und ihre Beziehung zur Suche nach Sinn und Identität.
- Die Rolle des Erzählers in modernen autobiographischen Erzählungen und die Frage der Zuverlässigkeit der Erzählung.
- Der Einfluss von gesellschaftlichen und historischen Bedingungen auf die Gestaltung des autobiographischen Erzählens.
- Der Stellenwert des Konkreten und Individuellen im autobiographischen Erzählen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit untersucht die Gegenstände, Formen und Funktionen von drei modernen autobiographischen Erzähltexten – „Les Mots“ von Jean-Paul Sartre, „Der Seesack“ von Alfred Andersch und „The White Album“ von Joan Didion. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie diese Texte die moderne Identitätsproblematik spiegeln und wie sie mit der Suche nach Sinn und Identität umgehen.
- Das Kapitel zu Jean-Paul Sartres „Les Mots“ analysiert das autobiographische Erzählen als Instrument der Selbstkonstruktion und analytischen Erkenntnis. Dabei wird besonders der Aufbau des Textes als Dialektik im Gewand einer Geschichte untersucht und die Rolle der Figuren als Rollenträger betrachtet.
- Das Kapitel zu Alfred Anderschs „Der Seesack“ beleuchtet das autobiographische Erzählen als Selbstversuch und Selbstsuche. Der Fokus liegt hier auf dem ungewissen Suchprozess, der im Text widerspiegelt wird, und der Stellung des Erzählers als dominanter Sprecher.
- Das Kapitel zu Joan Didions „The White Album“ betrachtet das autobiographische Erzählen als Akt der Selbstbehauptung und als Erzählung der Krise des Erzählens. Hier wird die einseitige Materialauswahl und Darstellung des Textes, sowie die Rolle des konkreten und individuellen Elements als zentrale Elemente analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem modernen autobiographischen Erzählen, der existentiellen Funktion des Erzählens, der Identitätsproblematik, der Suche nach Sinn, dem Aufbau und der Form von Texten, der Rolle des Erzählers und der Bedeutung von Sprache und Stil. Sie untersucht drei moderne autobiographische Erzähltexte: "Les Mots" von Jean-Paul Sartre, "Der Seesack" von Alfred Andersch und "The White Album" von Joan Didion.
- Quote paper
- Julia Röhlig (Author), 2003, Gegenstände, Formen und Funktionen modernen autobiographischen Erzählens: Jean-Paul Sartre, Alfred Andersch und Joan Didion, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/25900