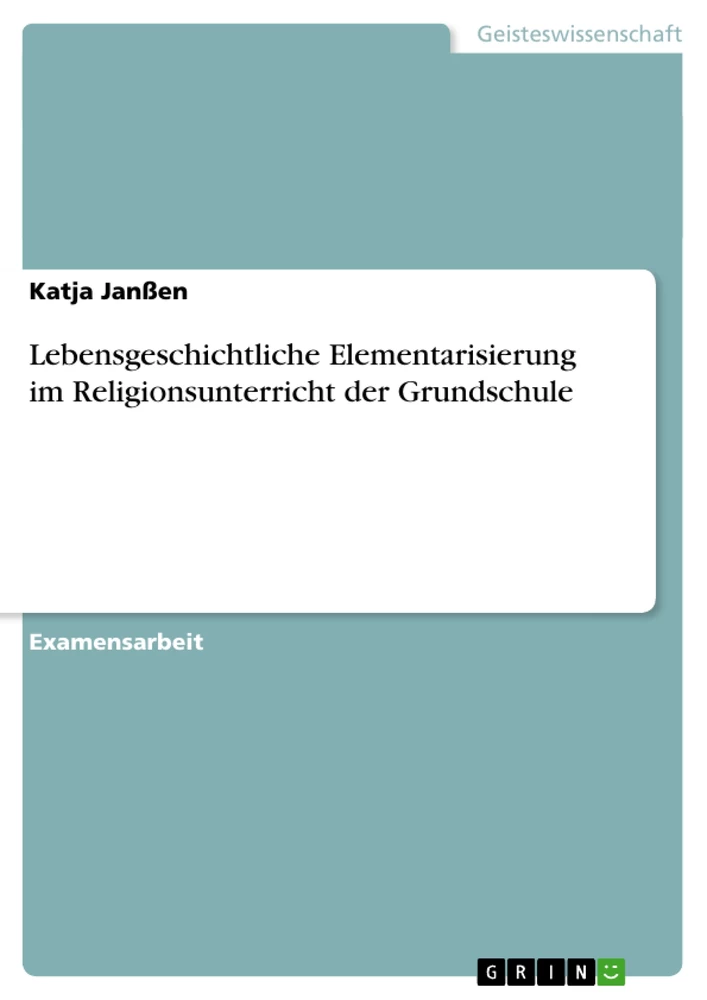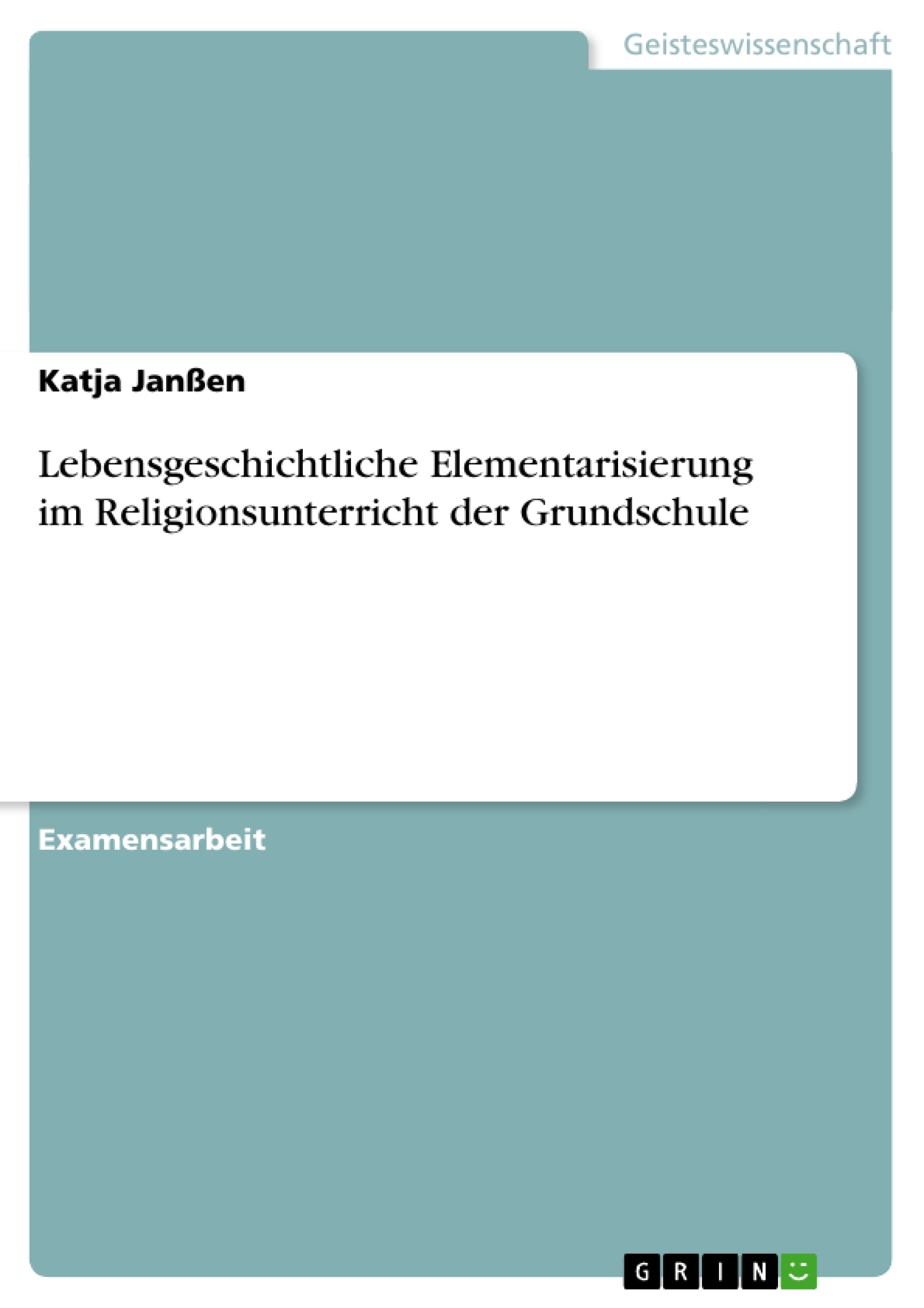In der vorliegenden Examensarbeit widme ich mich dem Thema Lebensgeschichtliche Elementarisierung im Religionsunterricht der Grundschule. Im Vordergrund soll dabei das von Karl Ernst Nipkow und Friedrich Schweitzer entwickelte didaktische Modell der Elementarisierung stehen, das erstmals ganz konkret die entwicklungspsychologischen und damit die lebensgeschichtlichen Aspekte auf der Schülerseite bei didaktischen Überlegungen mit einplant. Nach Nipkow und Schweitzer kann ein Unterricht, der nur die vom Lehrer vermutete Erfahrungsnähe berücksichtigt, die Schüler nicht lebensgeschichtlich berühren, so dass der zu vermittelnde Inhalt die Schüler nicht erreicht. Lebensgeschichtliche Elementarisierung bedeutet nicht, dass die Berücksichtigung der Schülerseite vor der Inhaltsseite stehen sollte. Charakteristisch für das Modell der Elementarisierung ist, dass beide Seiten dieselbe Aufmerksamkeit bekommen sollen und stets in einem wechselseitig, sich ergänzenden Verhältnis stehen. Vor der theoretischen Erläuterung des Modells, werden zunächst im 2. Kapitel wichtige Begriffe und Sachverhalte für das Verständnis definiert. Da die Beachtung der Entwicklungspsychologie und deren Modelle der religiösen Entwicklung nur Sinn macht, wenn sie in einem Zusammenhang zur religiösen Erziehung stehen, wird die Frage nach deren Verhältnis zueinander in Kapitel 3 erläutert. Kapitel 4 widmet sich Begriffen, die in der Religionspädagogik häufig zu Verwechslungen führen, damit soll eine, für die Examensarbeit eindeutig geltende Unterscheidung gekennzeichnet werden. Der Begriff der Elementarisierung ist nicht erst mit dem Modell nach Nipkow und Schweitzer entstanden, er kommt ursprünglich aus der Allgemeinen Pädagogik und hat einen langen Weg bis zum Gebrauch in der Religionspädagogik zurück gelegt. Dem danach wichtigen geschichtlichen Werdegang wird in Kapitel 5 auf die Spur gegangen. Aufgrund seiner nicht immer ganz eindeutigen Terminologie (siehe Kapitel 4) wird der Begriff Elementarisierung in der Religionsdidaktik in drei verschiedenen Disziplinen verwendet, wobei nicht immer dasselbe gemeint ist. In Kapitel 6 wird der Versuch gemacht, das für die jeweilige Didaktik geltende Verständnis von Elementarisierung zu beleuchten. Das 7. Kapitel wendet sich ganz ausführlich dem Tübinger Modell der Elementarisierung zu. Es wird auf die Entstehung des Konzeptes eingegangen, aber auch auf dem Konzept zu Grunde liegenden Terminologien. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definitionen
- 2.1 Lebensgeschichte
- 2.2 Entwicklung von Religiosität / religiöse Entwicklung
- 2.3 Zyklisches und fortschrittsbezogenes Bild von Entwicklung
- 2.4 Elementarisierung
- 3. Das Verhältnis zwischen religiöser Entwicklung und religiöser Erziehung
- 3.1 Begründung der Berücksichtigung von religiöser Entwicklung für die religiöse Erziehung
- 3.2 Ziele entwicklungsbezogener Erziehung
- 3.3 Forderungen an eine entwicklungsbezogene Erziehung
- 4. Klärungen von Unterschieden
- 4.1 Elementartheologie und Elementarisierung
- 4.2 Elementarisierung und Korrelationsdidaktik
- 5. Geschichtliche Entwicklung des Verständnisses von Elementarisierung
- 5.1 Zum allgemeindidaktischen Hintergrund
- 5.2 Zum religionsdidaktischen Hintergrund
- 6. Elementarisierung als didaktisches Konzept
- 6.1 Die bibelorientierte Didaktik
- 6.2 Die erfahrungsorientierte Symboldidaktik
- 6.3 Die subjektivitätstheoretische, entwicklungsadäquate Religionsdidaktik
- 7. Das Tübinger Modell der Elementarisierung nach Nipkow und Schweitzer
- 7.1 Elementarisierung als Modell der Planung von Unterricht
- 7.1.1 Die Entwicklung des Konzepts
- 7.1.2 Klärung des Verständnisses von „Unterrichtsplanung“ und „Unterrichtsgestaltung“
- 7.1.3 Bedeutung der Elementarisierung für die Planung von Unterricht
- 7.1.4 Konsequenzen für die drei Ebenen der Unterrichtsplanung
- 7.1.5 Planungsmuster
- 7.2 Elementarisierung als didaktische Analyse
- 7.2.1 Elementare Strukturen
- 7.2.2 Elementare Erfahrungen
- 7.2.3 Elementare Zugänge
- 7.2.4 Elementare Wahrheiten
- 7.2.5 Elementare Lernwege
- 8. „Lebensgeschichtliche Elementarisierung“ – Die besondere Bedeutung der Entwicklungspsychologie im Tübinger Elementarisierungsansatz
- 9. Elementarisierung in der Praxis: Unterrichtsvorbereitung und -durchführung einer Unterrichtsreihe über Propheten nach Rainer Oberthür
- 9.1 Die Unterrichtreihe im Schema der Elementarisierung als didaktische Analyse
- 9.1.1 Elementare Strukturen
- 9.1.2 Elementare Erfahrungen
- 9.1.3 Elementare Zugänge
- 9.1.4 Elementare Wahrheiten
- 9.1.5 Elementare Zugänge
- 9.2 Didaktische Reflexion des Verlaufs der Unterrichtsreihe zum Thema „Propheten“ in Bezug auf das didaktische Modell der Elementarisierung
- 9.2.1 Erste Stunde: Eine Rede an die Menschheit
- 9.2.2 Zweite und dritte Stunde: Von der Rede zu den Prophetenworten zu eigenen Bildern
- 9.2.3 Vierte Stunde: Fortsetzung
- 9.2.4 Fünfte Stunde: Was Propheten tun
- 9.2.5 Sechste und siebte Stunde: Collagen und Sachhintergründe zu den Propheten
- 9.2.6 Achte und Neunte Stunde: Der Prophet Amos – unsere eigenen Prophetenbilder
- 9.2.7 Zehnte Stunde: Abschluss und Rückblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Examensarbeit befasst sich mit dem Konzept der lebensgeschichtlichen Elementarisierung im Religionsunterricht der Grundschule. Das Ziel ist es, das didaktische Modell der Elementarisierung nach Nipkow und Schweitzer zu erläutern und seine Relevanz für die Berücksichtigung entwicklungspsychologischer Aspekte im Unterricht aufzuzeigen.
- Das didaktische Modell der Elementarisierung
- Die Bedeutung der Entwicklungspsychologie im Religionsunterricht
- Die Integration von lebensgeschichtlichen Aspekten in die Unterrichtsplanung und -durchführung
- Die Anwendung des Modells in einer konkreten Unterrichtsreihe
- Die Reflexion der Relevanz des Modells für die Praxis des Religionsunterrichts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema und den Fokus der Arbeit definiert. Anschließend werden wichtige Begriffe wie Lebensgeschichte, religiöse Entwicklung und Elementarisierung im zweiten Kapitel erläutert. Kapitel 3 widmet sich dem Verhältnis zwischen religiöser Entwicklung und religiöser Erziehung, wobei die Bedeutung der Berücksichtigung der religiösen Entwicklung für die Erziehung hervorgehoben wird.
Kapitel 4 klärt Unterschiede zwischen Elementartheologie, Elementarisierung und Korrelationsdidaktik. In Kapitel 5 wird die geschichtliche Entwicklung des Verständnisses von Elementarisierung nachgezeichnet, sowohl im allgemeinen pädagogischen als auch im religionsdidaktischen Kontext. Kapitel 6 beleuchtet unterschiedliche didaktische Ansätze, in denen Elementarisierung eine Rolle spielt, darunter die bibelorientierte Didaktik, die erfahrungsorientierte Symboldidaktik und die subjektivitätstheoretische, entwicklungsadäquate Religionsdidaktik.
Das 7. Kapitel widmet sich dem Tübinger Modell der Elementarisierung nach Nipkow und Schweitzer. Hier werden die Entstehung des Konzepts, seine Terminologie und seine Auswirkungen auf die Unterrichtsplanung und -durchführung detailliert dargestellt. Kapitel 8 beleuchtet die besondere Bedeutung der Entwicklungspsychologie im Tübinger Elementarisierungsansatz, indem es die lebensgeschichtliche Dimension der Elementarisierung in den Vordergrund stellt.
In Kapitel 9 wird die Praxis der Elementarisierung anhand einer konkreten Unterrichtsreihe über Propheten nach Rainer Oberthür demonstriert. Hier werden die einzelnen Stunden der Reihe im Schema der Elementarisierung analysiert und die didaktische Reflexion des Verlaufs der Unterrichtsreihe im Hinblick auf das Modell der Elementarisierung dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Schlüsselbegriffe Lebensgeschichtliche Elementarisierung, Religionsunterricht, Grundschule, didaktisches Modell, Entwicklungspsychologie, Unterrichtsplanung, Unterrichtsdurchführung und Praxisbeispiele.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Tübinger Modell der Elementarisierung?
Es ist ein didaktisches Modell von Nipkow und Schweitzer für den Religionsunterricht, das die Sachseite (Theologie) und die Schülerseite (Lebensgeschichte/Entwicklung) gleichwertig berücksichtigt.
Was bedeutet "lebensgeschichtliche Elementarisierung"?
Dies bedeutet, dass religiöse Inhalte so aufbereitet werden, dass sie an die spezifische Entwicklungsphase und die individuellen Erfahrungen der Schüler anknüpfen.
Welche fünf Dimensionen hat die didaktische Analyse im Modell?
Die Dimensionen sind: elementare Strukturen, elementare Erfahrungen, elementare Zugänge, elementare Wahrheiten und elementare Lernwege.
Warum ist Entwicklungspsychologie im Religionsunterricht wichtig?
Weil Kinder in verschiedenen Altersstufen unterschiedliche Gottesbilder und moralische Vorstellungen haben; der Unterricht muss diese religiöse Entwicklung berücksichtigen, um wirksam zu sein.
Wie wird das Modell in der Praxis angewendet?
In der Arbeit wird dies exemplarisch an einer Unterrichtsreihe über Propheten gezeigt, bei der biblische Texte mit den Lebensfragen der Grundschüler verknüpft werden.
- Quote paper
- Katja Janßen (Author), 2001, Lebensgeschichtliche Elementarisierung im Religionsunterricht der Grundschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/25611