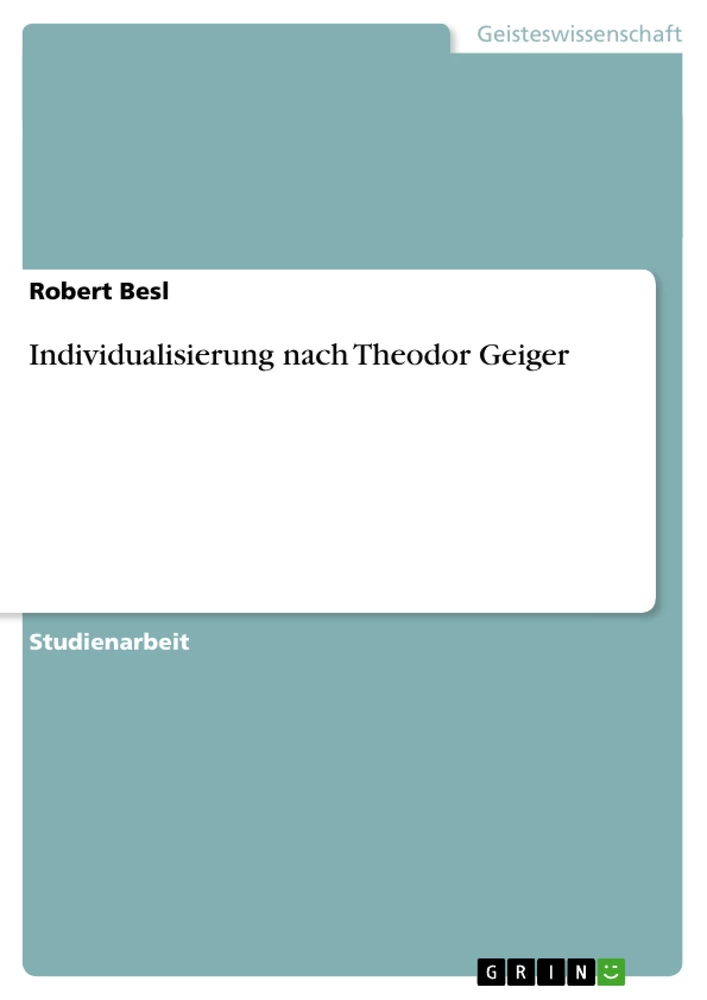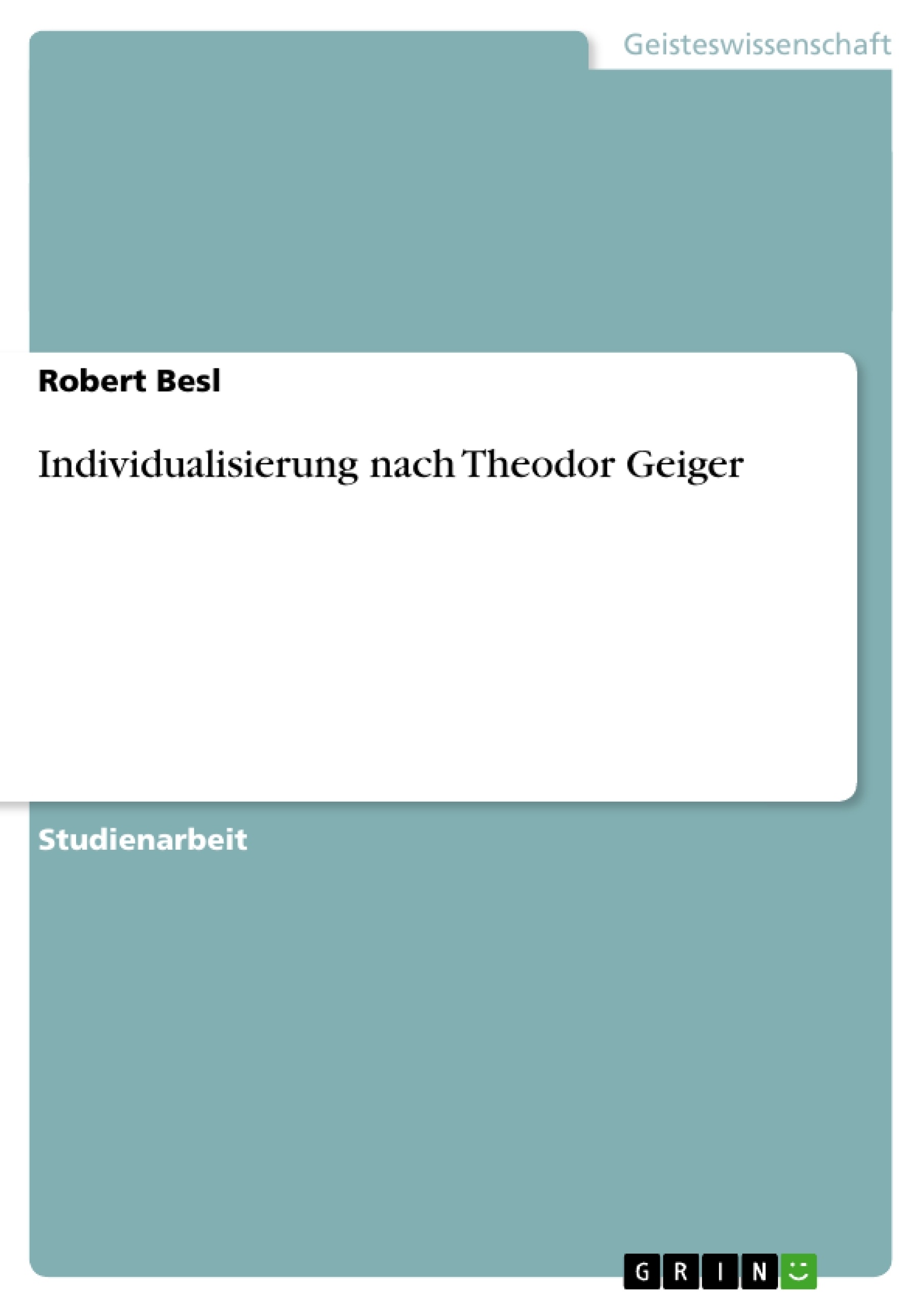Theodor Julius Geiger (9.11.1891 – 16.6.1952 analysiert in seinem erst im Jahre 1964 erschienenen Werk „Demokratie ohne Dogma. Die Gesellschaft zwischen Pathos und Nüchternheit“ die deutsche Nachkriegsgesellschaft. Er geht insbesondere auf die entstandenen Gegensätze zwischen der Individualisierung des Menschen im Privatleben auf der einen sowie dem zunehmend anonymisierten Dasein im gesellschaftlichen Dasein auf der anderen Seite ein. Im Teilabschnitt „Societas hominis sapientis“ (S. 115-136) stellt Geiger die sittlich-moralische Entwicklung des Menschen als die Ursache für die wahrgenommenen Missstände und vermeintlichen Fehlentwicklungen der modernen Gesellschaft heraus.
Obwohl sich Geigers Ausführungen in „Demokratie ohne Dogma“ auf die deutsche Gesellschaft der Nachkriegszeit beziehen, haben seine grundlegenden Gedanken nichts von ihrer Brisanz und Aussagekraft verloren. Die seit Jahren sinkende Beteilung an politischen Wahlen, der immer wieder aktuelle Diskurs um die ökonomische Effizienz des hohen Regulierungsgrades flächendeckender Tarifverträge sowie der zunehmend geringere gesellschaftliche wie politische Einfluss der Amtskirchen geben hinreichend Anlass, sein Werk fast 40 Jahre nach der Ersterscheinung nochmals zu analysieren. Theodor Geigers Darstellung des Individuums, das befreit vom Ständezwang des Mittelalters und den oftmals inhumanen Arbeits- und Lebensbedingungen der Industrialisierung seinen Platz in einer Gesellschaft sucht, die scheinbar alle Möglichkeiten eröffnet, aber letztlich nur wenig verbindliche Orientierung zu geben vermag, ist im heutigen Zeitalter der Globalisierung aktueller denn je. Eine Epoche, die dem Interessierten die Zugehörigkeit zu fast jeder denkbaren Religionsgemeinschaft erlaubt, die dem Arbeitnehmer soviel Freizeit wie niemals zuvor ermöglicht und die trotz extremistischer Minderheiten weltweit so frei von [politischen] Ideologiekämpfen ist wie noch keine Epoche davor, muss den Menschen fast zwangsläufig überfordern.
Theodor Geiger gibt Denkanstösse, wie der sogenannte „moderne“ Mensch angesichts aller dieser genannten sozio-psychologischen Herausforderungen und Fragestellungen als Individuum, als „Einer“ bestehen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aktualität und Problemstellung des Themas
- Zielsetzung der Arbeit
- Aufbau und methodisches Vorgehen
- Demokratie ohne Dogma
- Die anonyme Massengesellschaft
- Societas hominis sapientis
- Über den Entwicklungsstand des Menschen
- Über die Erhöhung des Menschen
- Über das Christentum und die Nächstenliebe
- Ausblick und kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Theodor Geigers Werk „Demokratie ohne Dogma“ im Kontext der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Sie untersucht, wie Geiger den Wandel der Gesellschaft und die Stellung des Individuums darin beschreibt. Ein Schwerpunkt liegt auf Geigers Konzept der „Erhöhung des Menschen“ als Antwort auf die Diskrepanz zwischen dem Entwicklungsstand des Individuums und den Anforderungen der modernen Gesellschaft.
- Die anonyme Massengesellschaft und die Herausforderungen für das Individuum
- Geigers Konzept der „Societas hominis sapientis“ und die moralisch-sittliche Entwicklung des Menschen
- Das Spannungsfeld zwischen Individualisierung im Privatleben und Anonymität im öffentlichen Raum
- Die Rolle der Demokratie und die Teilhabe des Individuums
- Kritik und Würdigung von Geigers Analyse der Nachkriegsgesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein, indem sie die Aktualität und Problemstellung von Geigers Werk „Demokratie ohne Dogma“ im Kontext der deutschen Nachkriegsgesellschaft und darüber hinaus beleuchtet. Sie erläutert die Zielsetzung der Arbeit, nämlich Geigers Sicht des Menschen in einer sich radikal verändernden Gesellschaft zu analysieren, und beschreibt den Aufbau sowie die methodische Vorgehensweise.
Demokratie ohne Dogma: Dieses Kapitel analysiert Geigers Werk "Demokratie ohne Dogma". Es untersucht zunächst den Begriff der „anonymen Massengesellschaft“, in der das Individuum in Wirtschaft und Politik gleichermaßen durch anonyme Marktkräfte und bürokratische Strukturen entmündigt wird. Geiger zeigt auf, wie die Taylorisierung der Arbeit den Menschen vom Sinn seiner Tätigkeit entfremdet. Im zweiten Teil, "Societas hominis sapientis", skizziert Geiger einen Weg zur „Erhöhung des Menschen“ durch Intellektualisierung, um die Herausforderungen der modernen Gesellschaft zu bewältigen. Geiger thematisiert hierbei den moralischen Entwicklungsstand des Menschen und die Rolle des Christentums und der Nächstenliebe.
Schlüsselwörter
Theodor Geiger, Demokratie ohne Dogma, Anonyme Massengesellschaft, Individualisierung, Societas hominis sapientis, Erhöhung des Menschen, Nachkriegsgesellschaft, Moral, Intellektualisierung, ökonomische und politische Teilhabe.
Häufig gestellte Fragen zu Theodor Geigers "Demokratie ohne Dogma"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Theodor Geigers Werk "Demokratie ohne Dogma" und untersucht, wie Geiger den gesellschaftlichen Wandel und die Stellung des Individuums in der deutschen Nachkriegsgesellschaft beschreibt. Ein besonderer Fokus liegt auf Geigers Konzept der "Erhöhung des Menschen" als Antwort auf die Diskrepanz zwischen individuellem Entwicklungsstand und den Anforderungen der modernen Gesellschaft. Die Analyse umfasst die anonyme Massengesellschaft, Geigers Konzept der "Societas hominis sapientis", das Spannungsfeld zwischen Individualisierung und Anonymität, die Rolle der Demokratie und die Teilhabe des Individuums sowie eine kritische Würdigung von Geigers Analyse.
Welche Themen werden in Geigers "Demokratie ohne Dogma" behandelt?
Geiger behandelt die Herausforderungen des Individuums in der anonymen Massengesellschaft, geprägt von anonymen Marktkräften und bürokratischen Strukturen. Er thematisiert die Entfremdung des Menschen von seiner Arbeit durch die Taylorisierung und skizziert in seinem Konzept der "Societas hominis sapientis" einen Weg zur "Erhöhung des Menschen" durch Intellektualisierung, um die Herausforderungen der modernen Gesellschaft zu bewältigen. Die Rolle von Moral, Christentum und Nächstenliebe werden ebenfalls diskutiert.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, die die Aktualität und Problemstellung des Themas, die Zielsetzung und die Methodik erläutert. Der Hauptteil analysiert Geigers "Demokratie ohne Dogma", wobei insbesondere die anonyme Massengesellschaft und das Konzept der "Societas hominis sapientis" im Detail betrachtet werden. Die Arbeit schließt mit einem Ausblick und einer kritischen Würdigung.
Welche Schlüsselkonzepte werden in der Analyse verwendet?
Schlüsselkonzepte sind die anonyme Massengesellschaft, Individualisierung, Societas hominis sapientis, die Erhöhung des Menschen, die ökonomische und politische Teilhabe des Individuums sowie der moralische Entwicklungsstand des Menschen in der Nachkriegsgesellschaft.
Was ist Geigers Konzept der "Societas hominis sapientis"?
Geigers "Societas hominis sapientis" beschreibt einen Weg zur "Erhöhung des Menschen", indem er die Intellektualisierung als Mittel zur Bewältigung der Herausforderungen der modernen Gesellschaft sieht. Es geht darum, den moralischen Entwicklungsstand des Menschen zu verbessern und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.
Welche Bedeutung hat die "anonyme Massengesellschaft" in Geigers Werk?
Die "anonyme Massengesellschaft" beschreibt für Geiger eine Gesellschaft, in der das Individuum in Wirtschaft und Politik durch anonyme Marktkräfte und bürokratische Strukturen entmündigt wird. Die Taylorisierung der Arbeit führt zur Entfremdung des Menschen von seiner Tätigkeit und stellt eine zentrale Herausforderung für das Individuum dar.
Wie wird Geigers Werk kritisch gewürdigt?
Die Arbeit enthält eine kritische Würdigung von Geigers Analyse der Nachkriegsgesellschaft. Die genaue Natur dieser Kritik wird im Text detailliert dargelegt, jedoch ist sie in dieser Zusammenfassung nicht explizit ausgeführt.
- Quote paper
- Robert Besl (Author), 2004, Individualisierung nach Theodor Geiger, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/25374