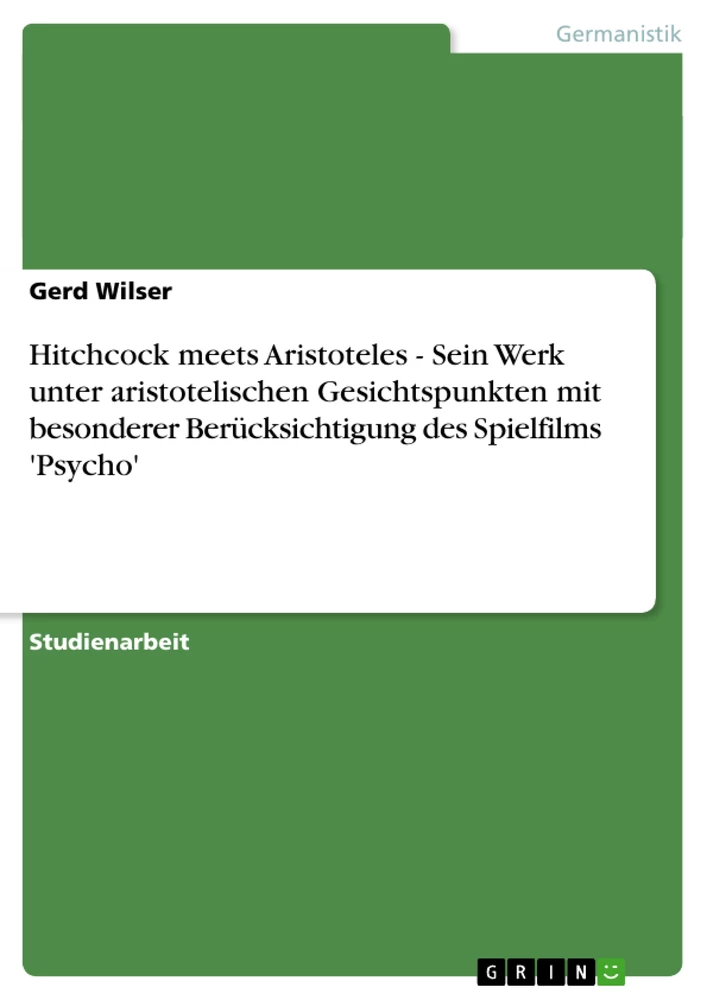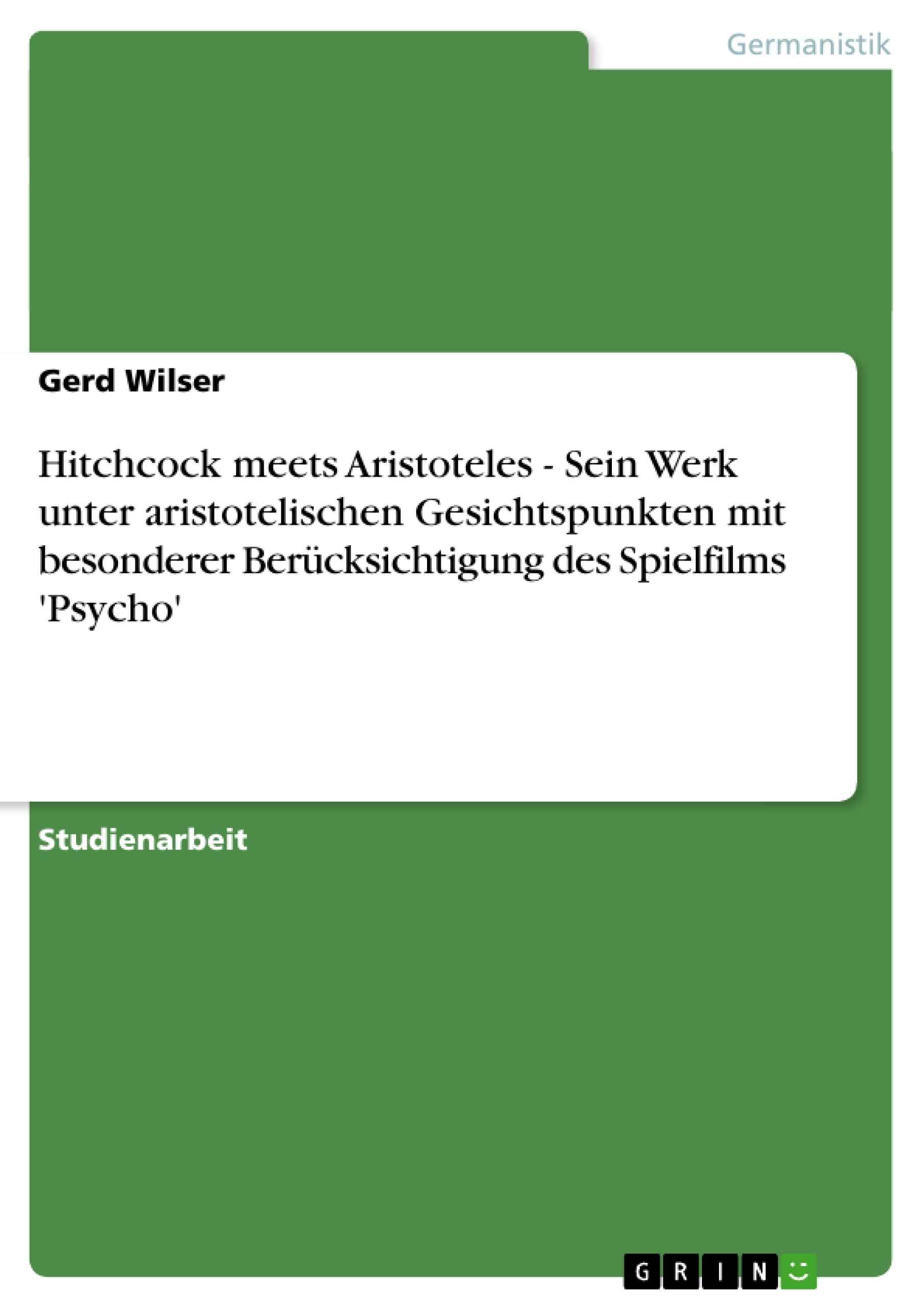Zu Anfang stehen die Fragen: Wie hat Alfred Hitchcock Gewalt in (ästhetische) Filmform verwandelt? Was lösen diese Bilder aus? Und was waren seine Ziele? Dabei tauchen überraschende Parallelen auf zwischen dem am häufigsten kopierten Filmregisseur des 20. Jahrhunderts und dem großen Lehrmeister der Dramaturgie, Aristoteles. Am Ende schälen sich Hitchcocks grundlegende „Rezepte“ heraus, die zu einem Großteil schon in der Antike "funktionierten". Laut Aristoteles ist die Tragödie "Nachahmung einer edlen und abgeschlossenen Handlung von einer bestimmten Grosse in gewählter Rede, derart, dass jede Form solcher Rede in gesonderten Teilen erscheint und dass gehandelt und nicht berichtet wird und dass mit Hilfe von Mitleid und Furcht eine Reinigung von eben derartigen Affekten bewerkstelligt wird".(1) Und Hitchcock äußert in einem Interview: "Ich muss die Leute mit wohltätigen Schocks füttern. Unsere Zivilisation ist eine protektive Zivilisation; sie schirmt uns behutsam vor allem ab, mit dem Resultat, dass wir nicht mehr in der Lage sind, intuitiv eine Gänsehaut zu bekommen. Die einzige Methode, dieser allgemeinen Betäubung entgegenzuwirken und unser moralisches Gleichgewicht wieder zu erwecken, ist die künstliche Verabreichung von Schocks. Und am besten funktioniert das mit einem Film."(2) Beide beabsichtigen folglich in einer bestimmten Art und Weise auf die Emotionen des Zuschauers einzuwirken: Aristoteles nennt es "Mitleid und Furcht" und Hitchcock "Schock". Und beide tun dies mit einem bestimmten Ziel: Aristoteles nennt es "Reinigung" und Hitchcock "Moralisches Gleichgewicht". Aufzuzeigen wie eng Hitchcock den von Aristoteles in seiner "Poetik" aufgestellten Forderungen folgt, wird Aufgabe dieser Arbeit sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Aristoteles
- Die aristotelische Poetik
- Lessings Aristoteles-Kommentar
- "Aristotelischer Forderungen-Katalog"
- Hitchcock
- Einführung
- Analyse seines Werks nach "Aristotelischem Forderungen-Katalog"
- "Erfundene Geschichte"
- "Form"
- "Lerneffekt"
- "Inhalt"
- "Aufbau"
- "Charaktere"
- "Naheverhältnisse"
- Der Film "Psycho"
- "Psycho" als Beispiel eines typischen Hitchcock-Films im Sinne des "Aristotelischen Forderungen-Katalogs"
- Detailanalyse der "Duschszene"
- Resümee
- Hitchcock als moderner Aristoteliker
- Weiterführende Fragestellung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Parallelen zwischen dem Werk von Alfred Hitchcock und den Prinzipien der aristotelischen Poetik, insbesondere im Hinblick auf den Film "Psycho". Ziel ist es, aufzuzeigen, wie Hitchcock, einer der einflussreichsten Filmregisseure des 20. Jahrhunderts, die von Aristoteles formulierten Dramaturgie-Grundlagen in seinen Filmen umsetzt.
- Hitchcocks "Rezepte" im Vergleich zu Aristoteles' Prinzipien
- Die Anwendung der aristotelischen Poetik auf moderne Filmkunst
- Analyse der Wirkung von Gewalt und Schock in Hitchcocks Filmen
- Die Bedeutung der "Duschszene" in "Psycho" im Kontext der aristotelischen Poetik
- Hitchcocks Einfluss auf die Filmgeschichte und seine Relevanz für die heutige Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einführung stellt die Leitfragen der Arbeit vor und beleuchtet die überraschenden Parallelen zwischen Hitchcock und Aristoteles. Kapitel 2 widmet sich Aristoteles' Poetik, insbesondere seinen zentralen Aussagen zur Tragödie und deren Aufbau.
Kapitel 3 befasst sich mit Alfred Hitchcock und analysiert sein Werk anhand des "Aristotelischen Forderungen-Katalogs". Es werden verschiedene Aspekte wie die erfundene Geschichte, die Form, der Lerneffekt, der Inhalt, der Aufbau, die Charaktere und die "Naheverhältnisse" behandelt.
Kapitel 4 untersucht den Film "Psycho" als Beispiel eines typischen Hitchcock-Films im Sinne des "Aristotelischen Forderungen-Katalogs". Es wird eine detaillierte Analyse der "Duschszene" im Hinblick auf ihre dramaturgische Funktion und ihre Wirkung auf den Zuschauer durchgeführt.
Schlüsselwörter
Aristotelische Poetik, Hitchcock, Psycho, Tragödie, Katharsis, Schock, Gewalt, Dramaturgie, Filmkunst, "Duschszene", "Naheverhältnisse", Lerneffekt, Charaktere, Aufbau, "Peripetie", "Entdeckung".
- Arbeit zitieren
- Gerd Wilser (Autor:in), 1998, Hitchcock meets Aristoteles - Sein Werk unter aristotelischen Gesichtspunkten mit besonderer Berücksichtigung des Spielfilms 'Psycho', München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/24716