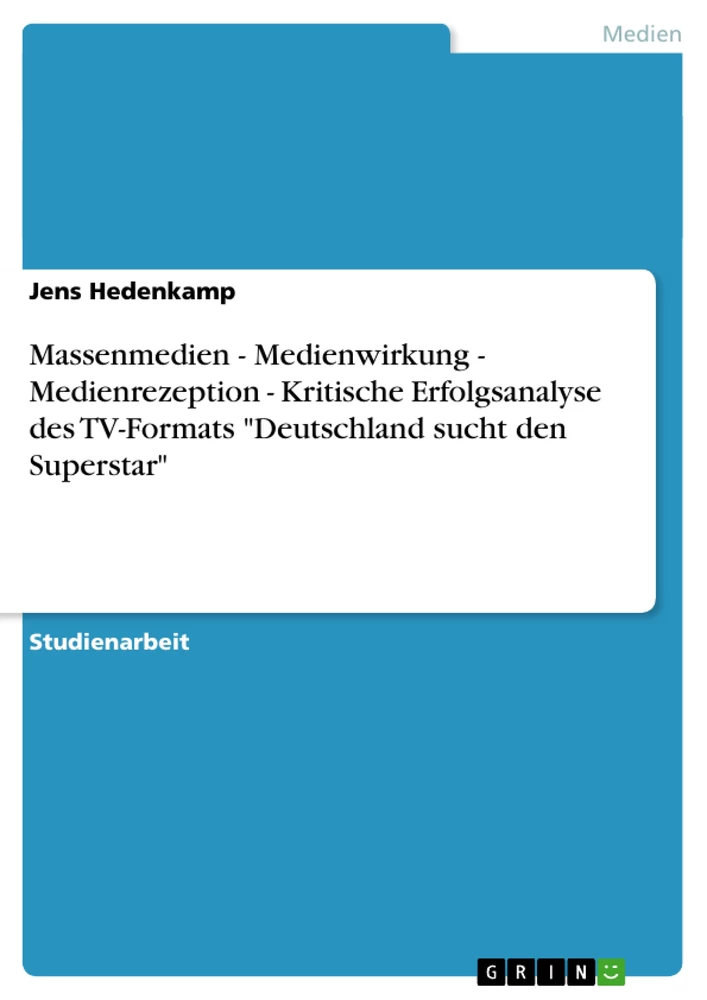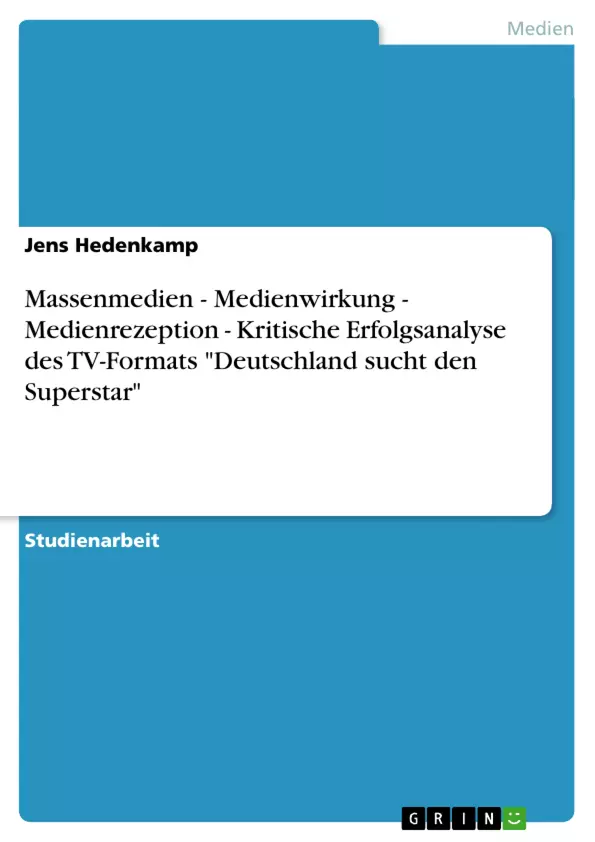Was macht den medialen und kommerziellen Erfolg des TV-Formats „Deutschland sucht den Superstar“ aus? Dieser Frage werde ich im Folgenden aus kommunikationswissenschaftlicher Sichtweise nachgehen. „Kommunikationswissenschaft, die sich mit Fernsehunterhaltung beschäftigt, [...] informiert über psychische, soziologische und sozialpsychische Aspekte von Unterhaltung (vgl. Dehm 1984a: 32-34) und zugrundeliegende Bedürfnisse; sie ermittelt Daten zur qualitativen und quantitativen Nutzung intendierter und nicht-intendierter Fernsehunterhaltung (Wirkungsforschung, Uses-and-Gratification-Approach) etc. Folglich kann sie Anlaß geben zu organisatorischen Veränderungen, sie kann die theoretische Basis von Konzepten bieten, die neue Zielgruppen ansprechen, sie kann Wissen bereitstellen, aus dem jeder Unterhaltungsjournalist Ideen und Anregungen schöpfen kann, sie kann Alternativen zu herkömmlichen Programminhalten anbieten.“ (Dröge 2001: 101-102) Der wohl wichtigste Punkt für die Entwicklung neuer Fernsehkonzepte ist der Faktor Wirtschaftlichkeit, der mit dem Faktor Einschaltquote gleichzusetzen ist, denn die Quote bestimmt den Preis für Werbezeiten. Die Weltwirtschaft befindet sich zur Zeit jedoch in einer konjunkturellen Krise. Drohende Kriege, Terrorismus, Steuererhöhungen, Einführung der neuen Währung „Euro“ verunsichern und lähmen die Konsumenten zunehmend. Hinzu kommt, daß es die Bundesrepublik Deutschland bis heute nicht geschafft hat, die Kosten des Aufbaus Ostdeutschlands nach dem Fall der Mauer 1989 zu kompensieren. Unternehmen, die in den letzten Jahren noch in Werbung investiert haben, befinden sich nun selber in der Krise. In der Regel werden in solchen Fällen zuerst die Werbeetats gekürzt. Besonders betroffen von dieser Situation sind die Wirtschaftszweige, die sich durch Werbung finanzieren, was sich an der stark angestiegenen Zahl von Entlassungen in diesem Sektor erkennen läßt. Das ist u.a. das private Fernsehen. Da, bezogen auf Deutschland, weder Wirtschaftsexperten noch die Bundesregierung für die nächsten Jahre einen wesentlichen Aufschwung prognostizieren, müssen von werbeeinnahmenabhängigen Unternehmen neue Wege zur Finanzierung gefunden werden. Dabei kommt dem System Fernsehunterhaltung als Subsystem des Rundfunks in Verbindung mit der Theorie des Uses-and-Gratification-Approach eine wichtige Rolle zu (vgl. Dröge 2001: 97, 98).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Geschichte der Castingshows in Deutschland
- 2.1 Big Brother
- 2.2 Popstars
- 2.3 Weitere Sendungen
- 3. Das Konzept zu „Deutschland sucht den Superstar“
- 3.1 Casting
- 3.2 Jury
- 3.3 Finalrunde
- 3.4 Vermarktung
- 3.4.1 Medien und PR
- 3.5 Bertelsmann
- 3.6 Zielgruppe
- 4. Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den medialen und kommerziellen Erfolg des TV-Formats „Deutschland sucht den Superstar“ aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive. Sie analysiert die Faktoren, die zu seinem Erfolg beigetragen haben, unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und medienwissenschaftlicher Aspekte.
- Analyse des Erfolgsmodells von Castingshows
- Die Rolle des Zuschauers und die Interaktivität des Formats
- Der Einfluss von Medienkonzentration und Vermarktungsstrategien
- Wirtschaftliche Faktoren und die Abhängigkeit von Werbeeinnahmen
- Der Uses-and-Gratification-Ansatz im Kontext von Fernsehunterhaltung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Gründen für den Erfolg von „Deutschland sucht den Superstar“ vor und skizziert den kommunikationswissenschaftlichen Ansatz der Arbeit. Sie betont die Bedeutung von Wirtschaftlichkeit und Einschaltquoten im Kontext der aktuellen Wirtschaftslage und verweist auf den Uses-and-Gratification-Approach als relevanten theoretischen Rahmen. Die Hybridisierung von Medien und die Monopolisierung von Mediengewalt werden als wichtige Aspekte für den Erfolg von solchen Fernsehformaten identifiziert.
2. Geschichte von Castingshows in Deutschland: Dieses Kapitel zeichnet die Entwicklung von Castingshows in Deutschland nach, beginnend mit „Big Brother“ als einem frühen Beispiel für die aktive Zuschauerbeteiligung. Es beschreibt die Konzepte von „Big Brother“ und „Popstars“ und analysiert deren Einfluss auf nachfolgende Formate. Die Kapitel betont die zunehmende Einbindung des Zuschauers durch gebührenpflichtige Telefonhotlines als neuen Weg zur Finanzierung und die emotionale Inszenierung der Sendungen als Erfolgsfaktor. Der unterschiedliche Erfolg verschiedener Formate wird ebenfalls beleuchtet, wobei der Fokus auf den durchschlagenden Erfolg von "Popstars" im Vergleich zu anderen, weniger erfolgreichen Formaten liegt.
3. Das Konzept zu „Deutschland sucht den Superstar“: Dieses Kapitel analysiert das Konzept von „Deutschland sucht den Superstar“, das auf der aktiven Zuschauerbeteiligung durch Telefonvoting basiert. Es beschreibt den Ablauf des Castings, die Zusammensetzung der Jury und die Vermarktungsstrategien, die zum Erfolg der Show beigetragen haben. Der Einfluss von Bertelsmann und die Bedeutung der multimedialen Vermarktung (Internet, Fanzeitschrift etc.) werden hervorgehoben. Die Beschreibung von RTLs Marketingstrategien und die Rolle der Jury, insbesondere die von Thomas Stein als Vertreter der BMG, unterstreichen die enge Verknüpfung zwischen Fernsehproduktion, Musikbranche und kommerziellem Erfolg.
Schlüsselwörter
Castingshow, „Deutschland sucht den Superstar“, Medienwirkung, Medienrezeption, Zuschauerbeteiligung, Uses-and-Gratification-Approach, Medienkonzentration, Vermarktungsstrategien, Wirtschaftlichkeit, Fernsehunterhaltung, RTL, Bertelsmann, Big Brother, Popstars.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Deutschland sucht den Superstar" - Eine Medienanalyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den medialen und kommerziellen Erfolg der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht. Sie analysiert die Faktoren, die zu ihrem Erfolg beigetragen haben, unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und medienwissenschaftlicher Aspekte.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Erfolgsfaktoren von Castingshows im Allgemeinen und von "Deutschland sucht den Superstar" im Besonderen. Dies beinhaltet die Analyse des Erfolgsmodells, die Rolle des Zuschauers und die Interaktivität des Formats, den Einfluss von Medienkonzentration und Vermarktungsstrategien, wirtschaftliche Faktoren und die Abhängigkeit von Werbeeinnahmen sowie den Uses-and-Gratification-Ansatz im Kontext von Fernsehunterhaltung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zur Geschichte der Castingshows in Deutschland (mit Fokus auf "Big Brother" und "Popstars"), ein Kapitel zur Konzeption von "Deutschland sucht den Superstar" (inkl. Casting, Jury, Vermarktung und der Rolle von Bertelsmann) und eine Schlussbetrachtung.
Wie wird der Erfolg von "Deutschland sucht den Superstar" erklärt?
Der Erfolg wird durch verschiedene Faktoren erklärt: die aktive Zuschauerbeteiligung via Telefonvoting, die Zusammensetzung der Jury, die multimediale Vermarktung (Internet, Fanzeitschriften etc.), die enge Verknüpfung zwischen Fernsehproduktion, Musikbranche und kommerziellem Erfolg, sowie die gezielten Marketingstrategien von RTL. Die emotionale Inszenierung und die Hybridisierung von Medien spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
Welche Rolle spielt die Zuschauerbeteiligung?
Die Zuschauerbeteiligung ist ein zentraler Erfolgsfaktor. Die Arbeit betont die aktive Einbindung der Zuschauer durch gebührenpflichtige Telefonhotlines als Finanzierungsmodell und die Bedeutung der Interaktivität für den Erfolg des Formats. Der Uses-and-Gratification-Ansatz wird als theoretischer Rahmen genutzt, um die Motivation der Zuschauer zu verstehen.
Welche Rolle spielt Bertelsmann?
Bertelsmann spielt als Medienkonzern eine wichtige Rolle, da die Arbeit seinen Einfluss auf die Produktion und Vermarktung von "Deutschland sucht den Superstar" untersucht und die enge Verknüpfung zwischen dem Fernsehformat und der Musikbranche hervorhebt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Castingshow, „Deutschland sucht den Superstar“, Medienwirkung, Medienrezeption, Zuschauerbeteiligung, Uses-and-Gratification-Approach, Medienkonzentration, Vermarktungsstrategien, Wirtschaftlichkeit, Fernsehunterhaltung, RTL, Bertelsmann, Big Brother, Popstars.
Welche früheren Castingshows werden erwähnt und wie werden sie im Kontext von "DSDS" eingeordnet?
Die Arbeit vergleicht "Deutschland sucht den Superstar" mit früheren Castingshows wie "Big Brother" und "Popstars". Dabei wird der Einfluss dieser frühen Formate auf spätere Entwicklungen analysiert und der unterschiedliche Erfolg der verschiedenen Formate beleuchtet, insbesondere der durchschlagende Erfolg von "Popstars".
- Quote paper
- Jens Hedenkamp (Author), 2003, Massenmedien - Medienwirkung - Medienrezeption - Kritische Erfolgsanalyse des TV-Formats "Deutschland sucht den Superstar", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/24568