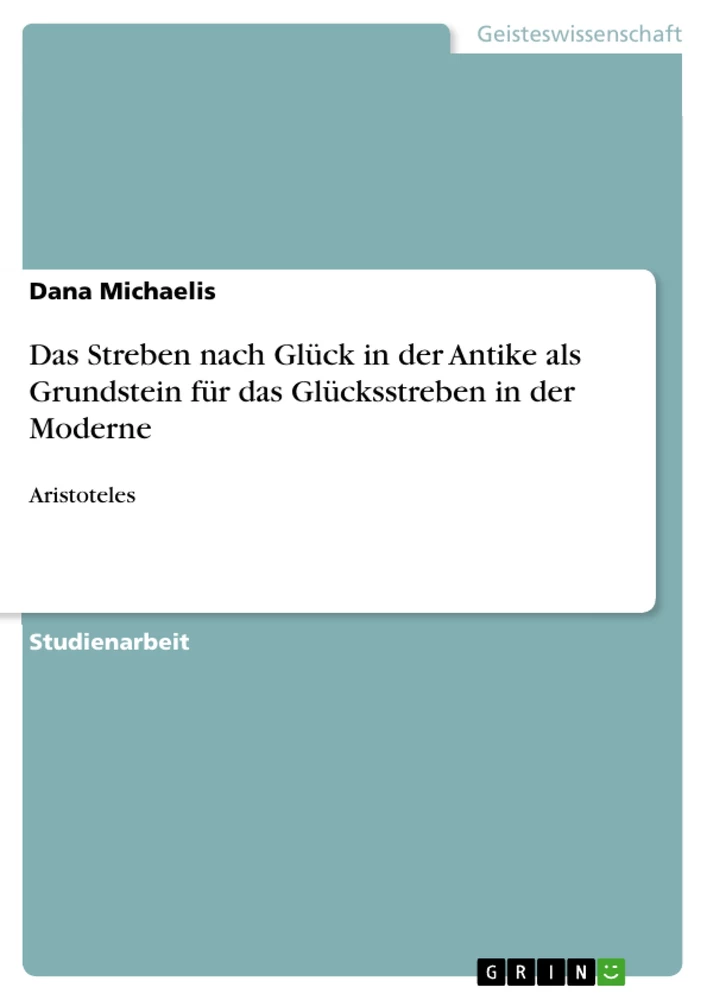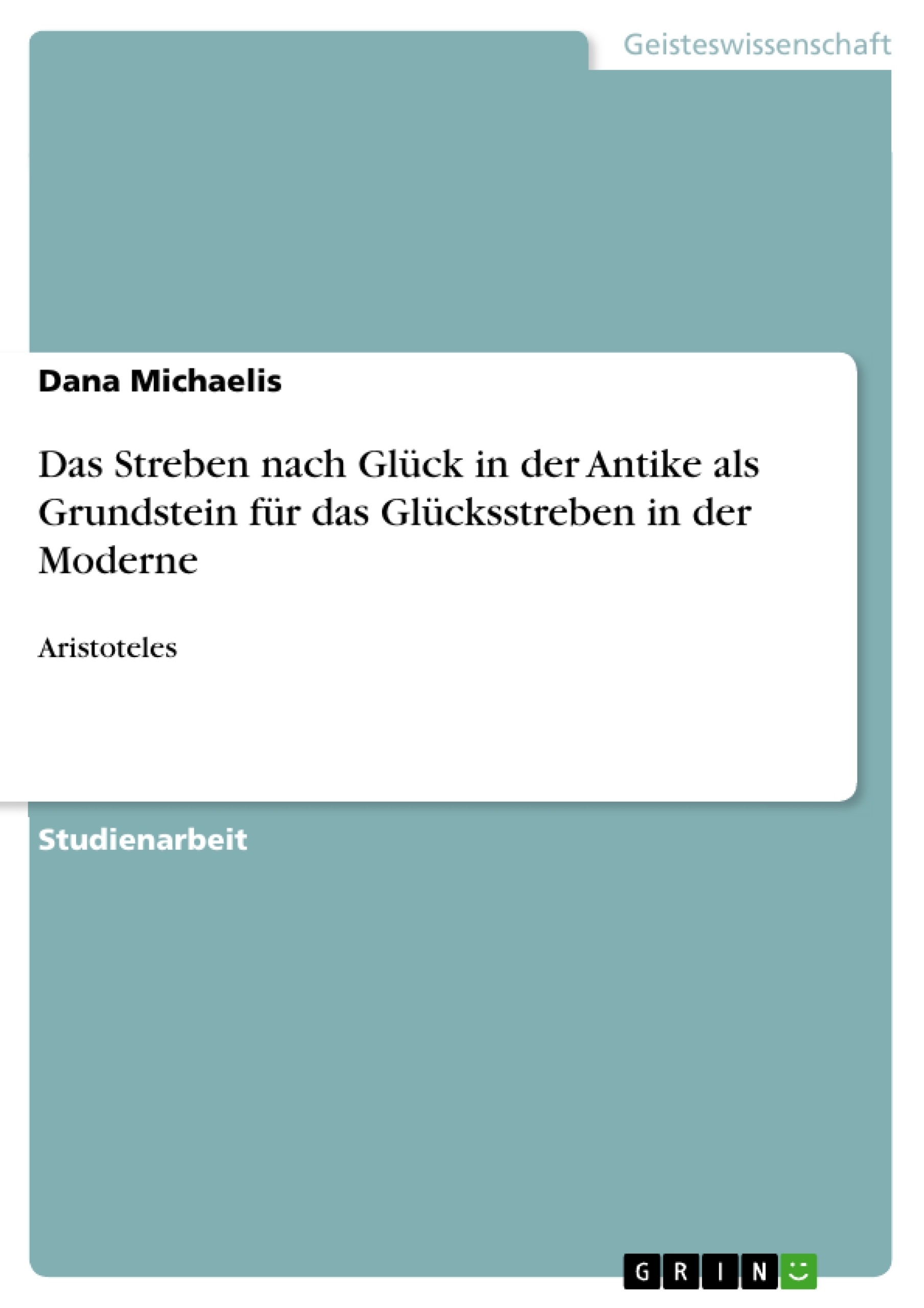Was genau ist überhaupt dieses „Glück“, wonach ein jeder Mensch sich sehnt? Die Frage nach dem Glück erstreckt sich über die 2500 Jahre alte Philosophiegeschichte.
Das Problem, mit dem ich mich in dieser Hausarbeit auseinander setzen werden, zielt auf die Aktualität der antiken Philosophie des Aristoteles ab. Dieser gibt einen Rahmen vor, an dem man sich orientieren kann, um Glück im Leben zu erfahren.
,,Sollte seine Erkenntnis nicht auch für das Leben eine große Bedeutung haben und uns helfen, gleich den Schützen, die ein festes Ziel haben, das Rechte besser zu treffen?" 1
Die heutige Erlebnisgesellschaft eröffnet eine Sphäre von Highlights. Das Erreichen dieser Höhepunkte ermöglicht ein Gefühl von Euphorie. Aber ist dieses Gefühl auch nach den antiken Auffassungen als Glück zu betiteln? Ist Glück also eine Aufeinanderfolge von Ereignissen, bei denen Glück nur eine Momenterscheinung ist“ Oder ist das Glück eine allgemeine Lebenseinstellung, die beeinflusst werden kann? Mit diesen beiden vermeintlich unterschiedlichen Vorstellungen von Glück werde ich mich in dieser Arbeit auseinander setzen und die Vorstellungen von Glück in der Antike der Moderne gegenüberstellen.
Ich werde mich dabei hauptsächlich auf das Werk von Aristoteles ,,Nikomachische Ethik" stützen. Daran anschließen wird sich eine kurze Ausführung wichtiger Aspekte der Werke von Wilhelm Schmid: ,,Philosophie der Lebenskunst", „Der philosophische Weg zum Glück. In: Psychologie Heute 11 (2000)“ und „Mit sich selbst befreundet sein“. Anhand seiner Auslegungen der modernen Glücksphilosophie werden Gemeinsamkeiten, aber auch Differenzen zur Auffassung in der Antike sichtbar.
Inhaltsverzeichnis:
1. Einleitung
2. Die Antike und das Glück
2.1 Glücksbegriffe und das Streben nach Glück in der Philosophie
2.2 Die Philosophen und das Glück
2.3 Glück als ein wählbares Gut
2.4 Glück als eine spezifische Tätigkeit
2.5 Das Glück und die Rolle von Gütern
2.6 Glück in der Gesellschaft
2.7 Glück als erlernbares Gut
2.8 Der Weg der Mitte
2.9 Glück als Lebenseinstellung
3. Die Moderne und das Glück
3.1 Glücksphilosophie der Moderne und der Sinn des Lebens
3.2 Zwei Aspekte der Ästhetik
3.3 Der Begriff der Heiterkeit
4. Schlussbetrachtung
Anhang:
- Literatur- und Quellenverzeichnis
Das Streben nach Glück in der Antike setzte den Grundstein für das Glücksstreben in der Moderne.
- Quote paper
- Dana Michaelis (Author), 2010, Das Streben nach Glück in der Antike als Grundstein für das Glücksstreben in der Moderne, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/233486