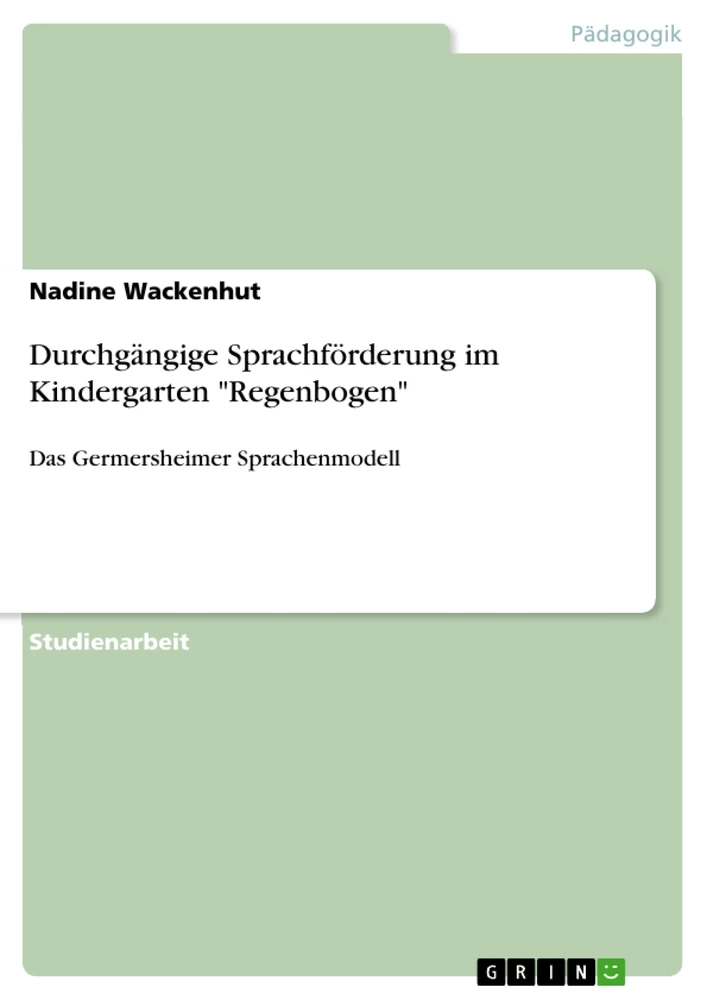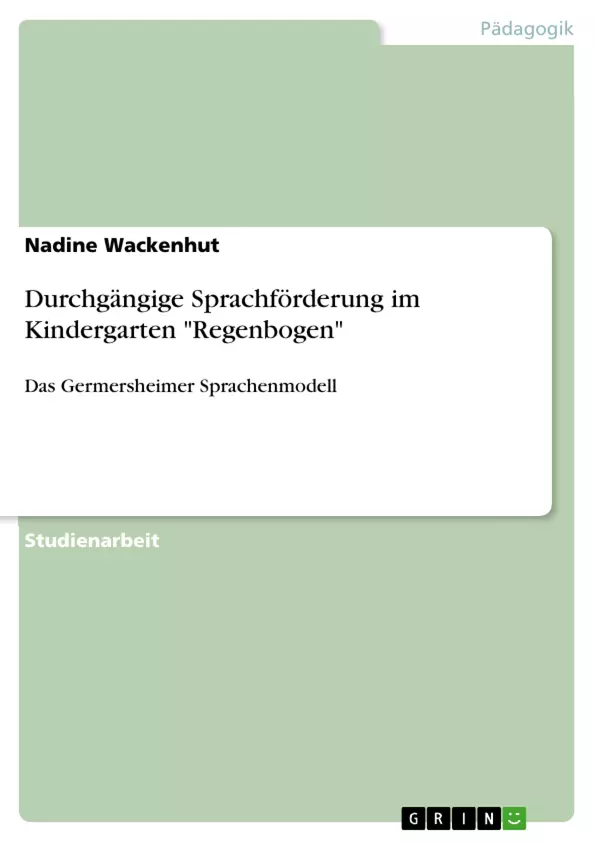Modellprojekt in einem multikulturellen Kindergarten in Germersheim (Rheinland-Pfalz) zur ganzheitlichen Sprachförderung bei Kindern im Alter von 4-6 Jahren.
Inhalt
1. Einleitung
2. Zur Entstehung des Projekts
3. Voraussetzungen
3.1 Räumliche Voraussetzungen
3.2 Personelle und Sprachliche Voraussetzungen
3.3 Zeitliche Voraussetzungen
4. Ziele und Prinzipien
5. Vorgehen/Arbeitsweise im Projekt
6. Durchgängige Sprachförderung
6.1 Modell
6.2 Sprachbeobachtung
6.3 Von den Beobachtungsergebnissen bis zu den Förderentscheidungen
6.4 Themen
7 Sprachförderung
7.1 Alltägliches sprachliches Handeln der Erzieherinnen
7.3 Integrierte Sprachförderung
7.4 Sprachförderung in Kleingruppen
8. Fazit
Quellenverzeichnis
- Arbeit zitieren
- Nadine Wackenhut (Autor:in), 2012, Durchgängige Sprachförderung im Kindergarten "Regenbogen", München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/233034