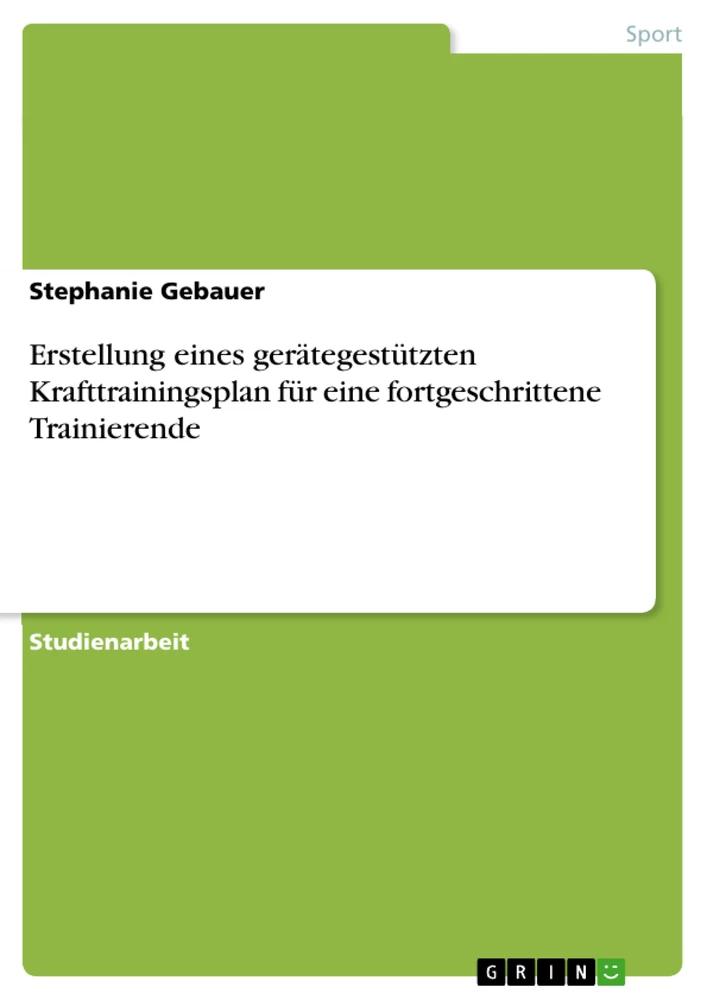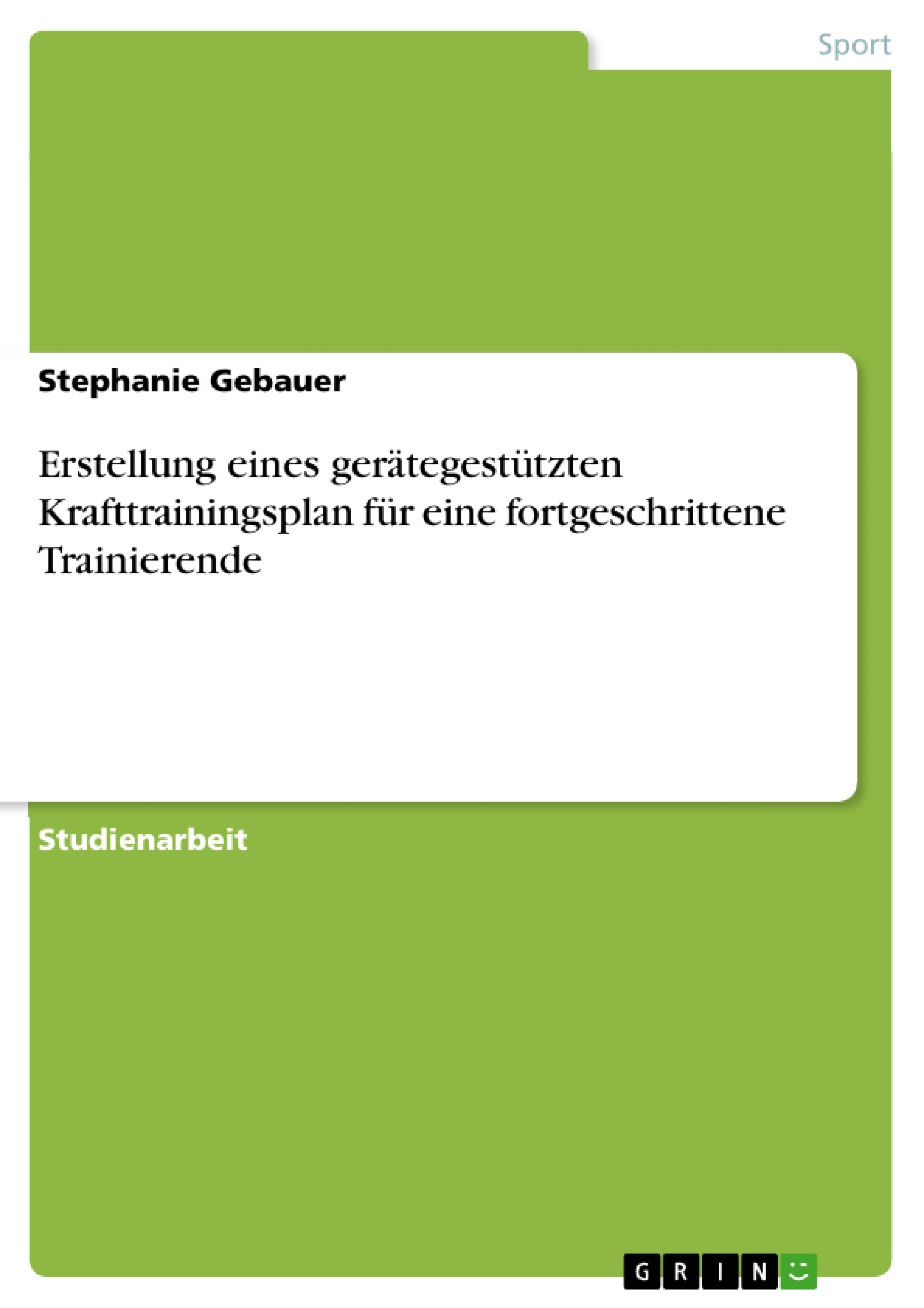In der Arbeit wird ein 7-monatiger Trainingsplan für ein gerätegestütztes Krafttraining für eine fortgeschrittene Trainierende erstellt. Die Trainingsplanerstellung erfolgt mittels einer Makro- und Mesozyklusplanung, bei der zusätzlich die einzelnen Trainingsübungen dargestellt werden. Neben der Darstellung der Makrozyklusplanung, wird dieser ausführlich erklärt.
Anschließend wird eine Übungsanalyse für die Übungen Ausfallschritt-Kniebeuge und Kabelrudern sitztend durchgeführt, in der der Bewegungsablauf und die primär beteiligten Muskeln der Übungen sowie die mechanische Belastung (äußere Drehmoment)bei den Übungen dargestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Diagnose
- 1.1 Allgemeine Daten
- 1.2 Anthropometrische Daten
- 1.3 Aktuelle subjektive Beschwerden oder Einschränkungen
- 1.4 Sportliche Aktivitäten
- 1.5 Trainingsmotive
- 1.6 Bewertung des Gesundheitszustandes und der Leistungsfähigkeit
- 2 Makrozyklusplanung
- 2.1 Makrozyklus in Tabellenform
- 2.2 Begründung der Makrozyklusdarstellung
- 3 Mesozyklusplanung
- 4 Übungsauswahl
- 5 Übungsanalyse
- 5.1 Ausfallschritt-Kniebeuge mit Kurzhanteln
- 5.2 Kabelrudern sitzend, enger neutraler V-Griff
- 6 Literaturverzeichnis
- 7 Tabellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert den Trainingszustand einer 21-jährigen Sportstudentin und entwickelt einen individuellen Trainingsplan. Ziel ist die Erstellung eines Makro- und Mesozyklusplans, der auf die Bedürfnisse und Ziele der Probandin abgestimmt ist, inklusive der Auswahl und Analyse geeigneter Übungen. Berücksichtigt werden dabei aktuelle Beschwerden, sportliche Vorerfahrungen und die Trainingsziele der Probandin.
- Analyse des aktuellen Trainings- und Gesundheitszustandes
- Entwicklung eines individuellen Makrozyklusplans
- Erstellung eines detaillierten Mesozyklusplans
- Auswahl und Analyse geeigneter Kraftübungen
- Berücksichtigung von Beschwerden und Zielen der Probandin
Zusammenfassung der Kapitel
1 Diagnose: Dieses Kapitel präsentiert eine umfassende Analyse des aktuellen Gesundheits- und Fitnesszustands der Probandin. Es werden allgemeine Daten wie Alter, Beruf und Geschlecht erfasst, gefolgt von anthropometrischen Daten wie Körpergröße, Gewicht, BMI, Blutdruck, Ruhepuls und Körperfettanteil. Besondere Aufmerksamkeit wird den subjektiven Beschwerden der Probandin im Lendenwirbelsäulenbereich gewidmet, sowie ihren sportlichen Aktivitäten und Trainingsmotiven (Muskelaufbau, Schmerzlinderung, Gewichtsabnahme). Die Auswertung der Daten liefert ein detailliertes Bild des Ausgangszustands und dient als Grundlage für die anschließende Trainingsplanung. Die Einordnung der Messergebnisse anhand von Tabellen (Blutdruck, Ruhepuls, BMI) ermöglicht eine fundierte Einschätzung des Gesundheitszustands und der Leistungsfähigkeit. Die Einschätzung des Körperfettanteils von 29% wird als Hinweis auf ein mögliches Handlungsbedürfnis interpretiert, den Wert langfristig zu senken.
Schlüsselwörter
Krafttraining, Makrozyklus, Mesozyklus, Übungsauswahl, Übungs-analyse, Gesundheitszustand, Leistungsfähigkeit, Muskelaufbau, Schmerzlinderung, Gewichtsabnahme, Anthropometrie, Blutdruck, Ruhepuls, Body-Mass-Index (BMI), Körperfettanteil.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Individueller Trainingsplan für eine Sportstudentin
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit erstellt einen individuellen Trainingsplan für eine 21-jährige Sportstudentin. Sie umfasst eine umfassende Diagnose des aktuellen Gesundheits- und Fitnesszustandes, die Entwicklung eines Makro- und Mesozyklusplans sowie die Auswahl und Analyse geeigneter Übungen. Berücksichtigt werden dabei die individuellen Bedürfnisse, Ziele und Beschwerden der Probandin.
Welche Bereiche werden in der Diagnose behandelt?
Die Diagnose beinhaltet allgemeine Daten (Alter, Beruf, Geschlecht), anthropometrische Daten (Körpergröße, Gewicht, BMI, Blutdruck, Ruhepuls, Körperfettanteil), aktuelle Beschwerden (insbesondere im Lendenwirbelsäulenbereich), sportliche Aktivitäten und Trainingsmotive (Muskelaufbau, Schmerzlinderung, Gewichtsabnahme). Die Messergebnisse werden anhand von Tabellen eingeordnet und der Gesundheitszustand sowie die Leistungsfähigkeit eingeschätzt.
Was ist der Fokus des Makro- und Mesozyklusplans?
Die Hausarbeit entwickelt einen individuellen Makro- und Mesozyklusplan, der auf die spezifischen Bedürfnisse und Ziele der Probandin abgestimmt ist. Dieser Plan dient als Grundlage für das langfristige Training und berücksichtigt die Ergebnisse der Diagnose.
Welche Übungen werden analysiert?
Die Hausarbeit analysiert unter anderem den Ausfallschritt-Kniebeuge mit Kurzhanteln und das Kabelrudern sitzend mit engem neutralen V-Griff. Die Analyse umfasst wahrscheinlich die Ausführung, die beteiligten Muskeln und die möglichen Vorteile und Risiken der Übungen.
Welche Ziele verfolgt die Probandin?
Die Probandin hat verschiedene Trainingsziele, darunter Muskelaufbau, Schmerzlinderung im Lendenwirbelsäulenbereich und Gewichtsabnahme. Der Trainingsplan berücksichtigt diese individuellen Ziele.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Krafttraining, Makrozyklus, Mesozyklus, Übungsauswahl, Übungs-analyse, Gesundheitszustand, Leistungsfähigkeit, Muskelaufbau, Schmerzlinderung, Gewichtsabnahme, Anthropometrie, Blutdruck, Ruhepuls, Body-Mass-Index (BMI), Körperfettanteil.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Diagnose, gefolgt von der Makro- und Mesozyklusplanung, der Übungsauswahl und -analyse, sowie einem Literatur- und Tabellenverzeichnis. Sie enthält außerdem eine Zusammenfassung der Kapitel und eine Beschreibung der Zielsetzung und Themenschwerpunkte.
Welche konkreten Ergebnisse liefert die Hausarbeit?
Die Hausarbeit liefert einen detaillierten individuellen Trainingsplan mit Makro- und Mesozyklus, der auf die spezifischen Bedürfnisse und Ziele der Probandin zugeschnitten ist, inklusive der Auswahl und Analyse geeigneter Kraftübungen. Zusätzlich wird der aktuelle Gesundheits- und Trainingszustand der Probandin umfassend analysiert.
- Arbeit zitieren
- Stephanie Gebauer (Autor:in), 2013, Erstellung eines gerätegestützten Krafttrainingsplan für eine fortgeschrittene Trainierende, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/232586