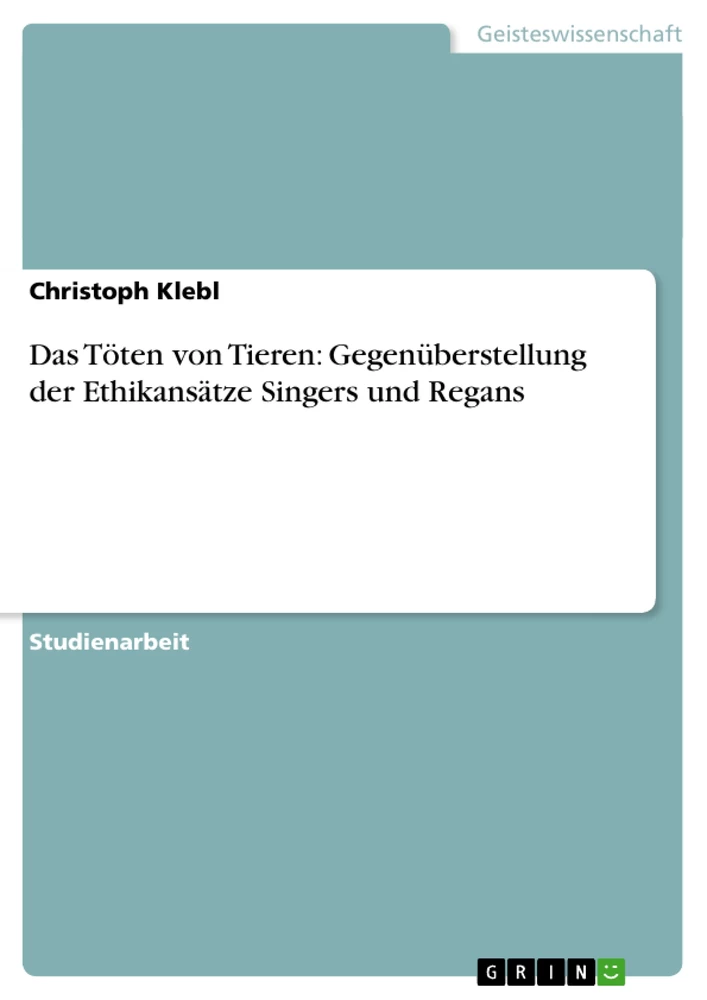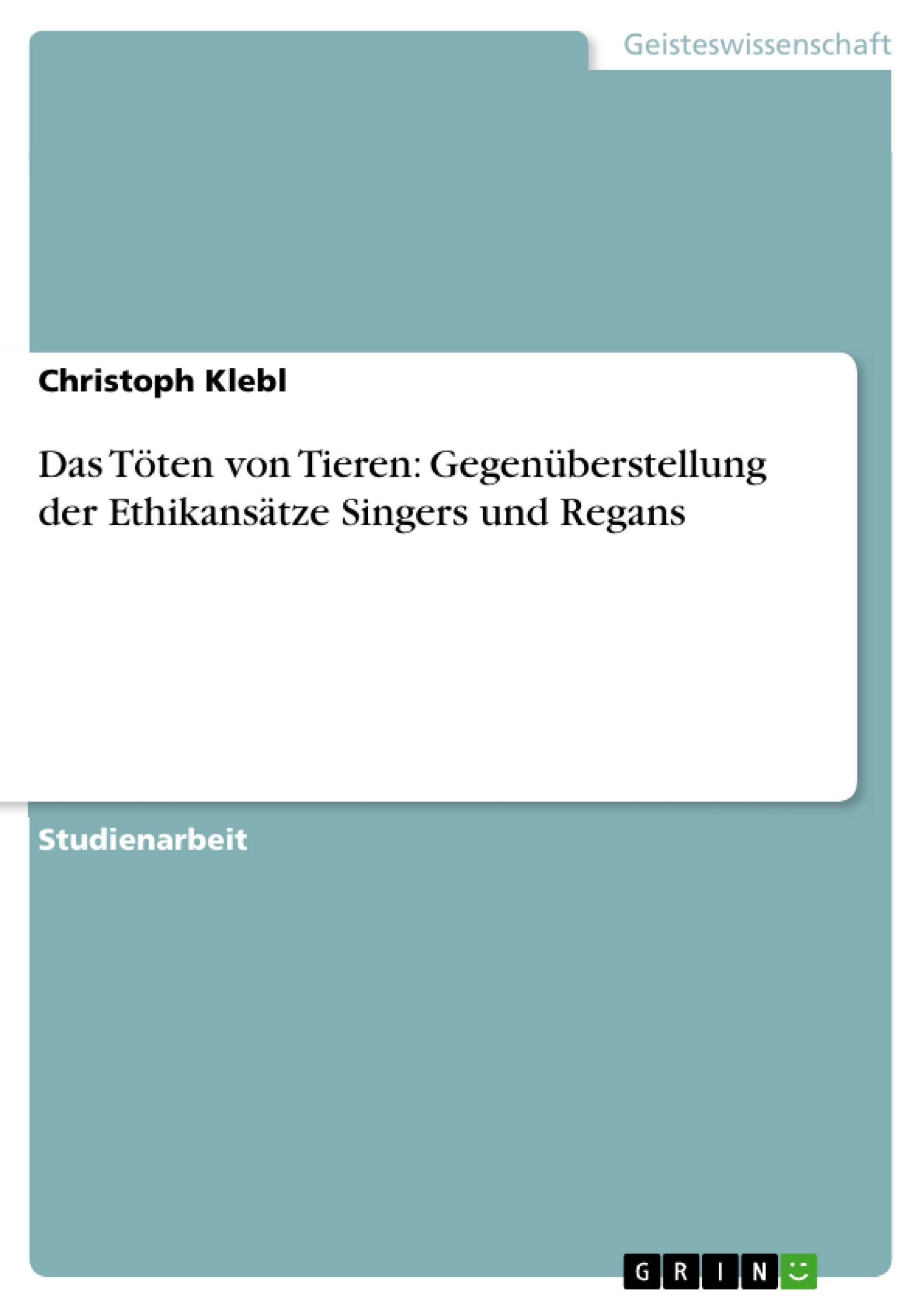Da Regan und Singer gemeinsam als Begründer der modernen Tierethik und als Vorreiter der Tierbefreiungs- bzw. Tierrechtsbewegung genannt werden, werde ich im Folgenden die Ethiken Singers und Regans darstellen, um die Differenzen zwischen diesen anhand der Beurteilung des Tötens von Tieren sichtbar zu machen.
Zunächst wird der von Singer vertretene Präferenzutilitarismus beschrieben und das darin zentrale Prinzip der gleichen Interessensabwägung sowie Singers Personenbegriff erläutert und anschließend die daraus folgenden Konsequenzen bezüglich der Beurteilung des Tötens von Personen und nichtpersonaler bewusster Lebewesen behandelt. Im Anschluss daran wird Regans Rechts-Ansatz vorgestellt, wobei zuerst die Herleitung des Schadensprinzip dargelegt wird, sowie die Zuschreibung inhärenten Werts und das dabei konstitutive subject-of-a-life Kriterium. Weiterhin wird das hieraus resultierende Respektprinzip erläutert und schließlich der Begriff des Rechts eingeführt und für das Recht auf eine respektvolle Behandlung argumentiert sowie dargelegt, wann es legitim ist, das aus dem eben genannten Recht abgeleitete Recht, prima facie nicht geschädigt zu werden, außer Kraft zu setzen. Zuletzt wird noch das Freiheitsprinzip eingeführt. Im letzten Abschnitt werden die Ethiken Singers und Regan anhand der moralischen Beurteilung des Tötens gegenübergestellt, wobei zunächst jeweils die Vorgehensweise bei der Beurteilung des Tötens von Tieren erläutert wird und anschließend diese anhand des sogenannten ´lifeboat case´, des Tötens von Tieren zu Nahrung und des Tötens von Tieren in Tierversuchen exemplifiziert wird.
Gliederung
1. Einleitung
2. Peter Singer
2.1 Der Präferenzutilitarismus
2.2 Das Prinzip der gleichen Interessensabwägung
2.3 Singers Personenbegriff
2.4 Das Töten von Personen
2.5 Das Töten nicht personaler bewusster Lebewesen
3. Tom Regan
3.1 Das Schadensprinzip
3.2 Die Zuschreibung inhärenten Werts
3.3 Das subject-of-a-life Kriterium
3.4 Das Respektprinzip
3.5 Die Ableitung des Schadensprinzips
3.6 Der Rechts-Ansatz
3.7 Das Recht auf eine respektvolle Behandlung
3.8 Das Außer-Kraft-setzen des Rechts prima facie nicht geschädigt zu werden
3.9 Das Freiheitsprinzip
4. Das Töten von Tieren
4.1 Das Töten von Tieren aus der Sicht Peter Singers
4.2 Das Töten von Tieren aus der Sicht Tom Regans
4.3 Der ´lifeboat-case´
4.4 Das Töten von Tieren zu Nahrungszwecken
4.5 Das Töten von Tieren in Tierversuchen
5. Schlussbemerkung
6. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
In der westlichen Philosophie war die Auffassung, dass es keine direkten moralischen Gründe gegen das Töten von Tieren gibt, die längste Zeit unangefochten. Dies liegt daran, dass Tiere nicht als Mitglieder unserer moralischen Gemeinschaft betrachtet wurden.
Die Gründe dessen waren zum einen fehlende empirische Erkentnisse bezüglich Tiere. So ging Descartes davon aus, dass Tiere nichts als komplexe Automaten sind, die weder über einen Verstand und Bewusstsein verfügen, noch Schmerz empfinden können.[1] Auch Kant war der Ansicht, dass Tiere im Gegensatz zu Menschen über kein Selbstbewusstsein verfügen.[2]
Zum anderen war die Auffassung, dass Menschen keine direkten Pflichten gegenüber Tieren besitzen, eine traditionelle Auffassung im westlichen Kulturkreis, die vielmehr als eine Voraussetzung von Ethik angesehen wurde, als dass sie eine Konsequenz der jeweiligen Ethikansätze waren.[3] So lehnte der britische Philosoph William Whewell den Utilitarismus aus dem Grund ab, dass dieser zur Folge haben könnte, dass das Glück der Menschen gemindert werden sollte, um das Glück von Tieren zu erhöhen.[4]
Während direkte Pflichten gegenüber Tieren abgelehnt wurden, ging man dagegen davon aus, dass Menschen indirekte Pflichten gegenüber Tieren haben. So ist es prima facie moralisch falsch den Hund oder das Pferd des Nachbarn zu töten, da man dadurch direkte Pflichten gegenüber diesem verletzt. Auch wurde unter anderem von Thomas von Aquin und Kant das Argument vertreten, dass man nicht grausam gegenüber Tieren sein sollte, um nicht zu verrohen und um somit auch freundlicher und weniger grausam gegenüber Menschen zu sein.[5]
Nach Vordenkern wie John Stuart Mill, wurde erst durch die Ethikansätze von Peter Singer und Tom Regan die Auffassung verbreitet, dass (manche) Tiere in unsere moralische Gemeinschaft miteinbezogen werden müssen und dass Menschen somit auch direkte Pflichten gegenüber Tieren haben. Trotz dieser Gemeinsamkeit sind die ethischen Ansätze von Singer und Regan grundlegend verschieden. So vertritt Singer eine Variante des Utilitarismus, den Präferenzutilitarismus, während Regan in der Tradition Kants steht.
Da Regan und Singer oft dennoch gemeinsam als Begründer der modernen Tierethik und als Vorreiter der Tierbefreiungs- beziehungsweise Tierrechtsbewegung genannt werden, werde ich im Folgenden die Ethiken Singers und Regans darstellen, um die Differenzen zwischen diesen anhand der Beurteilung des Tötens von Tieren sichtbar zu machen.
Zunächst wird der von Singer vertretene Präferenzutilitarismus beschrieben und das darin zentrale Prinzip der gleichen Interessensabwägung sowie Singers Personenbegriff erläutert und anschließend die daraus folgenden Konsequenzen bezüglich der Beurteilung des Tötens von Personen und nichtpersonaler bewusster Lebewesen behandelt. Im Anschluss daran wird Regans Rechts-Ansatz vorgestellt, wobei zuerst die Herleitung des Schadensprinzip dargelegt wird, sowie die Zuschreibung inhärenten Werts und das dabei konstitutive subject-of-a-life Kriterium. Weiterhin wird das hieraus resultierende Respektprinzip erläutert und schließlich der Begriff des Rechts eingeführt und für das Recht auf eine respektvolle Behandlung argumentiert sowie dargelegt, wann es legitim ist, das aus dem eben genannten Recht abgeleitete Recht, prima facie nicht geschädigt zu werden, außer Kraft zu setzen. Zuletzt wird noch das Freiheitsprinzip eingeführt. Im letzten Abschnitt werden die Ethiken Singers und Regan anhand der moralischen Beurteilung des Tötens gegenübergestellt, wobei zunächst jeweils die Vorgehensweise bei der Beurteilung des Tötens von Tieren erläutert wird und anschließend diese anhand des sogenannten ´lifeboat case´, des Tötens von Tieren zu Nahrung und des Tötens von Tieren in Tierversuchen exemplifiziert wird.
2. Peter Singer
2.1 Der Präferenzutilitarismus
Peter Singer ist einer der bedeutendsten Vertretern des Präferenzutilitarismus, einer Variante des Utilitarismus. Der Utilitarismus ist eine konsequentialistische Ethik, welche Handlungen nach ihren Konsequenzen beurteilt. Laut Jeremy Bentham ist das fundamentale Axiom des klassischen Utilitarismus, dass der Maßstab zur Beurteilung einer Handlung als gut oder schlecht, das größte Glück der größten Zahl ist.[6] Nach dem klassischen Utilitarismus wird somit jeweils diejenige Handlung als richtig betrachtet, welche im Vergleich zu allen potentiellen Handlungen den größten Zuwachs an Glück für alle Betroffenen produziert.[7] Hierbei zählt „jeder als einer […] und keiner mehr als eine[r]“.[8]
Der Präferenzutilitarismus hingegen „beurteilt Handlungen nicht nach ihrer Tendenz zur Maximierung von Lust und Minimierung von Leid, sondern nach dem Grad, in dem sie mit den Präferenzen der von den Handlungen oder ihren Konsequenzen betroffenen Wesen übereinstimmt“.[9] Eine Handlung, welche den Präferenzen eines Wesens entgegensteht, ist nur dann moralisch gut, wenn dies durch eine Befriedigung entgegengesetzter Präferenzen mindestens ausgeglichen wird.[10]
2.2 Das Prinzip der gleichen Interessenabwägung
Laut Singer muss zur präferenzutilitaristischen Beurteilung moralischer Handlungen ein universaler Standpunkt eingenommen werden.[11] Durch das Einnehmen eines universalen Standpunktes gelangt man zu einem „grundlegenden Prinzip der Gleichheit: das Prinzip der gleichen Interessenabwägung“.[12] Nach diesem Prinzip wird jede Präferenz bzw. jedes Interesse gleich berücksichtigt, unabhängig vom Wesen, welches das jeweilige Interesse hat. Dies impliziert jedoch keine Gleichbehandlung unterschiedlicher Interessen. Ein Interesse hat dann ein stärkeres Gewicht als ein anderes, wenn das Interesse an sich stärker ist, jedoch nicht aufgrund der Beschaffenheit des Wesens, welches dieses Interesse hat. So können unterschiedliche Ausprägungen in bestimmten Fähigkeiten zwischen Individuen keinen Grund darstellen, die Interessen eines Wesens mit größeren Fähigkeiten stärker zu berücksichtigen, als die eines Wesens mit geringeren Fähigkeiten. Somit lässt sich weder eine ungleiche Berücksichtigung von Interessen aufgrund von Intelligenzunterschieden zwischen Individuen rechtfertigen, noch Rassismus, welcher eine Ungleichbehandlung aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Ethnie zu rechtfertigen versucht. Ebenso wenig ist die Zugehörigkeit zu einer Spezies ein Grund dafür, die Interessen eines Wesens weniger stark oder stärker zu berücksichtigen als die eines Wesens einer anderen Spezies. Diese Form der Diskriminierung wird in Anlehnung an die Begriffe ´Rassismus´ und ´Sexismus´ als ´Speziesismus´ bezeichnet. Demnach ist es speziesistisch, die Interessen von Menschen gegenüber denen der Tiere stärker zu berücksichtigen.[13]
Konstitutiv für den Anspruch auf eine gleiche Interessenabwägung ist nach Singer in Anlehnung an Bentham die Leidensfähigkeit. Diese Fähigkeit ist nicht eine beliebige Fähigkeit oder Eigenschaft, wie es unter anderem die oben genannten sind.[14] „Die Fähigkeit zu leiden und sich zu freuen ist vielmehr eine Grundvoraussetzung dafür, überhaupt Interessen haben zu können“.[15]
Im Gegensatz zu Gegenständen und Pflanzen, bei welchen es aufgrund des Nichtvorhandenseins von Leidensfähigkeit keine direkten Gründe gibt, sie moralisch zu berücksichtigen, müssen die Interessen von Tieren aufgrund deren Empfindungsfähigkeit berücksichtigt werden. Singer vertritt somit einen pathozentrischen Ethikansatz.
2.3 Singers Personenbegriff
Nachdem bereits der Grundgedanke des Präferenzutilitarismus und das Prinzip der gleichen Interessenabwägung dargestellt wurden, kommen ich nun zu Singers Personenbegriff, welcher für die moralischen Beurteilung des Tötens von Tieren von großer Bedeutung ist.
Der Begriff ´Person´ wird als „ein selbstbewußtes oder rationales Wesen“[16] definiert. In Anlehnung an John Locke definiert Singer ein selbstbewusstes Wesen als „sich seiner selbst als einer distinkten Entität bewußt, mit einer Vergangenheit und Zukunft.“[17] Eine Person ist daher fähig „Wünsche hinsichtlich seiner eigenen Zukunft zu haben“, und somit Interessen, welche auf die Zukunft ausgerichtet sind.[18] Singer grenzt damit Personen von bewussten, empfindungsfähigen, aber nicht selbstbewussten Wesen, sowie von nicht bewussten Wesen, ab.
Es stellt sich die Frage, welche Lebewesen zu den Personen zu zählen sind. Während historisch betrachtet nur Menschen Selbstbewusstsein zugeschrieben wurde, gibt es mittlerweile empirische Evidenz, die auf das Vorhandensein von Selbstbewusstsein bei weiteren Spezies, wie zum Beispiel Schimpansen und Gorillas, schließen lässt.[19] Außerdem gibt es Menschen, zum Beispiel Neugeborene, oder Menschen mit schwerer angeborener geistiger Behinderung, die sich nicht ihrer selbst als einer distinkten Entität mit Vergangenheit und Zukunft bewusst sind und daher keine Personen sind.[20] Somit gibt es Menschen die keine Personen sind und Individuen anderer Spezies, die zu den Personen zu zählen sind.
2.4 Das Töten von Personen
Nachdem Singers Personenbegriff diskutiert wurde, wird nun die Relevanz des Personseins auf die moralische Beurteilung des Tötens von Lebewesen betrachtet. Dabei wird zuerst das Töten von Personen erörtert und anschließend das Töten bewusstseinsfähiger, aber nicht selbstbewusster Tiere.
Es gibt vier mögliche Gründe dafür, dass das Leben einer Personen einen größeren moralischen Wert, als das Leben eines nicht selbstbewussten, empfindungsfähigen Lebewesens hat: Die Zukunftsorientiertheit der Präferenzen von Personen, der indirekte Grund gegen das Töten von Personen, das Recht auf Leben und die Respektierung der Autonomie. Während aus präferenzutilitaristischer Sicht die ersten beiden Gründe auf kritischer Ebene akzeptiert werden, können die letzten beiden lediglich auf intuitiver Ebene akzeptiert werden. Unter der intuitiven Ebene, der Ebene der alltäglichen Entscheidungsfindung, versteht man das Anwenden von Prinzipien, die in den meisten Fällen zum besten Ergebnis führen. Sie umfasst somit Heuristiken für alltägliche moralische Problemsituationen.[21]
Der erste Grund dafür, dass dem Leben von Personen ein besonderer Wert im Vergleich zu Nichtpersonen zukommt, ist ein primär präferenzutilitaristischer.
Während „ein Wesen, das sich nicht selbst als eine Entität mit einer Zukunft sehen kann, keine Präferenz hinsichtlich seiner eigenen zukünftigen Existenz haben“ kann, sind „Personen in ihren Präferenzen sehr zukunftsorientiert[...]. Sehr oft wird [durch das Töten] alles, was das Opfer in den vergangenen Tagen, Monaten oder Jahren zu tun bemüht war, ad absurdum geführt.“[22] Das Töten einer Person an sich ist somit aus präferenzutilitaristischer Sicht unrecht, weil diese Handlung der unter normalen Umständen vorhandenen Präferenz, weiterzuleben, entgegensteht, ohne dass diese Präferenz durch entgegengesetzte Präferenzen ausgeglichen werden.
[...]
[1] Vgl. http://www.animalethics.org.uk/descartes.html
[2] Hierbei soll nicht behaupten werden, dass nicht auch versucht wurde, rational und unter Bezugnahme neuer empirische Erkenntnisse gegen die Aufnahme von Tieren in unsere moralische Gemeinschaft zu argumentieren, wie unter anderen von John Rawls
[3] Vlg. Krebs 1997, S. 13f.; http://www.utilitarian.net/singer/by/1995----04.htm
[4] Vgl. Singer 1980, S. 327
[5] Vgl. http://www.magnus-schwantje-archiv.de/Schriften/Eigene_Aufsaetze/Vortrag_bds-soz.pdf
[6] Vgl. http://www.utilitarismus.de/Diphneu.htm
[7] Vgl. Singer 1994; S. 17
[8] Singer 1994; S. 27
[9] Vgl. Singer 1994; S. 128
[10] Singer 1994; S. 128
[11] Vgl. Singer 1994; S. 29
[12] Singer 1994; S. 39
[13] Vgl. Singer 1994; S. 39 f.
[14] Vgl. Singer 1994; S. 84 f.
[15] Singer 1994; S. 85
[16] Singer 1994; S.120
[17] Singer 1994; S.123
[18] Ebd.
[19] Vgl. http://plato.stanford.edu/entries/consciousness-animal/#hist; Singer 1994; S.147 ff.
[20] Vgl. Singer 1994; S.123,156
[21] Vgl. Singer 1994; S. 126 f.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text?
Dieser Text ist eine Abhandlung über die ethischen Ansätze von Peter Singer und Tom Regan in Bezug auf das Töten von Tieren. Er untersucht ihre unterschiedlichen philosophischen Grundlagen und deren Konsequenzen für die moralische Beurteilung des Tötens von Tieren.
Wer sind Peter Singer und Tom Regan?
Peter Singer und Tom Regan sind prominente Philosophen, die als Begründer der modernen Tierethik und Vorreiter der Tierbefreiungs- bzw. Tierrechtsbewegung gelten. Singer vertritt eine Form des Utilitarismus (Präferenzutilitarismus), während Regan in der Tradition Kants steht (Rechte-Ansatz).
Was ist Präferenzutilitarismus (nach Peter Singer)?
Der Präferenzutilitarismus ist eine Variante des Utilitarismus, die Handlungen nicht nach der Maximierung von Lust und Minimierung von Leid beurteilt, sondern nach dem Grad der Übereinstimmung mit den Präferenzen der betroffenen Wesen. Eine Handlung, die den Präferenzen eines Wesens entgegensteht, ist nur dann moralisch gut, wenn dies durch die Befriedigung entgegengesetzter Präferenzen mindestens ausgeglichen wird.
Was ist das Prinzip der gleichen Interessenabwägung (nach Peter Singer)?
Das Prinzip der gleichen Interessenabwägung besagt, dass jedes Interesse gleich berücksichtigt werden muss, unabhängig vom Wesen, das dieses Interesse hat. Dies impliziert jedoch keine Gleichbehandlung unterschiedlicher Interessen. Die Leidensfähigkeit ist konstitutiv für den Anspruch auf eine gleiche Interessenabwägung.
Wie definiert Peter Singer den Begriff "Person"?
Singer definiert eine Person als ein selbstbewusstes oder rationales Wesen. Ein selbstbewusstes Wesen ist sich seiner selbst als einer distinkten Entität bewusst, mit einer Vergangenheit und Zukunft. Personen sind fähig, Wünsche hinsichtlich ihrer eigenen Zukunft zu haben.
Welche Relevanz hat der Personenbegriff für die moralische Beurteilung des Tötens?
Das Leben einer Person hat laut Singer einen größeren moralischen Wert als das Leben eines nicht selbstbewussten, empfindungsfähigen Lebewesens. Dies begründet er unter anderem mit der Zukunftsorientiertheit der Präferenzen von Personen.
Welche Argumente werden gegen das Töten von Personen vorgebracht?
Vier mögliche Gründe, warum das Leben einer Person einen höheren moralischen Wert hat als das eines nicht-selbstbewussten Wesens sind: die Zukunftsorientiertheit der Präferenzen von Personen, der indirekte Grund gegen das Töten von Personen, das Recht auf Leben und die Respektierung der Autonomie.
Was ist Speziesismus?
Speziesismus ist die Diskriminierung aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Spezies. Es bezeichnet die Tendenz, die Interessen von Mitgliedern der eigenen Spezies gegenüber den Interessen anderer Spezies zu bevorzugen, ohne hinreichende moralische Gründe.
Welche ethischen Systeme werden in diesem Dokument miteinander verglichen?
In diesem Dokument werden der Präferenzutilitarismus Peter Singers und die ethischen Ansätze von Tom Regan, welche in der Tradition von Kant stehen, verglichen und gegenübergestellt.
- Arbeit zitieren
- Christoph Klebl (Autor:in), 2013, Das Töten von Tieren: Gegenüberstellung der Ethikansätze Singers und Regans, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/232469