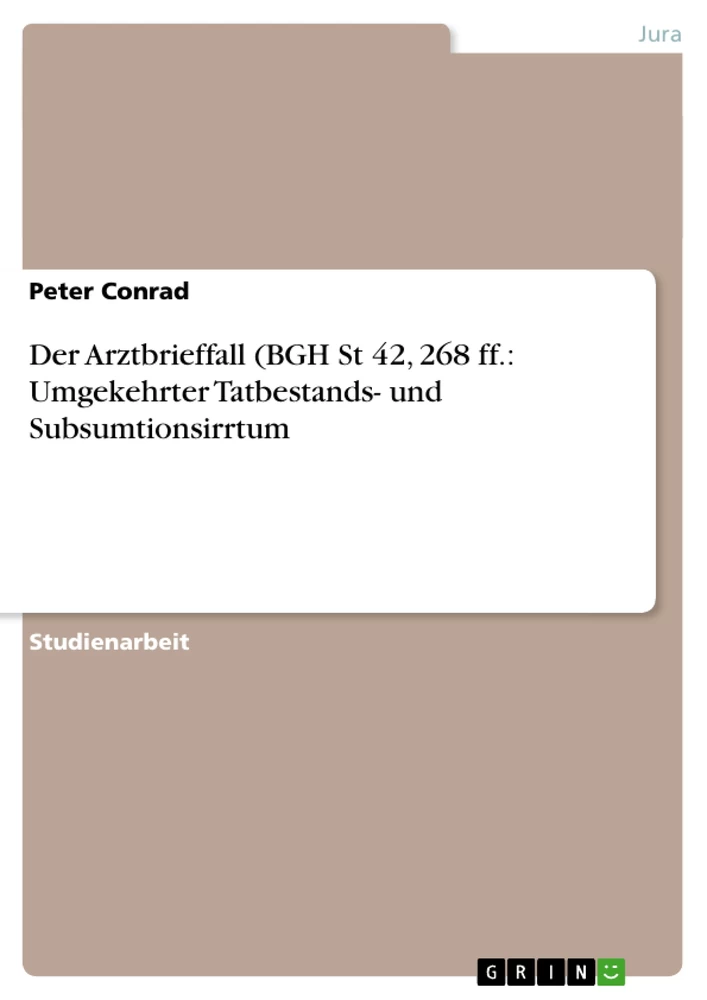m Tatzeitraum war der Angeklagte Oberarzt einer urologischen Klinik. Die Patientin S begab sich wegen starker Nierenschmerzen in seine Behandlung. Nachdem mehrere Zysten in der rechten Niere diagnostiziert worden waren, führte der Angeklagte im Dezember 1991/Januar 1992 Nierenzystenpunktionen durch. Eine Nierenfunktionsprüfung fand daraufhin nicht statt. Ein Brief an den Hausarzt von S, in welchem eine solche als weitere Behandlung festgelegt wird, verblieb aus unerklärlichen Gründen beim Angeklagten. Als im Juni 1992 wieder Zysten auftraten, wechselte S zu einem anderen Urologen, welcher eine Nierenfunktionsprüfung durchführen ließ. Diese ergab eine seit längerem bestehende Organschädigung. Im Januar 1993 wurde die Niere deswegen entfernt. Der Rechtsanwalt der S forderte im August 1993 die Krankenakte zur Prüfung von Schadensersatzansprüchen an. Weil der Angeklagte befürchtete, trotz einer aus seiner Sicht "lege artis" durchgeführten Behandlung möglicherweise ursächlich für den Nierenverlust gewesen oder aus anderen Gründen haftbar zu sein, erstellte er einen weiteren Arztbrief, den er auf den 19.11.1991 zurückdatieren ließ. Darin stellte er die von ihm nicht durchgeführte Nierenfunktionsprüfung als eine dem Hausarzt empfohlene Maßnahme zur Weiterbehandlung dar. Er übersandte eine Kopie dieses Briefes an den Rechtsanwalt der S, um sich einer Inanspruchnahme zu entziehen. In dem darauffolgenden Prozess, in welchem der Rechtsanwalt der S Schmerzensgeld in Höhe von 60.000 DM geltend machte, legte der Angeklagte die manipulierten Krankenunterlagen vor und beantragte Klageabweisung.
Inhaltsverzeichnis
- Vorsatz und Rechtsirrtum
- Versuch und Irrtum
- Wahndelikt
- Verbotsirrtum
- Subsumtionsirrtum
- Untauglicher Versuch und Wahndelikt
- Umkehrschluss aus § 59 StGB
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text befasst sich mit verschiedenen Aspekten des deutschen Strafrechts, insbesondere mit den Themen Vorsatz, Rechtsirrtum, Versuch, und Wahndelikt. Der Fokus liegt auf der juristischen Analyse und der Erörterung der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) zu diesen komplexen Rechtsfragen.
- Vorsatz und Rechtsirrtum im Strafrecht
- Abgrenzung von Versuch und Wahndelikt
- Der Verbotsirrtum und seine Rechtsfolgen
- Der Subsumtionsirrtum und seine Bedeutung
- Der "Umkehrschluss" aus § 59 StGB
Zusammenfassung der Kapitel
Vorsatz und Rechtsirrtum: Dieser Abschnitt analysiert den Zusammenhang zwischen Vorsatz und Rechtsirrtum im deutschen Strafrecht. Er beleuchtet die verschiedenen Arten von Irrtümern und deren Auswirkungen auf die Strafbarkeit. Die Diskussion bezieht sich auf die juristische Literatur und die Rechtsprechung, um ein umfassendes Verständnis der Materie zu vermitteln. Besonders relevant ist die Frage, wie sich ein Rechtsirrtum auf den Vorsatz auswirkt und unter welchen Umständen er die Strafbarkeit ausschließt.
Versuch und Irrtum: Die Zusammenfassung dieses Kapitels konzentriert sich auf die komplexe Beziehung zwischen dem Versuch einer Straftat und dem Vorliegen eines Irrtums. Es werden die verschiedenen Arten von Irrtümern diskutiert, die im Kontext eines Versuchs auftreten können, und deren Auswirkungen auf die Strafbarkeit. Die Analyse bezieht sich auf einschlägige Gerichtsentscheidungen und die Meinungen verschiedener Rechtswissenschaftler. Das Kapitel beleuchtet den Unterschied zwischen einem strafbaren Versuch und einem Irrtum, der den Versuch ausschließt.
Wahndelikt: Dieses Kapitel behandelt das Thema "Wahndelikt," eine spezifische Form eines Irrtums im Strafrecht. Es wird die Abgrenzung zum untauglichen Versuch erläutert und die Rechtsprechung dazu analysiert. Die Bedeutung der subjektiven Wahrnehmung des Täters und die Frage, ob eine objektive Prüfung der Tat notwendig ist, werden detailliert untersucht. Der Abschnitt beleuchtet diverse Rechtsfälle und die unterschiedlichen juristischen Ansichten dazu.
Verbotsirrtum: Die Zusammenfassung dieses Abschnitts widmet sich der detaillierten Untersuchung des Verbotsirrtums im Rahmen der Strafbarkeit. Die Analyse umfasst die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) und die unterschiedlichen Standpunkte in der Rechtsliteratur. Das Kapitel untersucht die Bedingungen, unter denen ein Verbotsirrtum strafbefreiend wirkt und welche Rolle das Wissen um die Rechtslage für die Strafbarkeit spielt. Der Abschnitt beleuchtet die Problematik der Abgrenzung zum Tatbestandsirrtum.
Subsumtionsirrtum: Dieses Kapitel konzentriert sich auf den Subsumtionsirrtum als eine spezielle Form des Rechtsirrtums. Es wird die Bedeutung der korrekten Subsumtion der Tat unter den Tatbestand analysiert. Die Diskussion beinhaltet die Rechtsprechung des BGH und die verschiedenen Meinungen in der Literatur. Der Schwerpunkt liegt auf der Unterscheidung zwischen dem Subsumtionsirrtum und anderen Formen von Irrtümern und deren Auswirkungen auf die Strafbarkeit.
Untauglicher Versuch und Wahndelikt: Dieses Kapitel analysiert die schwierige Abgrenzung zwischen einem untauglichen Versuch und einem Wahndelikt. Es werden die Kriterien zur Unterscheidung dieser beiden Rechtsfiguren erläutert und an Hand von Beispielen veranschaulicht. Dabei wird die Rechtsprechung sowie die relevanten Meinungen in der Literatur berücksichtigt. Der Fokus liegt auf der Frage, wann ein Handeln trotz fehlgeschlagenen Versuchs strafbar ist und wann ein Irrtum vorliegt, der die Strafbarkeit ausschließt.
Umkehrschluss aus § 59 StGB: In diesem Kapitel wird der sogenannte "Umkehrschluss" aus § 59 StGB eingehend diskutiert. Die Analyse umfasst die logischen und sachlichen Aspekte dieses Schlusses und seine Bedeutung für die Strafbarkeit. Die verschiedenen juristischen Auffassungen dazu werden erläutert und kritisch bewertet. Der Abschnitt beleuchtet die Auswirkungen dieses Schlusses auf die Praxis und zeigt die Relevanz seiner Anwendung in konkreten Fällen auf.
Schlüsselwörter
Vorsatz, Rechtsirrtum, Versuch, Wahndelikt, Verbotsirrtum, Subsumtionsirrtum, § 59 StGB, Bundesgerichtshof (BGH), Strafbarkeit, Rechtsprechung, deutsche Strafrecht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum deutschen Strafrecht: Vorsatz, Irrtum und Versuch
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Dieser Text bietet einen umfassenden Überblick über verschiedene Aspekte des deutschen Strafrechts, mit besonderem Fokus auf Vorsatz, Rechtsirrtum, Versuch und Wahndelikt. Er analysiert die juristischen Grundlagen, die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) und relevante Rechtsliteratur zu diesen komplexen Themen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Der Text behandelt folgende Schwerpunktthemen: Vorsatz und Rechtsirrtum, die Abgrenzung von Versuch und Wahndelikt, den Verbotsirrtum und seine Rechtsfolgen, den Subsumtionsirrtum und seine Bedeutung, sowie den sogenannten "Umkehrschluss" aus § 59 StGB. Jedes Thema wird in einem eigenen Kapitel detailliert erläutert.
Wie ist der Text aufgebaut?
Der Text enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Einleitung mit Zielsetzung und Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen zu den einzelnen Themenbereichen und abschließend eine Liste von Schlüsselbegriffen. Die Kapitelzusammenfassungen bieten jeweils eine kurze Übersicht über den Inhalt und die wichtigsten Ergebnisse der jeweiligen Analyse.
Was wird unter "Vorsatz und Rechtsirrtum" behandelt?
Dieser Abschnitt analysiert den Zusammenhang zwischen Vorsatz und verschiedenen Arten von Irrtümern und deren Auswirkungen auf die Strafbarkeit. Es wird untersucht, wie sich ein Rechtsirrtum auf den Vorsatz auswirkt und unter welchen Umständen er die Strafbarkeit ausschließt.
Wie wird der "Versuch" im Kontext von Irrtümern behandelt?
Das Kapitel "Versuch und Irrtum" befasst sich mit der komplexen Beziehung zwischen dem Versuch einer Straftat und verschiedenen Arten von Irrtümern. Es wird analysiert, wie diese Irrtümer die Strafbarkeit beeinflussen und der Unterschied zwischen strafbarem Versuch und irrtumsbedingtem Ausschluss des Versuchs erläutert.
Was ist ein "Wahndelikt" und wie wird es behandelt?
Das Kapitel "Wahndelikt" behandelt diese spezifische Form des Irrtums im Strafrecht. Es wird die Abgrenzung zum untauglichen Versuch erläutert und die Rechtsprechung dazu analysiert. Die subjektive Wahrnehmung des Täters und die Notwendigkeit einer objektiven Prüfung der Tat werden detailliert untersucht.
Wie werden "Verbotsirrtum" und "Subsumtionsirrtum" definiert und unterschieden?
Der "Verbotsirrtum" wird als spezielle Form des Rechtsirrtums behandelt, wobei die Bedingungen für seine strafbefreiende Wirkung und die Rolle des Wissens um die Rechtslage untersucht werden. Der "Subsumtionsirrtum" konzentriert sich auf die korrekte Subsumtion der Tat unter den Tatbestand und seine Unterscheidung von anderen Irrtumsformen.
Was ist der "Umkehrschluss aus § 59 StGB"?
Das Kapitel "Umkehrschluss aus § 59 StGB" diskutiert den "Umkehrschluss" aus diesem Paragraphen, seine logischen und sachlichen Aspekte und seine Bedeutung für die Strafbarkeit. Die verschiedenen juristischen Auffassungen werden erläutert und kritisch bewertet.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für den Text?
Die Schlüsselwörter umfassen Vorsatz, Rechtsirrtum, Versuch, Wahndelikt, Verbotsirrtum, Subsumtionsirrtum, § 59 StGB, Bundesgerichtshof (BGH), Strafbarkeit, Rechtsprechung und deutsches Strafrecht.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Dieser Text ist für akademische Zwecke gedacht und dient der Analyse von Themen im deutschen Strafrecht. Er ist besonders relevant für Studierende der Rechtswissenschaften und Juristen, die sich mit den behandelten Themen auseinandersetzen.
- Quote paper
- Peter Conrad (Author), 2003, Der Arztbrieffall (BGH St 42, 268 ff.: Umgekehrter Tatbestands- und Subsumtionsirrtum, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/23191