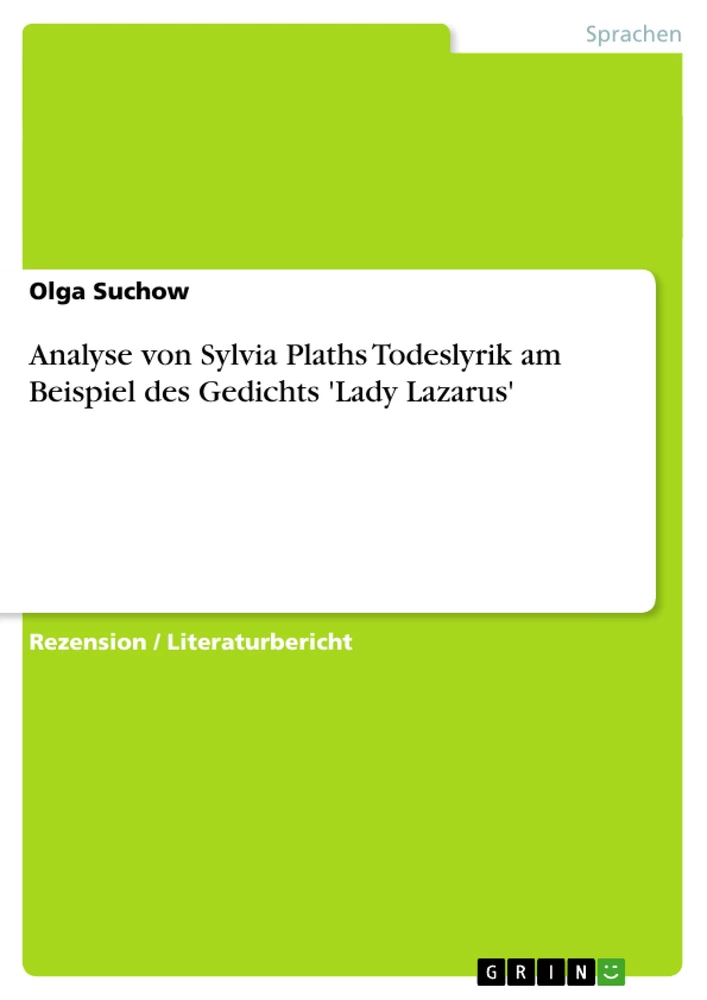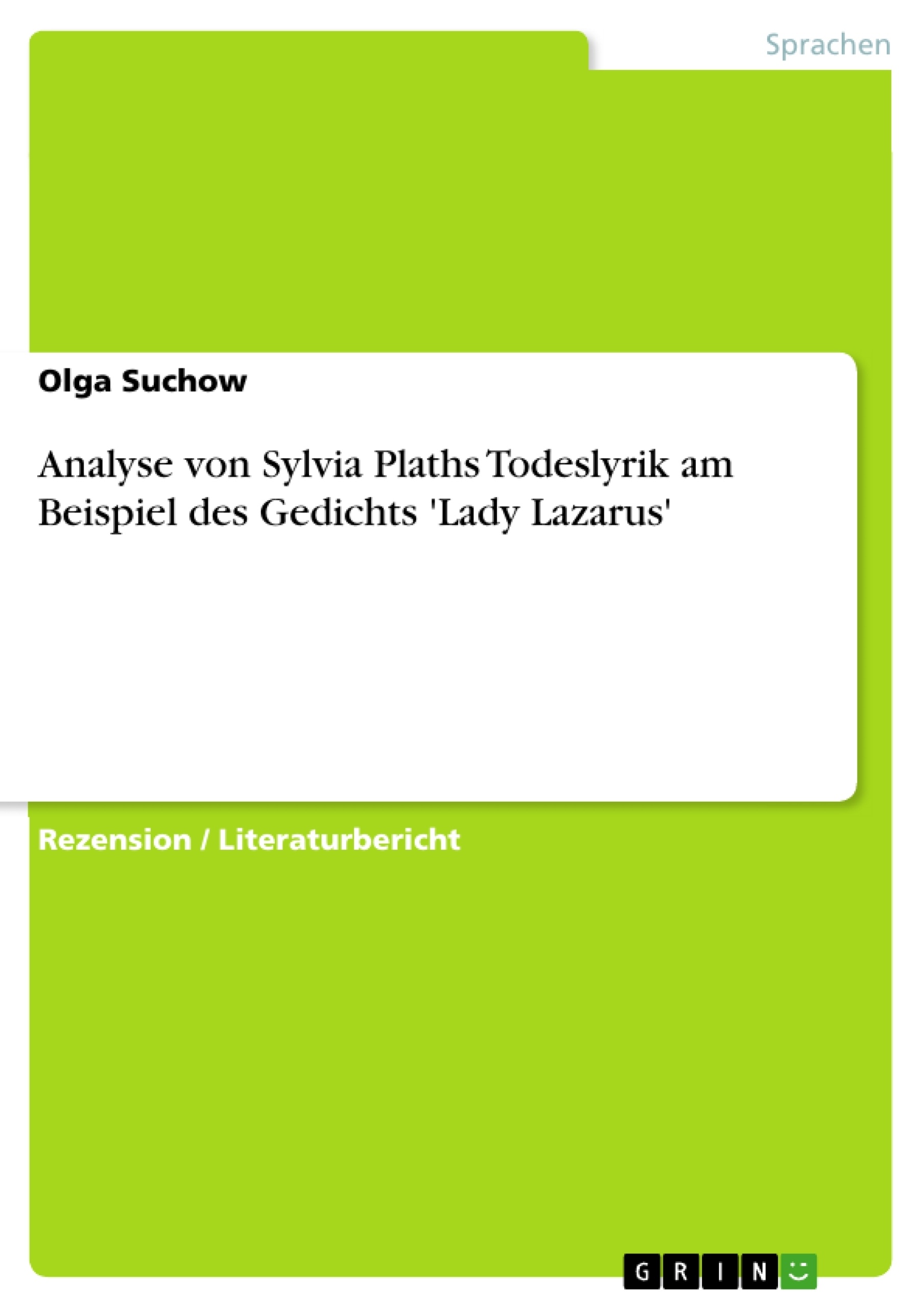Am 11. Februar 1963, gegen sechs Uhr morgens, öffnete Sylvia Plath das Fenster im
Schlafzimmer ihrer Kinder, bevor sie hinunter in die Küche ihrer Wohnung lief, deren
Tür und die Fenster verschloss und mit Handtüchern abdichtete, um anschließend Suizid
durch Vergasung zu begehen. Auf ihrem Arbeitstisch befanden sich einundvierzig
sorgfältig in einer schwarzen Mappe abgeheftete Gedichte, die Plath in den letzten drei
Monaten ihres Lebens geschrieben hatte, und welche unter dem Namen ‚Ariel‘ als Gedichtband
posthum veröffentlicht wurden. Eines dieser Gedichte war ‚Lady Lazarus‘.
Der Freitod Plaths löste, nicht zuletzt dadurch, dass Plath neben Anne Sexton und anderen
erfolgreichen Kolleginnen zu Lebzeiten Mitglied und Teil einer Bewegung wurde,
begründet durch Robert Lowells ‚Life Studies‘ und später bekannt als ‘confessional
mode of poetry‘, eine schier endlose Kontroverse aus. Einer der wohl geachtetsten Lyrikkritiker
des 20. Jahrhunderts, M. L. Rosenthal, dessen damalige Abhandlung über die
„neue Lyrik“ zu der am meisten beachteten wurde, definierte die ‘Confessional Poetry’
als die Dichtung, in der das private Leben des Dichters selbst zum Thema wird, und
zwar gerade dann, wenn er sich der Hürde einer psychischen Krise ausgesetzt sieht.
Plath erreichte in den letzten Monaten ihres Lebens den Höhepunkt ihres literarischen
Könnens. In dem Vorwort für ‚The Journals of Sylvia Plath‘, einem Auszug von Tagebucheinträgen
der Jahre 1950 bis 1962, schrieb Hughes über Plaths “real self”, das
letztendlich unter ihren “false selves“ zum Vorschein getreten war und einen triumphierenden
Ausdruck in den Gedichten der ‚Ariel‘, die Gedichte, die sie in dem letzten halben
Jahr ihres Lebens geschrieben hatte und welche den einzigen Grund für ihre Anerkennung
als Lyrikerin darstellten, fand.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2.1 Das lyrische „I“ in „Lady Lazarus“
- 2.2 Abgrenzung zu der „Confessional Poetry“ am Beispiel der Holocaust-Motive
- 3. Die Lyrik als Medium
- 4. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Sylvia Plaths Gedicht „Lady Lazarus“ im Kontext ihres Lebens und ihres Werkes. Sie untersucht die Rolle des lyrischen Ichs, die Beziehung des Gedichts zur „Confessional Poetry“, und die Verwendung der Lyrik als Medium der Selbstdarstellung und -reflexion. Das Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die Komplexität des Gedichts und seine Bedeutung im Gesamtkontext von Plaths literarischem Schaffen zu erlangen.
- Das lyrische Ich in „Lady Lazarus“ und seine Beziehung zu Sylvia Plath
- Die Einordnung des Gedichts in den Kontext der „Confessional Poetry“
- Die symbolische Bedeutung der Struktur und des Inhalts des Gedichts
- Die Rolle des Todesmotivs in „Lady Lazarus“
- Die Funktion des Gedichts als Ausdruck von Plaths persönlicher Erfahrung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein, indem sie den Suizid Sylvia Plaths und die kontroverse Diskussion um ihre „Confessional Poetry“ im Kontext ihrer posthum veröffentlichten Gedichte aus dem Band „Ariel“ beleuchtet. Sie hebt die Bedeutung des Gedichts „Lady Lazarus“ hervor und skizziert die zentralen Forschungsfragen, die im weiteren Verlauf der Arbeit behandelt werden. Besonderes Augenmerk liegt auf der Einordnung von Plaths Werk in den literarischen Diskurs und den biographischen Hintergrund, der das Verständnis ihres poetischen Schaffens maßgeblich beeinflusst.
2.1 Das lyrische „I“ in „Lady Lazarus“: Dieses Kapitel analysiert das lyrische Ich in „Lady Lazarus“ und seine Beziehung zu Sylvia Plath. Es wird die Struktur des Gedichts (28 Terzette, symbolisch für den Menstruationszyklus) untersucht und die wiederholte Verwendung des Pronomens „I“ betont. Die Analyse umfasst die verschiedenen Aspekte des lyrischen Ichs, von der Selbstdarstellung als „Phönix“-Frau bis hin zu der Ambivalenz zwischen der Figur und der Autorin selbst. Die Untersuchung der Verbindung zwischen dem literarischen Ausdruck und den autobiografischen Erfahrungen Plaths steht im Mittelpunkt.
2.2 Abgrenzung zu der „Confessional Poetry“ am Beispiel der Holocaust-Motive: Dieses Kapitel befasst sich mit der Einordnung von „Lady Lazarus“ in den Kontext der „Confessional Poetry“. Es werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu anderen Werken der Gattung herausgearbeitet. Der Fokus liegt auf der Diskussion der Grenzen und der Möglichkeiten dieses literarischen Stils, insbesondere in Bezug auf die Darstellung persönlicher Krisen und traumatischer Erfahrungen. Die Untersuchung der Holocaust-Motive im Gedicht, deren Analyse die Komplexität und Vielschichtigkeit von Plaths Werk unterstreicht, bildet den Kern dieses Kapitels.
3. Die Lyrik als Medium: Dieses Kapitel widmet sich der Funktion der Lyrik als Medium in „Lady Lazarus“. Es wird untersucht, wie Plath Sprache und Form nutzt, um ihre Erfahrungen und Emotionen auszudrücken. Die Analyse der sprachlichen Mittel, der Bildsprache und der symbolischen Bedeutung einzelner Passagen steht im Zentrum. Die Fähigkeit Plaths, durch das Medium Lyrik ihre innere Welt darzustellen und zu verarbeiten, wird detailliert beschrieben und eingeordnet.
Schlüsselwörter
Sylvia Plath, Lady Lazarus, Confessional Poetry, Lyrik, Selbstmord, Tod, Wiedergeburt, Identität, weibliche Erfahrung, Symbolismus, literarisches Ich.
Häufig gestellte Fragen zu Sylvia Plaths "Lady Lazarus"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Sylvia Plaths Gedicht "Lady Lazarus" eingehend. Sie untersucht das lyrische Ich, den Bezug zur "Confessional Poetry", und die Lyrik als Medium der Selbstdarstellung und -reflexion. Ziel ist ein tieferes Verständnis der Komplexität des Gedichts und seiner Bedeutung in Plaths Gesamtwerk.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit beleuchtet das lyrische Ich in "Lady Lazarus" und dessen Beziehung zu Sylvia Plath, die Einordnung des Gedichts in die "Confessional Poetry", die symbolische Bedeutung von Struktur und Inhalt, das Todesmotiv, und die Funktion des Gedichts als Ausdruck persönlicher Erfahrung. Besonders wird die Verwendung von Holocaust-Motiven und deren Bedeutung analysiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, die den Kontext des Gedichts und die Forschungsfragen darstellt. Kapitel 2.1 analysiert das lyrische Ich in "Lady Lazarus", Kapitel 2.2 vergleicht das Gedicht mit anderen Werken der "Confessional Poetry", insbesondere im Hinblick auf die Darstellung traumatischer Erfahrungen. Kapitel 3 untersucht die Lyrik als Medium der Selbstdarstellung. Die Arbeit schließt mit einem Fazit.
Welche Rolle spielt die "Confessional Poetry"?
Die Arbeit untersucht die Einordnung von "Lady Lazarus" in den Kontext der "Confessional Poetry". Sie beleuchtet Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu anderen Werken dieser Gattung, diskutiert die Grenzen und Möglichkeiten dieses Stils, insbesondere in Bezug auf die Darstellung persönlicher Krisen und traumatischer Erfahrungen. Der Vergleich dient der Einordnung und Kontextualisierung von Plaths Gedicht.
Welche Bedeutung hat das lyrische Ich in "Lady Lazarus"?
Das Kapitel 2.1 analysiert detailliert das lyrische Ich und dessen Beziehung zu Sylvia Plath. Es untersucht die Struktur des Gedichts (28 Terzette, symbolisch für den Menstruationszyklus), die wiederholte Verwendung des Pronomens "I", und die verschiedenen Aspekte des lyrischen Ichs – von der Selbstdarstellung als "Phönix"-Frau bis zur Ambivalenz zwischen Figur und Autorin.
Wie wird die Lyrik als Medium behandelt?
Kapitel 3 fokussiert auf die Funktion der Lyrik als Medium in "Lady Lazarus". Es wird analysiert, wie Plath Sprache und Form nutzt, um ihre Erfahrungen und Emotionen auszudrücken. Die Analyse der sprachlichen Mittel, der Bildsprache und der symbolischen Bedeutung einzelner Passagen steht im Mittelpunkt. Die Fähigkeit Plaths, ihre innere Welt durch die Lyrik darzustellen und zu verarbeiten, wird detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Sylvia Plath, Lady Lazarus, Confessional Poetry, Lyrik, Selbstmord, Tod, Wiedergeburt, Identität, weibliche Erfahrung, Symbolismus, literarisches Ich, Holocaust-Motive.
- Quote paper
- Olga Suchow (Author), 2011, Analyse von Sylvia Plaths Todeslyrik am Beispiel des Gedichts 'Lady Lazarus', Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/231796