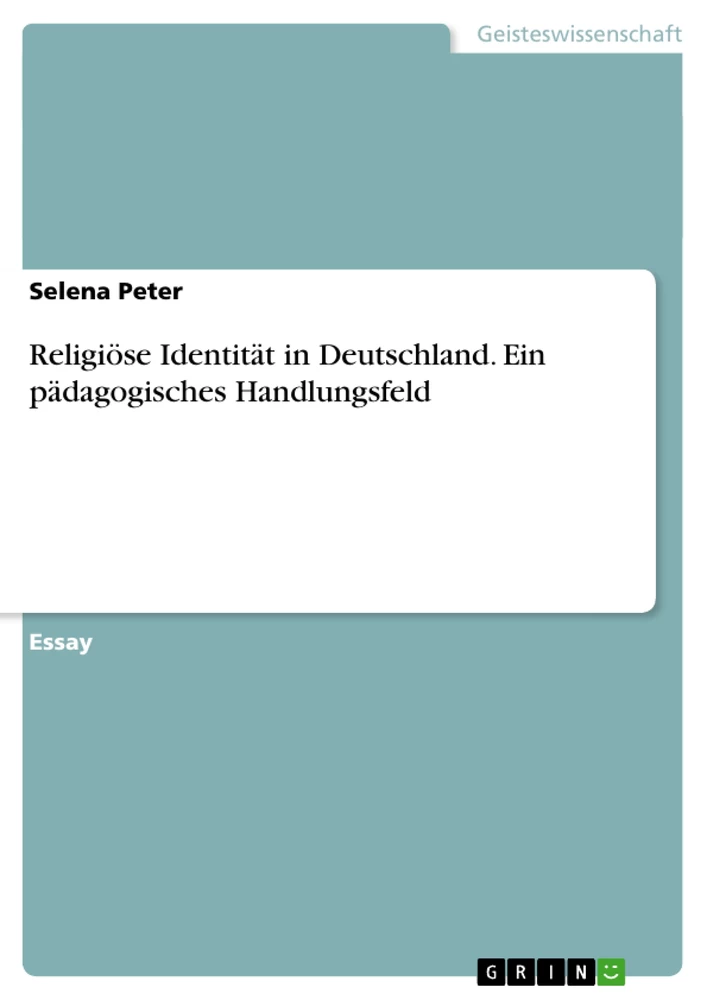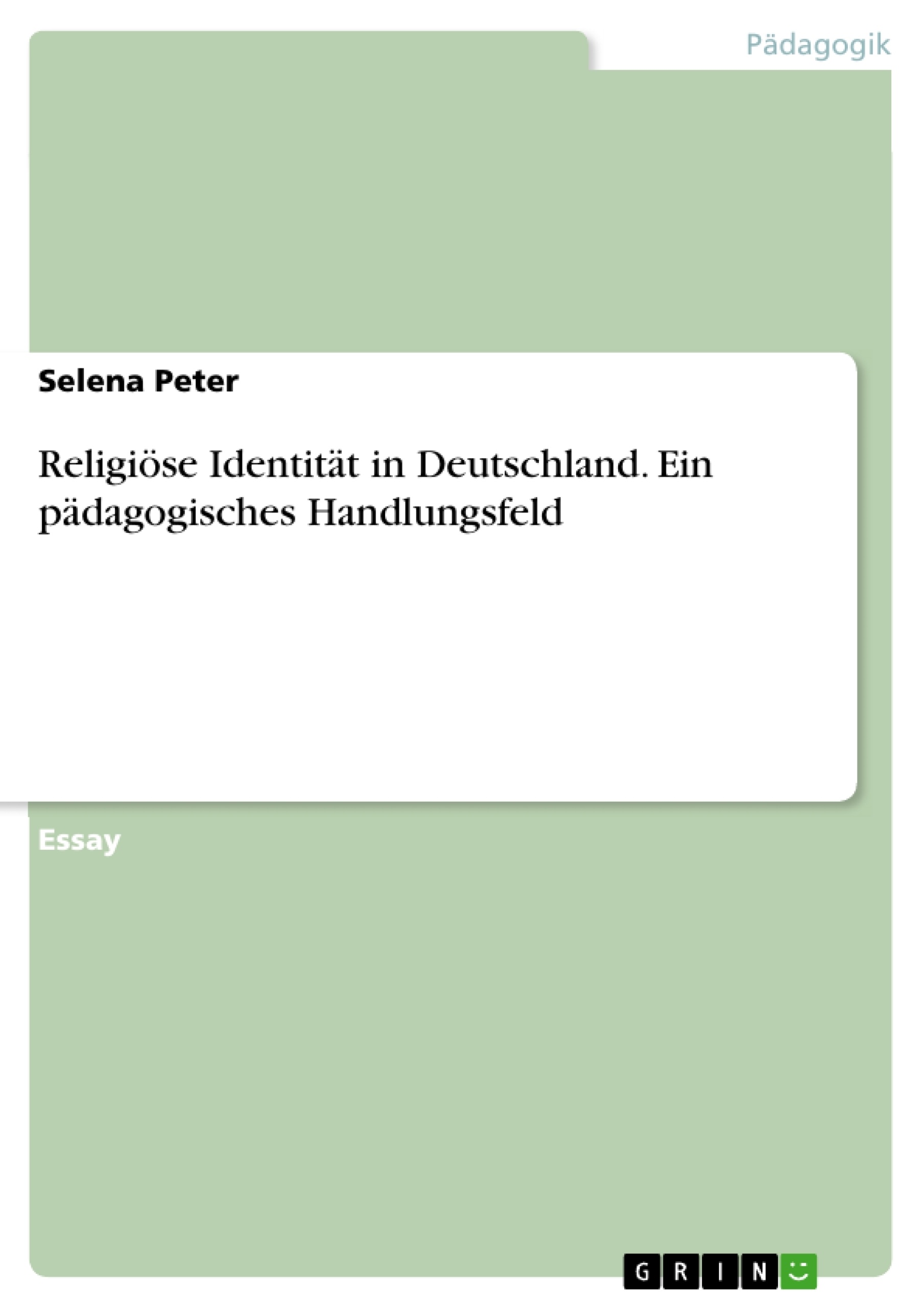Am 11. September 2001 hat die fundamentalistische Organisation Al Qaida einen Terroranschlag auf verschiedene Wahrzeichen Amerikas verübt und dadurch die Welt in ihren Grundfesten erschüttert und nachhaltig verändert. Innerhalb von wenigen Stunden versammelten sich die Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt vor den Fernsehbildschirmen und verfolgten die Tragödie live sowohl über nationale, als auch internationale Medienstellen. Die Liveübertragungen dieses amerikanischen Ereignisses in die ganze Welt sowie die Anteilnahme und die weiteren Folgen, die diese Tat nach sich zog, sind Indizien für unser technologisch geprägtes, globalisiertes Zeitalter. Der 11. September bestimmt auch heute noch alle Bereiche des politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Lebens und zwar weltweit. Terroranschläge, Kriege, Finanzkrisen und Katastrophen bestimmen nicht mehr nur das Leben der Menschen innerhalb eines Landes, sondern haben Auswirkungen auf jeden einzelnen Bewohner dieser Erde.
Der Anschlag auf Amerika hatte neben den politischen Auswirkungen und Entscheidungen, wie beispielsweise ein Krieg gegen den islamischen Terrorismus auch eine kulturelle und religiöse Debatte eröffnet. Das öffentliche Augenmerk lenkte sich durch eine Gruppe von Fundamentalisten auf die gesamte islamische Glaubensgemeinschaft, welche durch diesen Akt des Terrors zum Feindbild des Westens erklärt wurde. Es folgten Fragen nach der islamischen Identität sowohl von Seiten der Muslime als auch von der außerislamischen Gesellschaft. In Deutschland wurde erstmals ein bewusster Blick auf die verschiedenen Generationen der Einwanderer mit muslimischem Hintergrund gelenkt. Eine Vereinbarung der muslimischen Religion mit den demokratischen
Wertevorstellungen und den Grund- und Menschenrechten in Deutschland wurde in Frage gestellt. Die Kopftuchdebatte, die Diskussion um den Bau von Moscheen in Deutschland, Ehrenmorde und Zwangsheiraten traten im Laufe der Jahre ebenso in den Fokus der Medien und der allgemeinen Diskussion wie der weltweite Karikaturenstreit im Jahr 2006.
Am 11. September 2001 hat die fundamentalistische Organisation Al Qaida einen Terroranschlag auf verschiedene Wahrzeichen Amerikas verübt und dadurch die Welt in ihren Grundfesten erschüttert und nachhaltig verändert. Innerhalb von wenigen Stunden versammelten sich die Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt vor den Fernsehbildschirmen und verfolgten die Tragödie live sowohl über nationale, als auch internationale Medienstellen. Die Liveübertragungen dieses amerikanischen Ereignisses in die ganze Welt sowie die Anteilnahme und die weiteren Folgen, die diese Tat nach sich zog, sind Indizien für unser technologisch geprägtes, globalisiertes Zeitalter. Der 11. September bestimmt auch heute noch alle Bereiche des politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Lebens und zwar weltweit. Terroranschläge, Kriege, Finanzkrisen und Katastrophen bestimmen nicht mehr nur das Leben der Menschen innerhalb eines Landes, sondern haben Auswirkungen auf jeden einzelnen Bewohner dieser Erde.
Religiöse Diskussionen unserer Zeit
Der Anschlag auf Amerika hatte neben den politischen Auswirkungen und Entscheidungen, wie beispielsweise ein Krieg gegen den islamischen Terrorismus auch eine kulturelle und religiöse Debatte eröffnet. Das öffentliche Augenmerk lenkte sich durch eine Gruppe von Fundamentalisten auf die gesamte islamische Glaubensgemeinschaft, welche durch diesen Akt des Terrors zum Feindbild des Westens erklärt wurde. Es folgten Fragen nach der islamischen Identität sowohl von Seiten der Muslime als auch von der außerislamischen Gesellschaft. In Deutschland wurde erstmals ein bewusster Blick auf die verschiedenen Generationen der Einwanderer mit muslimischem Hintergrund gelenkt. Eine Vereinbarung der muslimischen Religion mit den demokratischen Wertevorstellungen und den Grund- und Menschenrechten in Deutschland wurde in Frage gestellt. Die Kopftuchdebatte, die Diskussion um den Bau von Moscheen in Deutschland, Ehrenmorde und Zwangsheiraten traten im Laufe der Jahre ebenso in den Fokus der Medien und der allgemeinen Diskussion wie der weltweite Karikaturenstreit im Jahr 2006.
Allgemeine religiöse Identität
Dieser verschärfte Blick auf die islamische Gemeinschaft in Deutschland lenkt jedoch von einer Entwicklung ab, die in engen Zusammenhang zu diesen Geschehnissen steht, allerdings als eigenständige Thematik betrachtet werden sollte, da sie bereits viele Jahre zuvor ihren Anfang genommen hat. Es geht nicht nur um die Frage nach der islamischen Identität, sondern um die Veränderung der religiösen Identität in Deutschland und Europa im Allgemeinen. In diesem Zusammenhang spielt das Wort Säkularisierung in seiner Bedeutung und Entwicklung eine entscheidende Rolle. Denn nicht erst seit dem 11. September 2001 wird die Verbindung von Kirche und Staat diskutiert, sondern bereits seit dem Beginn der Moderne verändert sich die Stellung der Religion und somit die Bedeutung des religiösen Selbstempfindens und der Identität für Politik und Gesellschaft eines Landes.
Das Bündnis der vorwiegend christlichen geprägten, westlichen Länder gegen den Islam und alle islamischen Länder, sowie die steigende Bedrohung durch globale Krisen und Kriege lassen den Schluss zu, dass die Menschen wieder Rückhalt und Stütze in der Religion suchen.
Es lässt sich jedoch lediglich eine Entstehung von der universellen Gemeinschaftsreligion, wie sie beispielsweise im Mittelalter gelebt wurde, hin zur privaten Religiosität beobachten. Tatsächlich sinken die Mitgliederzahlen der christlichen Kirchengemeinden sogar stetig und es scheint so, als würde Deutschland und Europa seine vorwiegend christlich geprägte Identität Stück für Stück verlieren. Daraus folgt eine Ambivalenz zwischen dem Wunsch oder der Suche nach spirituellem Rückhalt auf der einen Seite und den sinkenden Mitgliederzahlen der Kirchengemeinden auf der anderen Seite.
Im Folgenden möchte ich die Gründe für diesen Identitätsverlust näher betrachten und dabei vor allem aufzeigen, welche Bedeutung der Wandel von der Moderne zur Postmoderne für das religiöse Selbstempfinden hat. Nach einer Darstellung dieser Entwicklung scheint es weiter interessant, auch die Frage nach dem Zusammenhang der gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen durch das Handlungsfeld der Pädagogik aufzugreifen. Dabei sollen die Bereiche Schule, Kirchengemeinde und außerschulischer Bereich differenziert thematisiert werden. Dieses Essay hat nicht den Anspruch, alle komplexen Gründe für den Verlust bzw. die Veränderung der religiösen Identität in Deutschland darzulegen. Vielmehr möchte ich nur einige ausgewählte Punkte betrachten, die ich für sehr ausschlaggebend bei diesem Prozess halte.
Vom Bild der Religion
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text?
Der Text befasst sich mit den Auswirkungen des 11. September 2001 und der darauf folgenden religiösen Debatte, insbesondere im Hinblick auf die islamische Gemeinschaft. Er untersucht die Veränderungen in der religiösen Identität in Deutschland und Europa im Allgemeinen, im Zusammenhang mit der Säkularisierung und dem Übergang von der Moderne zur Postmoderne.
Welche Rolle spielt der 11. September 2001 in diesem Text?
Der 11. September 2001 wird als ein Wendepunkt dargestellt, der nicht nur politische Auswirkungen hatte, sondern auch eine kulturelle und religiöse Debatte auslöste. Er führte zu einer stärkeren Fokussierung auf die islamische Gemeinschaft und Fragen nach ihrer Identität.
Was bedeutet Säkularisierung im Kontext dieses Textes?
Säkularisierung bezieht sich auf die Trennung von Kirche und Staat und die Veränderung der Bedeutung von Religion für das Selbstverständnis von Individuen und die Gesellschaft. Der Text argumentiert, dass die Säkularisierung ein wichtiger Faktor für die Veränderung der religiösen Identität ist.
Was ist der Unterschied zwischen Moderne und Postmoderne in Bezug auf Religion?
In der Moderne versuchte die Wissenschaft, die Rolle der Kirche zu übernehmen und die Welt rational zu erklären. In der Postmoderne gibt es eher eine Koexistenz, wobei Religion Fragen nach dem "Warum" des Lebens beantwortet und Wissenschaft sich mit dem "Wie" beschäftigt.
Wie beeinflusst die Pädagogik die religiöse Identität?
Der Text erwähnt, dass die Rolle der Pädagogik in den Bereichen Schule, Kirchengemeinde und außerschulische Aktivitäten eine wichtige Rolle bei der Veränderung der religiösen Identität spielt. Dies soll näher untersucht werden, obwohl der Text nicht alle Aspekte im Detail darlegt.
Welche Ambivalenz wird in Bezug auf die Religion festgestellt?
Es gibt eine Ambivalenz zwischen dem Wunsch nach spirituellem Rückhalt und den sinkenden Mitgliederzahlen der christlichen Kirchengemeinden. Dies deutet darauf hin, dass die Menschen zwar nach spirituellen Antworten suchen, sich aber nicht unbedingt an traditionelle religiöse Institutionen wenden.
Was ist die Hauptaussage des Textes?
Die Hauptaussage ist, dass sich die religiöse Identität in Deutschland und Europa verändert, beeinflusst durch Faktoren wie den 11. September, die Säkularisierung und den Übergang von der Moderne zur Postmoderne. Diese Veränderungen wirken sich auf das religiöse Selbstempfinden aus, sowohl individuell als auch gesellschaftlich.
- Quote paper
- Selena Peter (Author), 2011, Religiöse Identität in Deutschland. Ein pädagogisches Handlungsfeld, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/231516