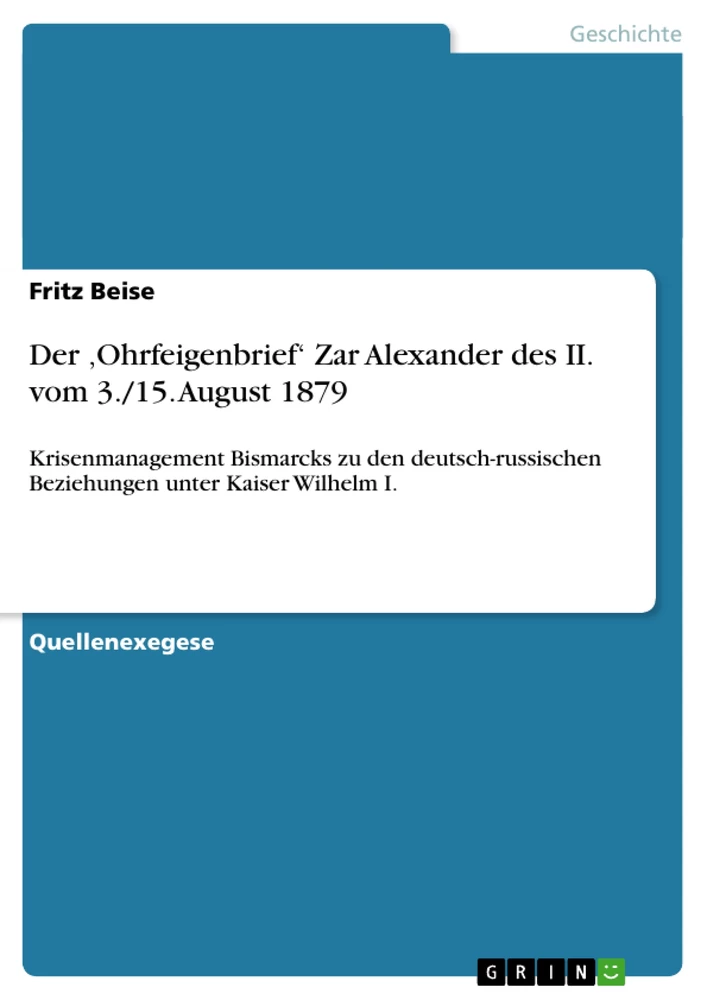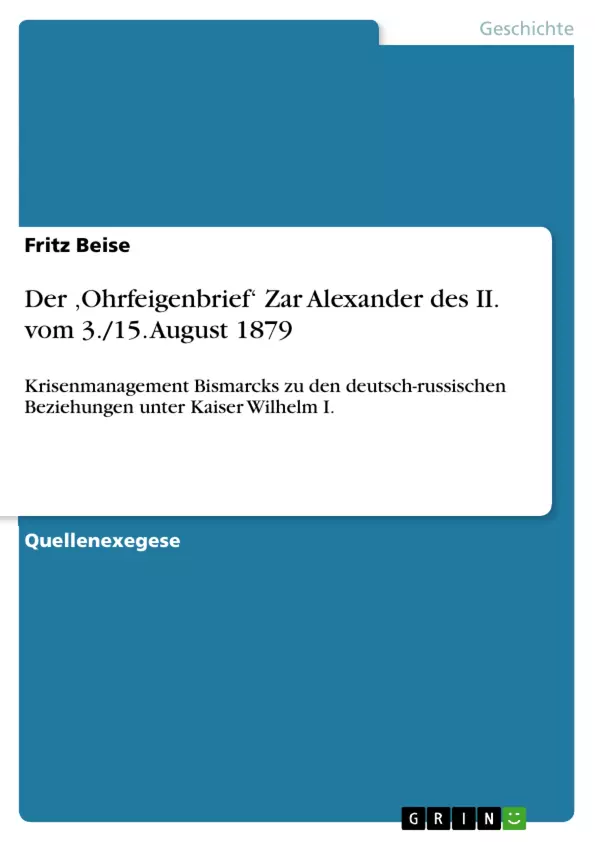Es handelt sich bei der vorliegenden Quelle um einen Brief des russischen Zaren Alexander II. an seinen Onkel, den deutschen Kaiser Wilhelm I. vom 3./15. Oktober 1879. Alexander beschwert sich darin über deutsche Diplomaten, die sich während der Balkankrise und im Berliner Kongress auf die Seite Österreichs gestellt und Russland vernachlässigt hätten . In der Geschichtswissenschaft ist der Text als „Ohrfeigenbrief“ bekannt. Die Quelle liegt in gedruckter Form innerhalb einer Aktensammlung des Auswärtigen Amtes vor.
Die Quelle wird im Zusammenhang mit den Verhandlungen rund um den Berliner Kongress und das damit verbundene Krisenmanagement Otto von Bismarcks betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Quellenkritik
- 1.1 Quellenbeschreibung
- 1.2 Innere Kritik
- 1.2.1 Sprachliche Aufschlüsselung
- 1.2.2 Sachliche Aufschlüsselung
- 2. Quelleninterpretation
- 2.1 Inhaltsangabe
- 2.2 Einführung in den historischen Kontext
- 2.2.1 Grundzüge der deutsch(preußisch)-russischen Beziehungen bis zur Balkankrise
- 2.2.2 Orientalische Krise 1876 und der russisch-osmanische Krieg 1877-78
- 2.2.3 San Stefano und Berliner Kongress
- 2.2.4 Russische Ziele des Ohrfeigenbriefes und Reaktion auf deutscher Seite bis zum Dreikaiserbündnis 1881
- 3. Ergebnis und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den sogenannten "Ohrfeigenbrief" Zare Alexander II. an Kaiser Wilhelm I. vom 3./15. August 1879. Ziel ist es, die Quelle kritisch zu untersuchen und ihren historischen Kontext zu beleuchten. Die Interpretation konzentriert sich auf die Botschaften des Briefs und deren Bedeutung für die deutsch-russischen Beziehungen.
- Quellenkritik des "Ohrfeigenbriefs"
- Deutsch-russische Beziehungen vor dem Hintergrund der Balkankrise
- Analyse der politischen Motive hinter dem Brief
- Reaktionen auf den Brief im deutschen Kaiserreich
- Bedeutung des Briefs für das spätere Dreikaiserbündnis
Zusammenfassung der Kapitel
1. Quellenkritik: Dieser Abschnitt beginnt mit einer detaillierten Beschreibung des "Ohrfeigenbriefs" – eines Briefs von Zar Alexander II. an Kaiser Wilhelm I. Die Quelle wird als gedruckte Version innerhalb einer Aktensammlung des Auswärtigen Amtes identifiziert. Die "Innere Kritik" analysiert den Brief sprachlich und sachlich. Die sprachliche Analyse beleuchtet die Verwendung veralteter Begriffe und die Hervorhebung wichtiger Fragen durch den Satzbau. Die sachliche Analyse untersucht verschiedene im Brief erwähnte Personen, Orte und Ereignisse (z.B. Augusta von Sachsen-Weimar-Eisenach, die Gasteiner Kur, der Tod von General von Reutern) und deren jeweilige Bedeutung im Kontext des Briefs. Der Abschnitt legt die Grundlage für eine fundierte Interpretation der Quelle.
2. Quelleninterpretation: Dieser Teil beginnt mit einer Inhaltsangabe des Briefs, gefolgt von einer detaillierten Einordnung in den historischen Kontext. Hier wird die Entwicklung der deutsch-russischen Beziehungen bis zur Balkankrise nachgezeichnet, einschließlich der Orientalischen Krise von 1876 und des russisch-osmanischen Krieges von 1877-78, sowie des San Stefano- und des Berliner Kongresses. Die Analyse konzentriert sich auf die russischen Ziele, wie sie im Brief zum Ausdruck kommen, und die Reaktionen der deutschen Seite, bis hin zum Dreikaiserbündnis von 1881. Der Abschnitt verbindet die sprachliche und sachliche Analyse der Quelle mit dem politischen Kontext und legt die Bedeutung des Briefs im Gesamtgeschehen dar. Die Zusammenfassung der einzelnen Unterkapitel wird in diesem Überblickstext unterlassen.
Schlüsselwörter
Ohrfeigenbrief, Zar Alexander II., Kaiser Wilhelm I., Deutsch-Russische Beziehungen, Balkankrise, Berliner Kongress, Dreikaiserbündnis, Bismarck, Quellenkritik, Historischer Kontext, Diplomatie.
Häufig gestellte Fragen zum "Ohrfeigenbrief"
Was ist der Inhalt des Dokuments?
Das Dokument ist eine umfassende Vorschau auf eine wissenschaftliche Arbeit, die sich mit dem "Ohrfeigenbrief" von Zar Alexander II. an Kaiser Wilhelm I. vom 3./15. August 1879 befasst. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter. Die Arbeit analysiert den Brief kritisch und beleuchtet seinen historischen Kontext, konzentriert sich auf die Botschaften und deren Bedeutung für die deutsch-russischen Beziehungen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Kapitel 1 behandelt die Quellenkritik, inklusive Quellenbeschreibung und innerer Kritik (sprachliche und sachliche Aufschlüsselung). Kapitel 2 konzentriert sich auf die Quelleninterpretation mit Inhaltsangabe und Einordnung in den historischen Kontext (deutsch-russische Beziehungen bis zur Balkankrise, Orientalische Krise 1876, russisch-osmanischer Krieg 1877-78, San Stefano und Berliner Kongress, russische Ziele und deutsche Reaktionen bis zum Dreikaiserbündnis 1881). Kapitel 3 beinhaltet Ergebnis und Ausblick.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den "Ohrfeigenbrief" kritisch zu untersuchen und seinen historischen Kontext zu beleuchten. Die Interpretation konzentriert sich auf die Botschaften des Briefs und deren Bedeutung für die deutsch-russischen Beziehungen. Es werden die Quellenkritik des Briefs, die deutsch-russischen Beziehungen vor dem Hintergrund der Balkankrise, die politischen Motive hinter dem Brief, die Reaktionen im deutschen Kaiserreich und die Bedeutung des Briefs für das spätere Dreikaiserbündnis analysiert.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Quellenkritik des "Ohrfeigenbriefs", den deutsch-russischen Beziehungen im Kontext der Balkankrise, der Analyse der politischen Motive hinter dem Brief, den Reaktionen auf den Brief im deutschen Kaiserreich und der Bedeutung des Briefs für das spätere Dreikaiserbündnis. Es wird die Entwicklung der deutsch-russischen Beziehungen bis zur Balkankrise, einschließlich der Orientalischen Krise und des russisch-osmanischen Krieges, sowie des San Stefano- und des Berliner Kongresses nachgezeichnet.
Wie wird die Quellenkritik durchgeführt?
Die Quellenkritik beginnt mit einer detaillierten Beschreibung des "Ohrfeigenbriefs" als gedruckte Version in einer Aktensammlung des Auswärtigen Amtes. Die innere Kritik analysiert den Brief sprachlich (Veraltete Begriffe, Satzbau) und sachlich (Personen, Orte, Ereignisse wie Augusta von Sachsen-Weimar-Eisenach, die Gasteiner Kur, der Tod von General von Reutern und deren Bedeutung im Kontext). Dies bildet die Grundlage für die Interpretation.
Wie wird der Brief in den historischen Kontext eingeordnet?
Die Quelleninterpretation ordnet den Brief detailliert in den historischen Kontext ein. Die Entwicklung der deutsch-russischen Beziehungen bis zur Balkankrise wird nachgezeichnet, einschließlich der Orientalischen Krise von 1876, des russisch-osmanischen Krieges von 1877-78, des San Stefano- und des Berliner Kongresses. Die Analyse konzentriert sich auf die im Brief zum Ausdruck kommenden russischen Ziele und die Reaktionen der deutschen Seite bis zum Dreikaiserbündnis von 1881.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter sind: Ohrfeigenbrief, Zar Alexander II., Kaiser Wilhelm I., Deutsch-Russische Beziehungen, Balkankrise, Berliner Kongress, Dreikaiserbündnis, Bismarck, Quellenkritik, Historischer Kontext, Diplomatie.
- Quote paper
- Fritz Beise (Author), 2012, Der ‚Ohrfeigenbrief‘ Zar Alexander des II. vom 3./15. August 1879, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/231501