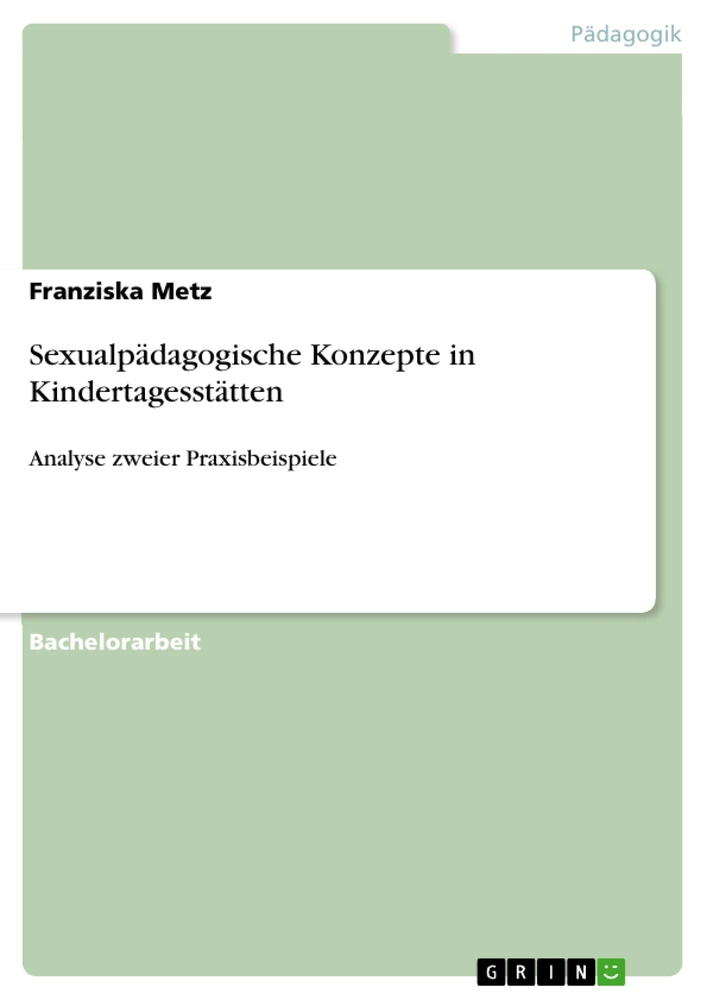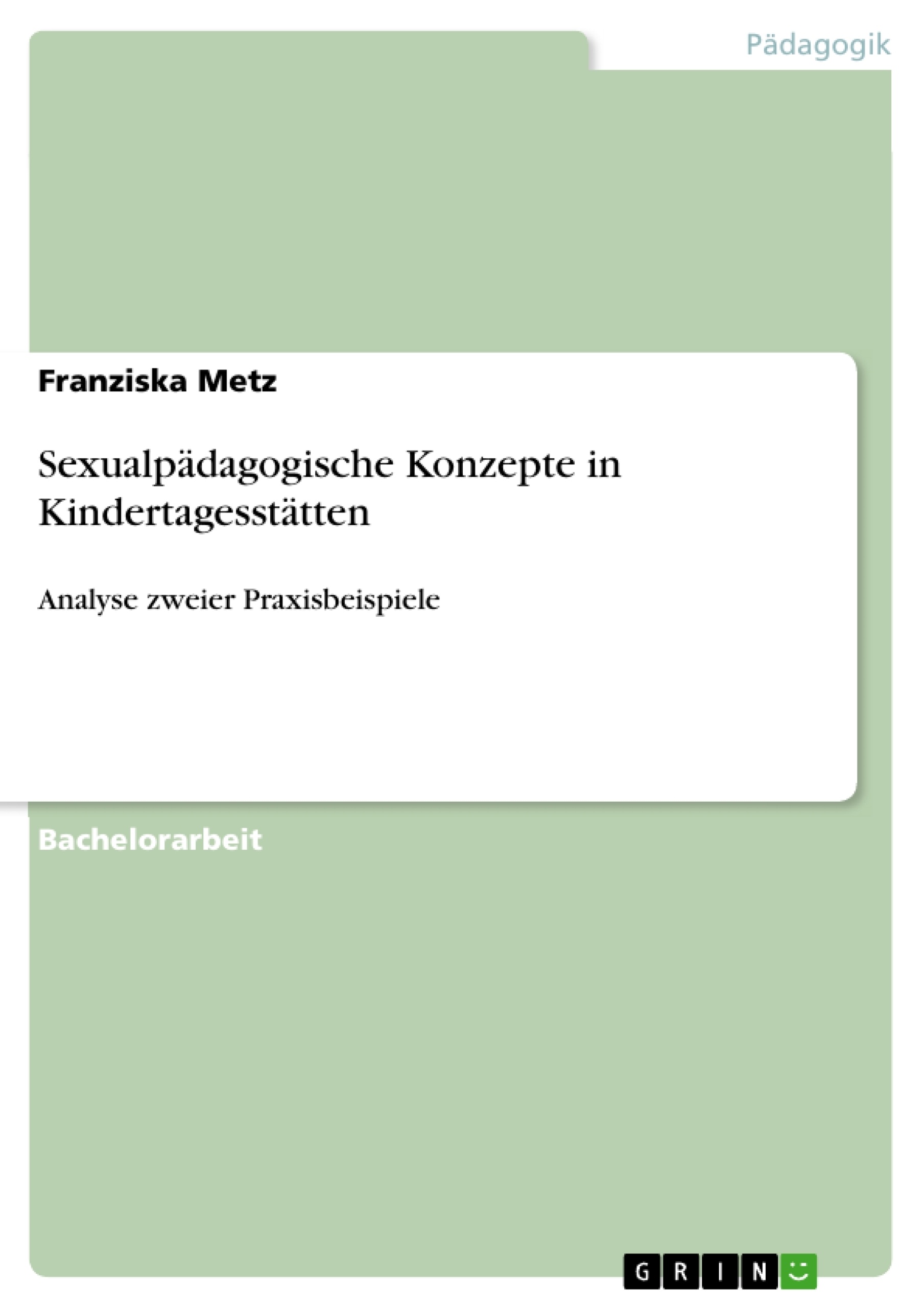Diese Arbeit beschäftigte sich mit sexualpädagogischen Konzepten in Kindertagesstätten. Ausgangspunkt der Arbeit war die Vermutung, dass eine Sexualerziehung schon im Vorschulalter nötig sei. Allerdings existieren kaum Konzepte für die Sexualerziehung in Kindertagesstätten.Hieraus ergab sich die Frage:Welche Konzepte in Kindertagesstätten existieren und wie sind diese zu bewerten? Dazu wird dargestellt, was unter Sexualität zu verstehen ist, und wodurch sich kindliche Sexualität auszeichnet.Nachfolgend wird auf die Sexualerziehung in Kindertagesstätten eingegangen und zwei Konzepte analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sexualität
- Begriffsbestimmung
- Kindliche Sexualität
- Die psychosexuelle Entwicklung des Kindes
- Unterschiede zwischen kindlicher und erwachsener Sexualität
- Sexualerziehung
- Verortung
- Ziele und Themen der Sexualerziehung
- Handlungsfelder und -methoden
- Sexualerziehung in Kindertagesstätten
- Bestandsaufnahme
- Voraussetzungen gelingender Sexualerziehung
- Inhalte
- Analyse sexualpädagogischer Konzepte für Kindertagesstätten
- Beschreibung der Konzepte
- Die „Kinderliedertour“ (BZgA)
- „Präventionsprogramm für den Elementarbereich“ (Strohhalm e.V.)
- Bewertung der Konzepte
- Die „Kinderliedertour“ (BZgA)
- „Präventionsprogramm für den Elementarbereich“ (Strohhalm e.V.)
- Beschreibung der Konzepte
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Bedeutung und Umsetzung von sexualpädagogischen Konzepten in Kindertagesstätten. Ziel ist es, einen Beitrag zum Verständnis der kindlichen Sexualität und deren Bedeutung für die Entwicklung zu leisten. Zudem soll die Frage beantwortet werden, wie Sexualerziehung in Kindertagesstätten gelingen kann und welche Konzepte dafür besonders geeignet sind.
- Kindliche Sexualität und ihre Entwicklung
- Ziele und Inhalte der Sexualerziehung
- Voraussetzungen für gelingende Sexualerziehung in Kindertagesstätten
- Analyse und Bewertung sexualpädagogischer Konzepte
- Bedeutung von Sexualerziehung für die Entwicklung von Kindern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet das Tabuthema der kindlichen Sexualität und die Notwendigkeit einer sexuellen Bildung bereits im Vorschulalter. Im zweiten Kapitel wird der Begriff der Sexualität definiert und die kindliche Sexualität unter Einbezug von Sigmund Freuds Phasenmodell näher erläutert. Die Kapitel 2.1 und 2.2 beleuchten die Unterschiede zwischen erwachsener und kindlicher Sexualität, während Kapitel 2.3 die Ziele, Methoden und Handlungsfelder der Sexualpädagogik präsentiert. Kapitel 3 analysiert die Voraussetzungen für eine gelingende Sexualerziehung in Kindertagesstätten. In Kapitel 4 werden zwei sexualpädagogische Konzepte, die "Kinderliedertour" der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und das "Präventionsprogramm für den Elementarbereich" vom STROHHALM e.V., vorgestellt und bewertet.
Schlüsselwörter
Kindliche Sexualität, Sexualerziehung, Kindertagesstätten, sexualpädagogische Konzepte, Präventionsprogramm, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), STROHHALM e.V., psychosexuelle Entwicklung, Selbstwertgefühl, Selbstbestimmung, Sexualität als Lebensenergie.
- Quote paper
- Franziska Metz (Author), 2013, Sexualpädagogische Konzepte in Kindertagesstätten, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/231395