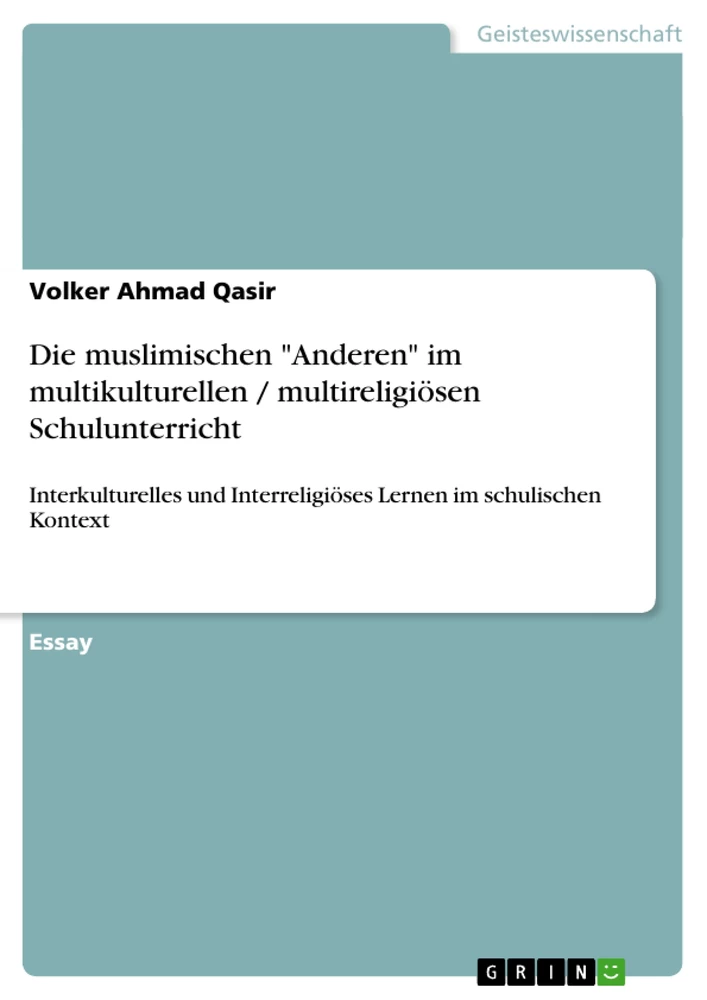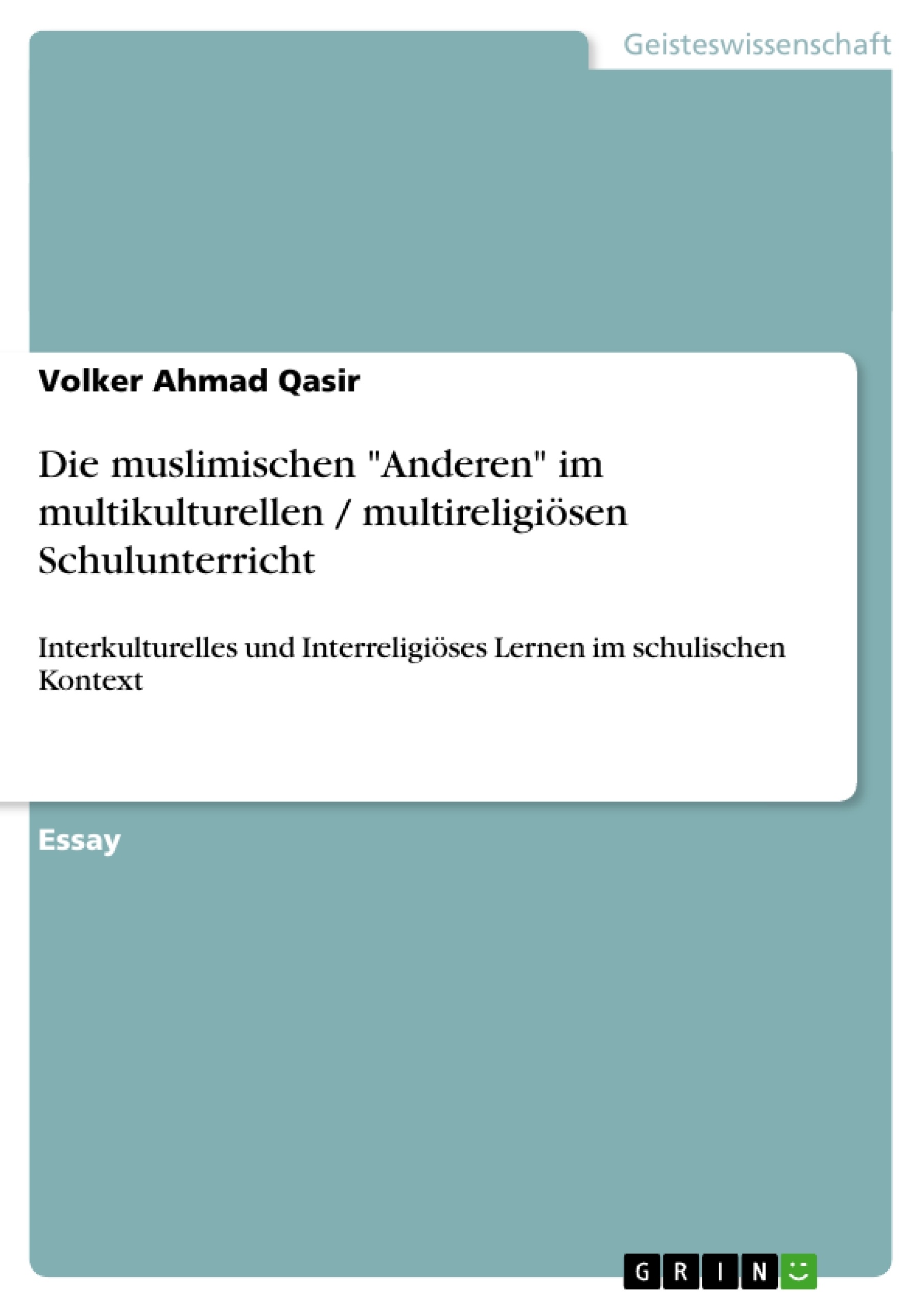Essay zum Umgang mit muslimischen Jugendlichen im schulischen Kontext und warum dieses oft ein Problem sein kann, wenn man den Islam und die islamische Kultur nicht kennt oder berücksichtigt. Und wie man diesen Problemen besser begegnen kann, wenn man über entsprechendes Wissen verfügt.
Inhaltsverzeichnis
Warum der Islam „anders“ ist
Die muslimischen „Anderen“ im Schulalltag und dessen Konsequenzen
Was interkulturelle / interreligiöse Kompetenzen hierbei leisten können
Religiöses Wissen als interkultureller / interreligiöser Konfliktlöser
Fazit
Quellenverzeichnis
Warum der Islam „anders“ ist
Der Islam ist eine uns Deutschen grundsätzlich fremde Religion, die nicht zuletzt deshalb in weiten Teilen der Bevölkerung auf Ablehnung stößt1, weil sie als „nicht mit der deutschen Gesellschaftsordnung vereinbar“2 wahrgenommen wird. Auffällig ist dabei, dass es immer wieder dieselben Stereotypen sind, die „geradezu zum Wesenskern der islamischen Religion“3 erklärt werden. Dies zudem oftmals von Personen ohne theologische oder islamwissenschaftliche Ausbildung mit dem Ziel, die bereits in der Gesellschaft vorherrschenden Ängste gegenüber dem „Fremden“ lediglich zu reproduzieren.4 Durch die weit verbreitete Annahme, die Frau gelte gegenüber dem Mann als minderwertig, was sich durch das Tragen des Kopftuchs als Symbol der Unterdrückung5 äußere oder aber die Muslime seien kulturell fremd und integrationsunwillig6, werden Bedrohungsszenarios erschaffen, wie zuletzt durch Thilo Sarrazin, der allen Muslimen aufgrund ihrer islamischen Sozialisation grundsätzliche Integrationsresistenz, Bildungsferne und Lernunwilligkeit zu bescheinigen versuchte. Trotzdem diese Annahmen „nicht dem Sachstand der tatsächlich messbaren Integrationserfolge“7 entsprechen, fanden Sarrazins verallgemeinernde Aussagen doch eine breite Zustimmung in der deutschen Öffentlichkeit.
In Zeiten moderner Massenmedien sind auch wir als Lehrkräfte von der öffentlichen Repräsentation der muslimischen „Anderen“ im gesellschaftlichen Kontext beeinflusst. Auch wir integrieren die genannten Stereotype stückweise in unser Selbstkonzept. Dies einerseits, um unterschiedlichen Dingen unterschiedliche Bedeutungen zuzuweisen, diese dann zu klassifizieren und auf Basis einer symbolischen Ordnung als „unsere Kultur“ zu definieren8, andererseits, um auch unser Selbstbild in Kontrast zu dem, was wir eben nicht sind (oder vielmehr: nicht sein wollen) abzugrenzen und uns dadurch (in Abgrenzung zum A(b)normalen) als „normal“ wahrzunehmen.9
Essay: Die muslimischen „Anderen“ im multikulturellen/multireligiösen Schulunterricht Die muslimischen „Anderen“ im Schulalltag und dessen Konsequenzen Für den pädagogischen Alltag ergibt sich daraus eine als problematisch zu erachtende Einstellung gegenüber Schülerinnen und Schülern, die aus islamisch geprägten Kulturkreisen stammen. Nicht selten nämlich werten Lehrkräfte Verhaltensweisen „muslimischer“ Schülerinnen und Schüler „nicht nur als inkompatibel mit geltenden Vorstellungen des Geschlechterverhältnisses der Sozialbeziehungen in der Klasse“, sondern sogar als Angriff auf die vorherrschende demokratische Norm.10 Die bekannten Stereotype werden auf die ungewohnten (unbekannten) Verhaltensweisen übertragen und im Lichte der bekannten Stereotype analysiert („Man sieht nur, was man weiß“). Das Ergebnis hiervon ist zwangsläufig eine Bestätigung und somit wiederum auch eine Verstärkung der bekannten Stereotype: „Vor diesem Hintergrund stellen religiöse Muslime für die Pädagogen nahezu zwangsläufig Gegner ihrer Erziehungs- und Bildungsziele dar. Verschärft wird der Konflikt, wenn solche in der Öffentlichkeit oft breit diskutierten islamisch- orthodoxen Minderheitenpositionen durch fehlende Sachkenntnisse pauschal auf alle muslimischen Schüler oder deren Eltern übertragen werden.“11
Die Verweigerung, das Klassenzimmer aufzuräumen oder die Tafel zu wischen, mit der Begründung, dies sei „Frauenarbeit“, verkommt bei einer Auseinandersetzung mit einem muslimischen Schüler zu einem „Kulturproblem“, während es sich bei neutraler Sichtweise schlichtweg um einen Machtkampf zwischen einem älteren Lehrer und einem jüngeren, pubertierenden Jugendlichen aus sozial schwachem Elternhaus handeln könnte.12 Ebenso wird dem kopftuchtragenden türkischen Mädchen, das zu Hause einen Streit mit dem Vater hatte, eine unterdrückte Persönlichkeit bescheinigt, während die Sachlage bei einer deutsch-stämmigen Jugendlichen vermutlich ganz anders aussehe, man das Recht vielleicht sogar auf Seiten der Eltern verorten würde.
Kurzum, Respektlosigkeiten gegenüber Lehrkräften, Probleme mit sozial schwachen Elternhäusern, oder ein bildungsfernes soziales Umfeld kommen natürlich auch bei Muslimen vor, sind aber nur bedingt das Produkt der anderen (islamischen) Kultur oder Religion.
Was interkulturelle / interreligiöse Kompetenzen hierbei leisten können
Die immer aus einer konkreten Problemstellung fast wie von alleine entstehende Frage nach einer Lösung kann und muss in diesem Fall auf sehr vielfältige Art und Weise im Kontext unserer häufig auch eurozentristisch geprägten Gesellschaft beantwortet werden. Für die Schule im Allgemeinen und für uns Pädagogen im Besonderen gilt zunächst einmal das Wissen um die vorherrschenden Mechanismen und dessen mögliche Konsequenzen für alle Beteiligten als ein erster Schritt in diese Richtung. Weiter geht jedoch der interkulturelle oder auch interreligiöse Austausch, da er uns neben der metakognitiven Reflexion auch die Chance gibt, den eigenen Standpunkt zu verlassen und den „Anderen“ gerade vom Platz des Anderen aus anzuerkennen13 und weiter noch, von ihm zu lernen.
Für uns als Lehrkraft tragen interkulturelle bzw. interreligiöse Kompetenzen dazu bei, auf der „Grundlage bestimmter Haltungen und Einstellungen, sowie besonderer Handlungs- und Reflexionsfähigkeiten in interkulturellen Situationen effektiv und angemessen zu interagieren.“14 Diese Kompetenzen erlernen auch wir als Lehrkraft nur in der aktiven Begegnung („Auseinandersetzung“ wäre hierbei ein eher unangebrachter Begriff) mit Andersgläubigen, bzw. Andersdenkenden. Geradezu prädestiniert hierfür ist natürlich der schulische Religionsunterricht. Hier ist das Thema Religion bereits Lehr- und Lerngegenstand und muss daher nicht erst noch auf die eine oder andere Art hierzu erklärt werden. Auch ist bei diesem „weichen Fach“ der Leistungsdruck, der auf den Schülerinnen und Schülern lastet, geringer, wodurch einerseits die Lehrkraft einen besseren Gestaltungsspielraum bei der Akzentuierung der Unterrichtsinhalte genießt und andererseits auch die Schülerinnen und Schüler diese Zeit zur freien Entfaltung ihrer Persönlichkeit erfahrungsgemäß gerne nutzen, ohne ständig eine mögliche Leistungsbeurteilung ihrer Aussagen befürchten zu müssen. Kurzum insbesondere der Religionsunterricht schafft fernab von den Leistungserwartungen der Berufswelt Freiräume, in denen sich Schülerinnen und Schüler, gerade auch unterschiedlicher Weltanschauungen oder innerer Einstellungen, austauschen und selbst erfahren können.
[...]
1 Vgl. www.sueddeutsche.de, Deutschland wird islamfeindlich, Abruf am: 26.11.2011
2 Rommelspacher, B., Islamkritik und antimuslimische Positionen, Wiesbaden, 2009, S. 438
3 Naumann, Th., Feindbild Islam, Wiesbaden, 2009, S. 19
4 Vgl. Schneiders, Th. G., Die Schattenseite der Islamkritik, Wiesbaden, 2009, S. 403
5 Vgl. Badinter, E., Das Kopftuch ist ein Symbol, auf: www.emma.de, Abruf am 26.11.2011
6 Vgl. Wagner, F., „Die passen sich nicht an“, Wiesbaden, 2009, S. 323
7 Foroutan, N., et.al., Sarrazins Thesen auf dem Prüfstand, Berlin, 2010, S. 3
8 Vgl. Hall, St., Das Spektakel des Anderen, Hamburg, 1994, S. 117
9 Vgl. Hall, St., Das Spektakel des Anderen, Hamburg, 1994, S. 120-121 Seite 1
10 Vgl. Karakasoglu, Y., Islam als Störfaktor in der Schule, Wiesbaden, 2009, S. 295
11 Karakasoglu, Y., Islam als Störfaktor in der Schule, Wiesbaden, 2009, S. 295
12 Vgl. Karakasoglu, Y., Islam als Störfaktor in der Schule, Wiesbaden, 2009, S. 298-299 Seite 2
13 Vgl. Hall, St., Das Spektakel des Anderen, Hamburg, 1994, S. 122
14 Boecker, M. (Hrsg.), Interkulturelle Kompetenz - Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts?, Gütersloh, 2006, S. 5
- Quote paper
- Master of Education; Dipl. Kfm. (FH) Volker Ahmad Qasir (Author), 2012, Die muslimischen "Anderen" im multikulturellen / multireligiösen Schulunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/231208