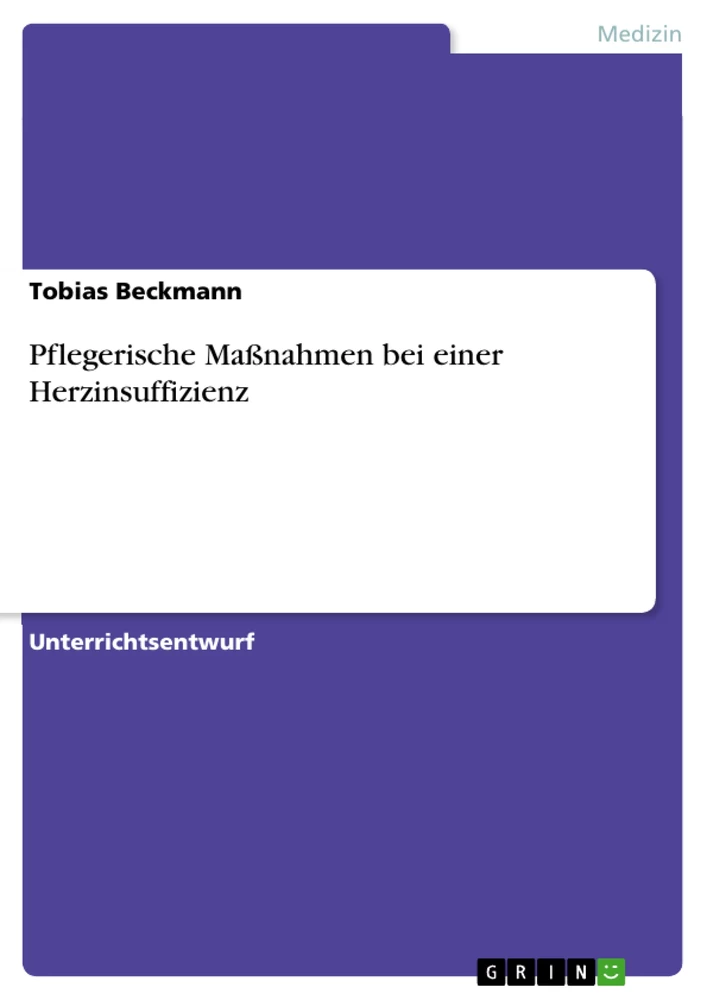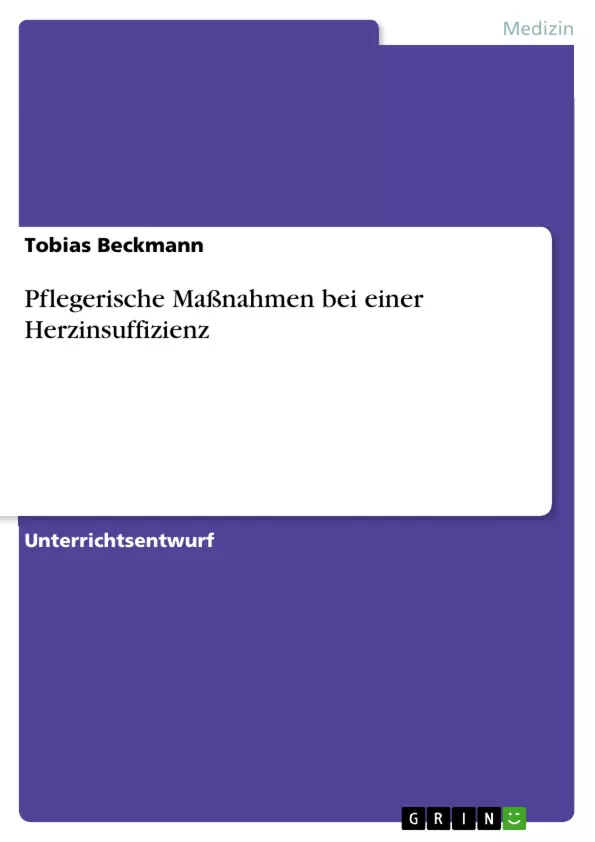In diesem Unterrichtsentwurf, der für das Teil-Lernfeld 1.3.5 der empfehlenden Ausbildungsrichtlinie für die Altenpflege für Nordrhein-Westfalen von Hundenborn & Kühn (2003) konzipiert wurde, sollen die Schüler die NYHA-Klassifizierung sowie entsprechende pflegerische Maßnahmen aller vier Stadien lernen. Hierbei sollen die folgenden Kompetenzen und Lernergebnisse erreicht werden:
Die folgenden Kompetenzen, die im Rahmen dieser Unterrichtsreihe angebahnt werden sollen, sind in Anlehnung an die Leonardo-Qualifikationen nach Knigge-Demal, Nauerth & Lammers (2001) formuliert:
Die Schülerinnen und Schüler werden…
- …Überforderungsphänomene bei Bewohnern und Bezugspersonen bzw. Angehörigen frühzeitig erkennen und mögliche Lösungswege aufzeigen.
- …die Selbstpflegekompetenzen sowie die gesundheitlichen, sozialen, emotionalen und kognitiven Ressourcen des Bewohners und des sozialen Netzes erkennen, fördern und im Sinne einer individuellen, selbständigkeits- und Lebensqualitäterhaltenden und -fördernden Pflege ausgestalten.
- …Situationen im persönlichen Nahbereich so gestalten, dass die physische, psychische, soziale, kulturelle und spirituelle Integrität des Bewohners gewahrt bleibt.
Im Rahmen der Unterrichtsstunde sollen die folgenden Lernergebnisse erreicht werden:
Wissen
Die Schülerinnen und Schüler…
- …kennen die Stadien einer Herzinsuffizienz gemäß der NYHA-Klassifizierung.
Können
Die Schülerinnen und Schüler…
- …berücksichtigen bei der Pflege, dass je nach Stadium einer Herzinsuffizienz unterschiedliche pflegerische Maßnahmen notwendig sind.
Einstellungen
Die Schülerinnen und Schüler…
- …beurteilen das Ausmaß der Hilfestellung individuell anhand des Krankheitsverlaufes sowie der vorhandenen Ressourcen.
Inhaltsverzeichnis
Verortung der Unterrichtsstunde
Kompetenzen
Lernergebnisse
Abkürzungsverzeichnis
1 Bedingungsanalyse
1.1 Voraussetzungen der Lerngruppe
1.2 Voraussetzungen des Studenten
1.3 Voraussetzungen seitens des Settings
2 Einordnung der Stunde in den Unterrichtszusammenhang
3 Kompetenzen
4 Situationsanalyse
4.1 Situation
4.2 Konstitutive Merkmale
4.2.1 Objektiver Pflegeanlass
4.2.2 Subjektives Krankheitserleben und -verarbeiten des Klienten
4.2.3 Interaktionsstrukturen
4.2.4 Handlungsmuster
4.2.5 Der Pflegeprozess
4.2.6 Tätigkeitsfeld
4.2.7 Gesellschaftlicher Kontext
5 Didaktische Überlegungen
5.1 Formale Begründung
5.2 Inhaltliche Begründung
5.3 Exemplarische Bedeutung
6 Didaktische Reduktion
6.1 Horizontale Reduktion
6.2 Vertikale Reduktion
7 Lernergebnisse
8 Methoden- / Medienwahl
Literaturverzeichnis
Anhang
- Quote paper
- B.A. Anleitung und Mentoring / cand. M.A. Berufspädagogik Pflege und Gesundheit Tobias Beckmann (Author), 2013, Pflegerische Maßnahmen bei einer Herzinsuffizienz, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/230706