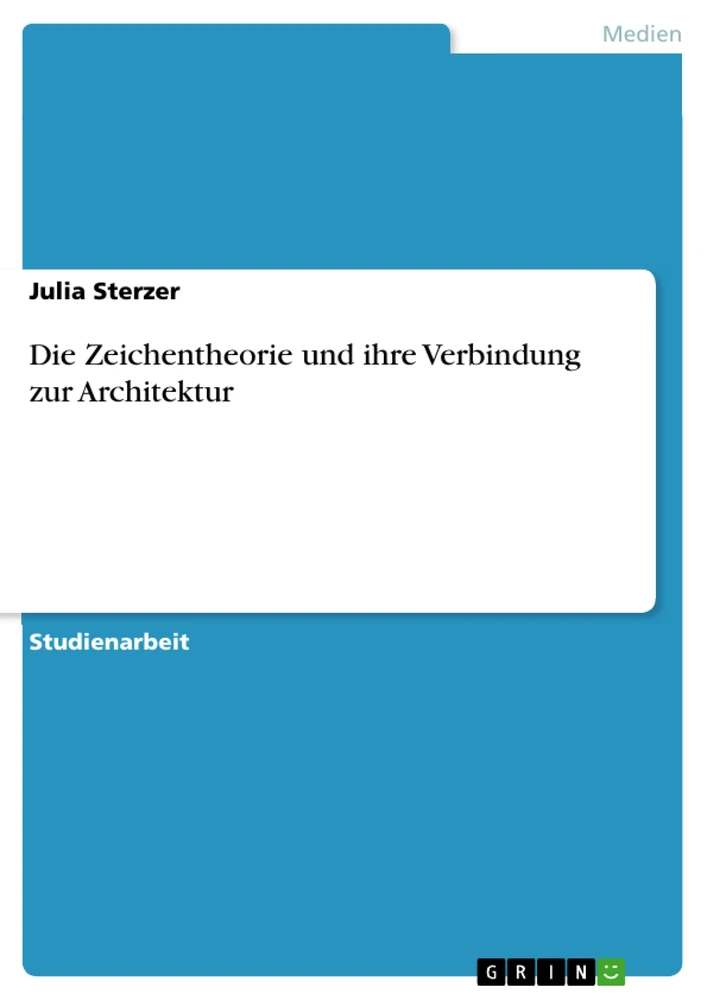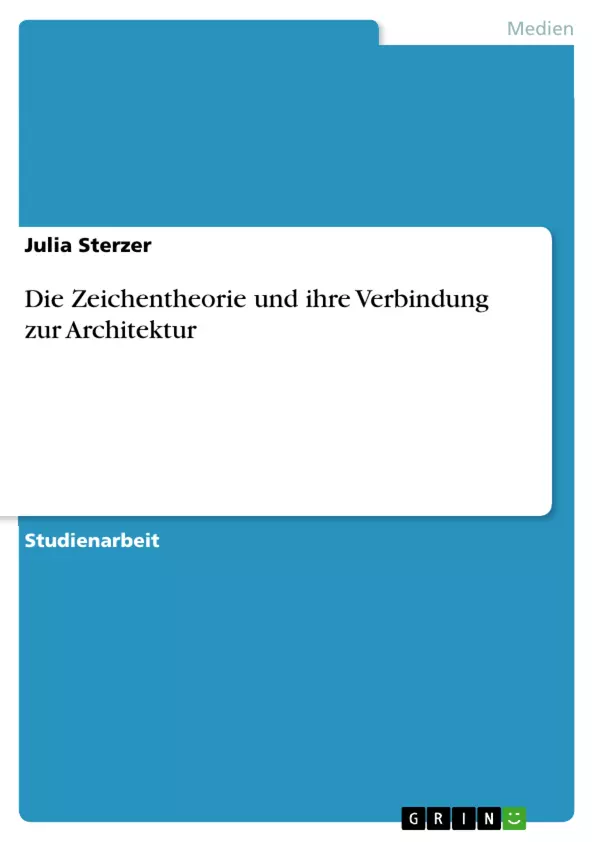Nicht selten stellt sich im Diskurs die Frage, was Kunst ist. Der Kunsthistoriker WYSS deutet Kunstwerke als „Bedeutungsträger der geistigen Selbstreflexion“1. Wenn man
dieser Definition zugeneigt ist, fällt es nicht schwer, eine Verbindung zur Ethnologie,
Geschichte und zur Philosophie herzustellen, den Disziplinen, die sich mit der Entwicklung
des Menschen befassen. Gerade HEGEL befasste sich in seiner „Vorlesung über die
Ästhetik“ mit der Entwicklung des Weltgeistes, die er in Korrelation setzt mit der
Herausbildung der unterschiedlichen Kunstgattungen.2 Im folgenden Text soll der
dekonstruktivistische Text „Der Schacht und die Pyramide - Einführung in die Hegelsche
Semiologie“ (2004) von DERRIDA behandelt werden, der gleichzeitig auf die
metaphysischen Thesen Hegels aufbaut, welche DERRIDA zu dekonstruieren versucht. Der
metaphysische sowie der dekonstruktivistische Blick auf die Zeichentheorie sollen hierbei
mit der Kunstgeschichte und insbesondere der Architektur in Verbindung gebracht werden.
Das Fundament dieses Textes bildet die Herleitung der Argumentationsstruktur von „Der
Schacht und die Pyramide“, wobei die philosophischen Werke von ARISTOTELES
(Übersetzung von Rolfes, Eugen; 1958), SLOTERDIJK (2007) sowie HEGEL behilflich sein
werden. Anschließend folgt im Fazit eine Ausarbeitung der Kritik von DERRIDA an HEGELs
Zeichentheorie, die mithilfe des Werkes von SLOTERDIJK (2007) näher beleuchtet wird,
sowie Kritikpunkte an DERRIDAs Dekonstruktion der Pyramide. Anschließend folgt in
Kapitel 9 die kunsthistorische Betrachtung der Metaphysik sowie Dekonstruktion, wobei
die Werke von WYSS (1989), WIGLEY (1994) sowie JOHNSON/WIGLEY (1988) zur
Betrachtung herangezogen werden. Hier sollen insbesondere die Verzahnung der
philosophischen Theorien mit der Architektur und ebenso eine philosophische Deutung der
behandelten Architektur betrachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Rückkehr der Idee zur Selbstpräsenz
- Der Schacht
- Die Pyramide und die Arbitrarität des Zeichens
- Das Zeichen und das Symbol
- Das Auge und das Ohr
- Die Hierarchie der Schriften
- Die Hieroglyphen
- Die chinesischen Schriftzeichen
- Die mathematischen Formeln
- Die phonetische Schrift
- Derridas Kritik an Hegels Semiologie
- Architekturbetrachtung durch die Augen von Hegel und Derrida
- Symbolische Architektur
- Dekonstruktivistische Architektur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text „Der Schacht und die Pyramide - Einführung in die Hegelsche Semiologie\" (2004) von DERRIDA, der auf die metaphysischen Thesen Hegels aufbaut, wird analysiert. Der Text untersucht die Beziehung zwischen der metaphysischen und dekonstruktivistischen Sichtweise der Zeichentheorie und deren Verbindung zur Kunstgeschichte, insbesondere der Architektur.
- Die Rückkehr der Idee zur Selbstpräsenz
- Die Rolle des Zeichens als Verbindung zwischen Idee und Realität
- Die Dekonstruktion der Hegelschen Semiologie durch Derrida
- Die Anwendung philosophischer Konzepte auf die Architektur
- Der Vergleich zwischen symbolischer und dekonstruktivistischer Architektur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Verbindung zwischen Kunst und geistiger Selbstreflexion dar, wobei die Werke von HEGEL und DERRIDA im Kontext dieser Verbindung betrachtet werden. Kapitel 2 analysiert DERRIDAS Übernahme von HEGELS platonischer Herleitung des Zeichens und erläutert die Rolle des Zeichens als „Ort des Übergangs“ zwischen zwei Momenten der Präsenz.
Kapitel 3 untersucht die Entstehung von Zeichen und stellt die Sichtweise von ARISTOTELES auf Laute als Zeichen für Vorstellungen dar. Der Text beleuchtet die Beziehung zwischen Psychologie und Semiologie in dieser Perspektive.
Schlüsselwörter
Der Text fokussiert auf die Beziehung zwischen Zeichen, Idee, Selbstpräsenz und Architektur. Die Schlüsselwörter umfassen Hegelsche Semiologie, Dekonstruktion, metaphysische Theorien, symbolische Architektur, dekonstruktivistische Architektur und die Rolle des Zeichens in der Kunstgeschichte.
- Arbeit zitieren
- Julia Sterzer (Autor:in), 2012, Die Zeichentheorie und ihre Verbindung zur Architektur, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/229569