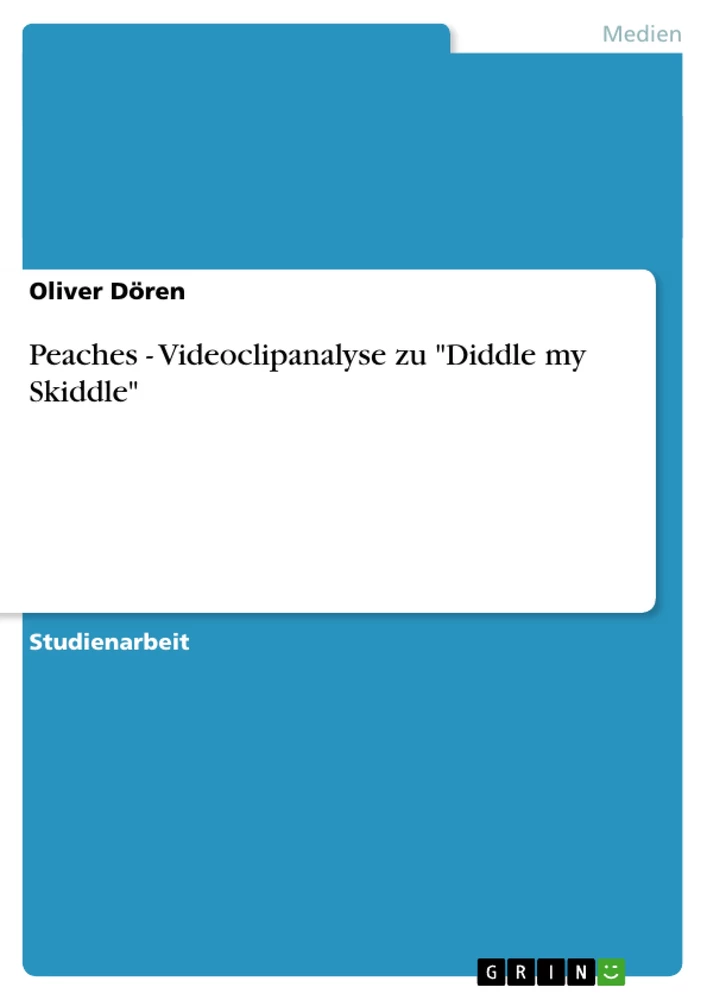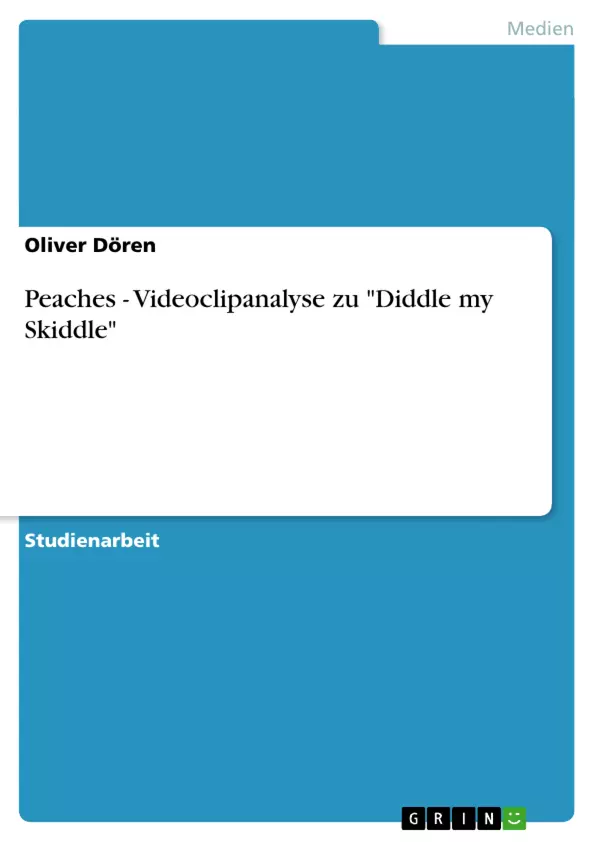Zu Beginn der Videoclipanalyse möchte ich einige relevante Kriterien nennen und sie auf ihre Anwendbarkeit bezüglich des Musikvideos von Peaches (Diddle My Skiddle) untersuchen. Dabei liegen der Analyse die visuelle, semantische, auditive Ebene sowie die im Videoclip enthaltene Geschlechterkonstruktion im Vordergrund. Im Anschluss der gewonnenen Erkenntnisse, möchte ich zeigen, wie Merril Nisker alias Peaches der immer noch bestehenden patriarchalischen, sexuellen Hegemonie der Männerwelt in ihrem Videoclip zu „Diddle My Skiddle“ entgegentritt, wie sie männliche Gebärdensprache parodiert und mit welchen technischen sowie Mitteln sie dies wirkungsvoll erreicht und umsetzt. Ausgehend von diesem Wissenstand möchte ich der Frage nachgehen, ob diese Art der Video-Performance eine offene Kritik an bestehende Wertesysteme der westlichen Gesellschaften ist, ob es sich um ein künstlich geschaffenes Produkt der Musikindustrie handelt, dass mit Hilfe der visuellen, sexuellen Provokation positive Verkaufszahlen schreiben möchte oder ob es sich bei diesem Musikvideo um eine besondere, vielleicht schon künstlerische Art handelt, konventionelle Themen darzulegen, zu thematisieren und auszudrücken.
1. Klassifizierung von Musikvideos
Musikvideos, die in narrative-, semi- narrative-, performance- oder in Art-Clip zu kategorisieren sind, decken nach Springsklee (Rötter 2000) heutzutage die gängigen Musikvideofelder ab - den Mainstream. Das zur Analyse vorliegende Video von Peaches ist jedoch nicht eindeutig diesen Kategorien zu zuordnen, da es sich weder um eine reine Darstellung der Musikerin in Ausübung ihrer Tätigkeit noch um einen Artclip handelt, der Gestaltungselemente aus dem Bereich der Kunst aufgreift. Ebenso ist die Zuordnung in die Bereiche narrativ und seminarrativ nicht eindeutig, da es sich hier nicht um eine reine Erzählung handelt, in der Bildfolgen eine Kurzgeschichte oder Story beschreiben, noch um eine Mischform aus der im Clip vorhanden Performance der Musiker und der peripheren Filmeinblendungen, die einen Textbezug zu einer Geschichte herstellen. Ute Bechdolf beschreibt in einem Aufsatz (Bechdolf 1997) weitere Unterscheidungsmerkmale von Musikvideos, sogenannte Repräsentationsstrategien.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Klassifizierung von Musikvideos
- Visuelle Ebene
- Traditionelle Inszenierung oder neue Form der Stilisierung
- Das Intro
- Der Hauptteil
- Das Outro
- Technische Umsetzung – der Rahmen, der Schnitt, die Dynamik
- Der Rahmen
- Der Schnitt und die Dynamik
- Auditive Ebene
- Text, Töne und Geräusche – der perfekte Minimalismus
- Interpretation - Text und Bild
- Weiterführende Überlegungen
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Analyse des Musikvideos „Diddle My Skiddle“ von Peaches zielt darauf ab, verschiedene relevante Kriterien zu untersuchen und auf ihre Anwendbarkeit in Bezug auf das Video anzuwenden. Der Fokus liegt dabei auf der visuellen, semantischen und auditiven Ebene sowie auf der im Videoclip enthaltenen Geschlechterkonstruktion. Die Analyse soll aufzeigen, wie Merril Nisker alias Peaches in ihrem Video die bestehende patriarchale, sexuelle Hegemonie der Männerwelt untergräbt, männliche Gebärdensprache parodiert und dies mit technischen Mitteln effektiv umsetzt. Schließlich wird die Frage gestellt, ob diese Video-Performance eine offene Kritik an bestehenden Wertesystemen der westlichen Gesellschaften darstellt, ein Produkt der Musikindustrie ist, das durch visuelle und sexuelle Provokation positive Verkaufszahlen erzielen möchte, oder eine besondere, vielleicht sogar künstlerische Art, konventionelle Themen darzulegen, zu thematisieren und auszudrücken.
- Analyse der visuellen, semantischen und auditiven Ebenen des Musikvideos
- Untersuchung der Geschlechterkonstruktion im Videoclip
- Deutung der Parodiefunktion in Bezug auf männliche Gebärdensprache
- Bewertung der Video-Performance im Kontext von gesellschaftlichen Wertesystemen
- Diskussion der möglichen Intentionen von Peaches im Hinblick auf Kunst und Kommerz
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die zentralen Themen der Analyse und den Fokus auf die visuelle, semantische, auditive Ebene sowie die Geschlechterkonstruktion im Videoclip vor. Es wird angekündigt, dass die Analyse die Strategie von Peaches, der patriarchalen, sexuellen Hegemonie der Männerwelt entgegenzutreten, beleuchtet.
- Klassifizierung von Musikvideos: Dieses Kapitel diskutiert gängige Kategorien von Musikvideos (narrativ, semi-narrativ, performance, Art-Clip) und argumentiert, dass Peaches' Video nicht eindeutig einer dieser Kategorien zuzuordnen ist. Es werden außerdem weitere Unterscheidungsmerkmale von Musikvideos, sogenannte Repräsentationsstrategien, vorgestellt.
- Visuelle Ebene: Dieses Kapitel beginnt mit einer kurzen Einordnung des Songs „Diddle My Skiddle“ und seiner kontroversen Rezeption. Der Fokus liegt auf der Aufteilung des Videos in Intro, Hauptteil und Outro.
- Das Intro: Das Intro wird als „Groß-Aufnahme“ beschrieben, die Neugierde und Spannung erzeugt.
- Der Hauptteil: Der Hauptteil des Videos beginnt mit dem Einsetzen der Kugeln, die als zentrales Element betrachtet werden. Die Analyse fokussiert sich auf die Interaktion von Peaches mit den Kugeln und deren symbolische Bedeutung im Kontext von traditionellem Geschlechterbild.
Schlüsselwörter
Die Analyse konzentriert sich auf Themen wie Musikvideoanalyse, Geschlechterkonstruktion, Dekonstruktion von Weiblichkeit, visuelle Ebene, auditive Ebene, Geschlechterdarstellung, sexuelle Hegemonie, Parodie, technische Umsetzung und Interpretation im Kontext des Musikvideos „Diddle My Skiddle“ von Peaches.
- Quote paper
- Oliver Dören (Author), 2004, Peaches - Videoclipanalyse zu "Diddle my Skiddle", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/22903