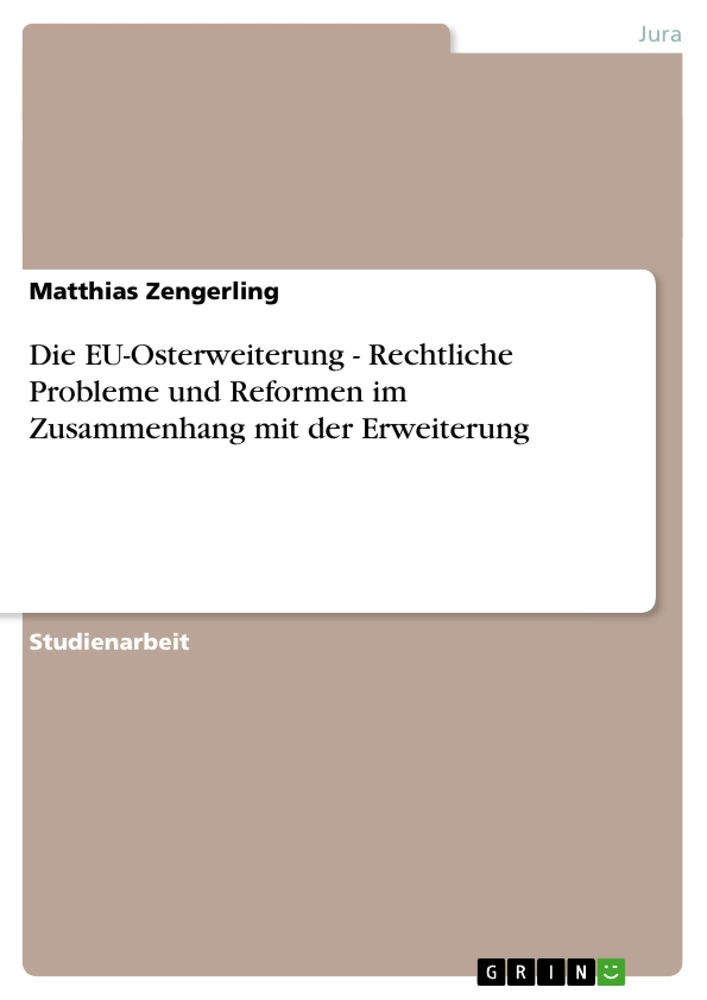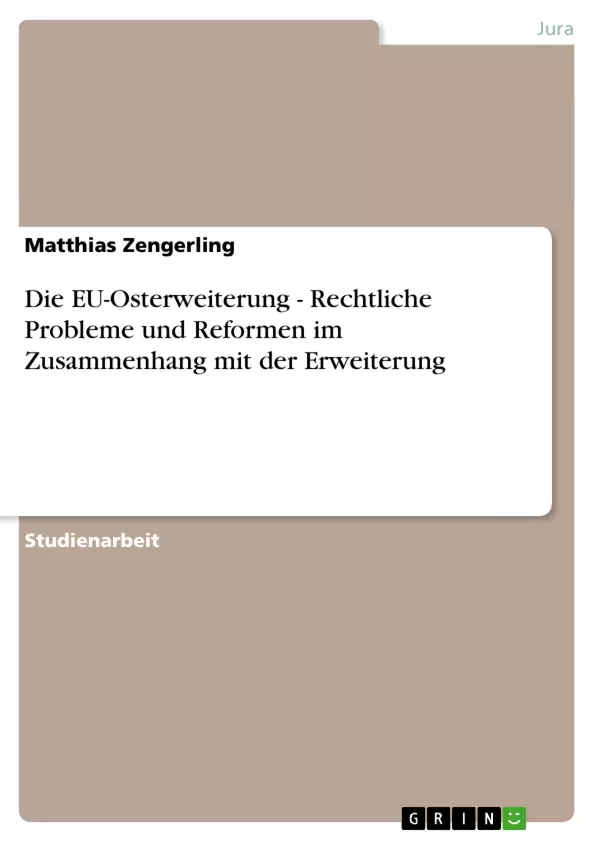Seit ihrer Gründung Anfang der fünfziger Jahre hat die Europäische Union (EU) ständige Erweiterungsrunden erfahren.
Insgesamt vier Mal, mit dem Beitritt der DDR zur BRD fünf Mal, traten Staaten der EU bei, so dass sich heute 15 europäische Staaten an diesem Bündnis beteiligen.
1952 unterzeichneten die damalige BRD, Frankreich, Italien, Belgien, Niederlande und Luxemburg den Vertrag über die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS). 1973 wurden Dänemark, Irland und das Vereinigte Königreich Mitglieder der Europäischen Gemeinschaft (EG). Griechenland trat 1981, Portugal und Spanien 1986 bei. 1990 wurde die DDR durch den Beitritt zur BRD automatisch in die EG eingegliedert. Mit der Unterzeichnung der Verträge von Maastricht im Jahre 1992 wurde die EG in die EU umgewandelt. 1995 wurden Österreich, Schweden und Finnland Mitglied der EU.
Die zukünftige Osterweiterung der EU ist mit diesen früheren Erweiterungsrunden jedoch kaum zu vergleichen. Hier geht es um die Aufnahme von Ländern, die über ein halbes Jahrhundert von Westeuropa getrennt, und über diesen langen historischen Zeitraum eine gänzlich andere Geschichte erfahren haben. Die früher in diesen Ländern herrschenden politischen und wirtschaftlichen Gesellschaftsordnungen hinterließen eine Menge von gesellschaftlichen Problemen, die nur durch eine Vielzahl von Reformen innerhalb dieser Länder gelöst wurden. So wurde für diese Länder ein eventueller Beitritt zur EU ermöglicht.
Auch die Dimension des Beitrittes ist mit den vorigen Erweiterungsrunden nicht vergleichbar, da sich durch den Beitritt von Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern zum 01.05.2004 die EU von bisher 15 Mitgliedsstaaten auf dann 25 Mitgliedsstaaten vergrößern wird.
Die Beitrittsverhandlungen mit diesen Ländern hat der Europäische Rat am 13.12.2002 in Kopenhagen abgeschlossen. Die Europäische Kommission (EK) stimmte den Beitrittsanträgen der Länder am 19.02.03 zu, genau wie das Europäische Parlament (EP). Daraufhin stimmte der Rat der Europäischen Union (REU) den Anträgen zu, so dass am 16.04.2003 der Beitrittsvertrag (VvA) von den Staats- und Regierungschefs der 15 Mitglieds- und 10 Beitrittsstaaten in Athen unterzeichnet wurde. Dieser Vertrag musste von allen 15 Mitgliedsstaaten und 10 Beitrittsstaaten ratifiziert werden, damit er in Kraft treten konnte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Probleme und Reformen im Zusammenhang mit der Erweiterung
- Die Institutionen
- Das Europäische Parlament
- Der Rat der Europäischen Union
- Die Europäische Kommission
- Die Europäische Zentralbank
- Der Europäische Gerichtshof
- Die Ausschüsse
- Der Ausschuss der Regionen
- Der Wirtschafts- und Sozialausschuss
- Der Finanzhaushalt
- Die Strukturförderung
- Die Agrarförderung
- Sicherheitspolitik im Rahmen des Schengen-Abkommens sowie Personenfreizügigkeit innerhalb der EU
- Die Institutionen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die rechtlichen Probleme und Reformen im Zusammenhang mit der Erweiterung der Europäischen Union. Sie untersucht insbesondere die Auswirkungen der Erweiterung auf die Institutionen, den Finanzhaushalt und die Sicherheitspolitik der EU.
- Die Herausforderungen der EU-Erweiterung
- Die Auswirkungen der Erweiterung auf die EU-Institutionen
- Die Reform des Finanzhaushalts der EU
- Die Sicherheitspolitik im Rahmen des Schengen-Abkommens
- Die Personenfreizügigkeit innerhalb der EU
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas "Erweiterung der Europäischen Union" dar und skizziert die Schwerpunkte der Seminararbeit.
Der zweite Teil der Arbeit befasst sich mit den Problemen und Reformen im Zusammenhang mit der Erweiterung. Dabei werden die Auswirkungen der Erweiterung auf die EU-Institutionen, insbesondere das Europäische Parlament, den Rat der Europäischen Union, die Europäische Kommission, die Europäische Zentralbank, den Europäischen Gerichtshof und die Ausschüsse, beleuchtet. Weiterhin wird der Finanzhaushalt der EU im Kontext der Erweiterung analysiert, einschließlich der Strukturförderung und der Agrarförderung.
Im dritten Kapitel werden die Sicherheitspolitik im Rahmen des Schengen-Abkommens sowie die Personenfreizügigkeit innerhalb der EU im Kontext der Erweiterung behandelt.
Schlüsselwörter
EU-Erweiterung, Institutionen, Finanzhaushalt, Sicherheitspolitik, Schengen-Abkommen, Personenfreizügigkeit, Strukturförderung, Agrarförderung, Rechtliche Probleme, Reformen.
- Arbeit zitieren
- Diplom-Finanzwirt (FH) Matthias Zengerling (Autor:in), 2003, Die EU-Osterweiterung - Rechtliche Probleme und Reformen im Zusammenhang mit der Erweiterung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/22158