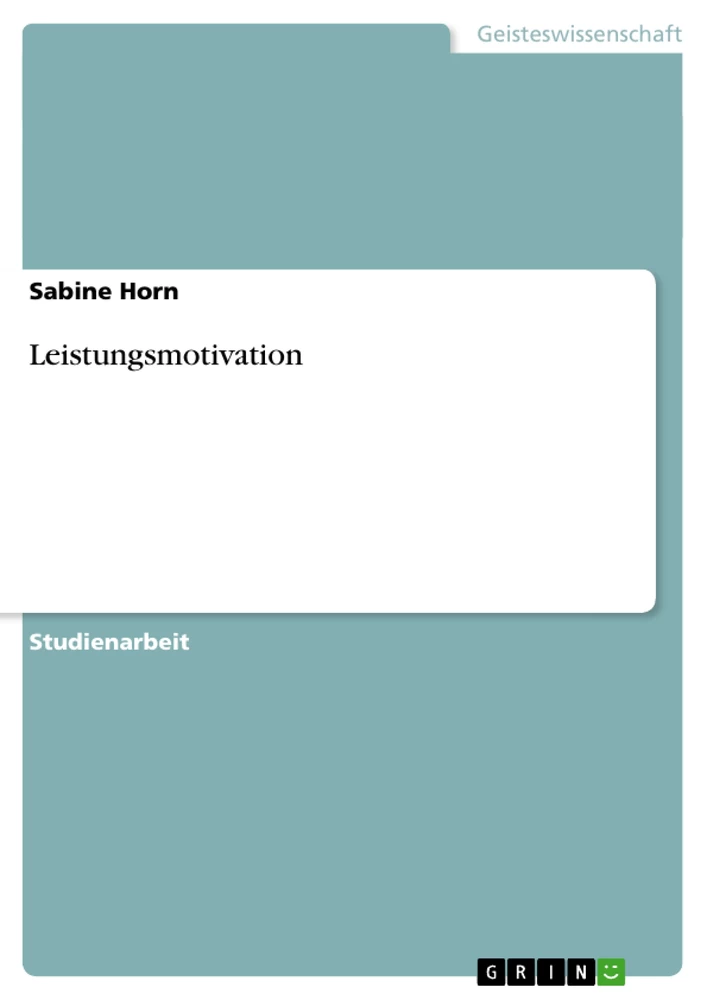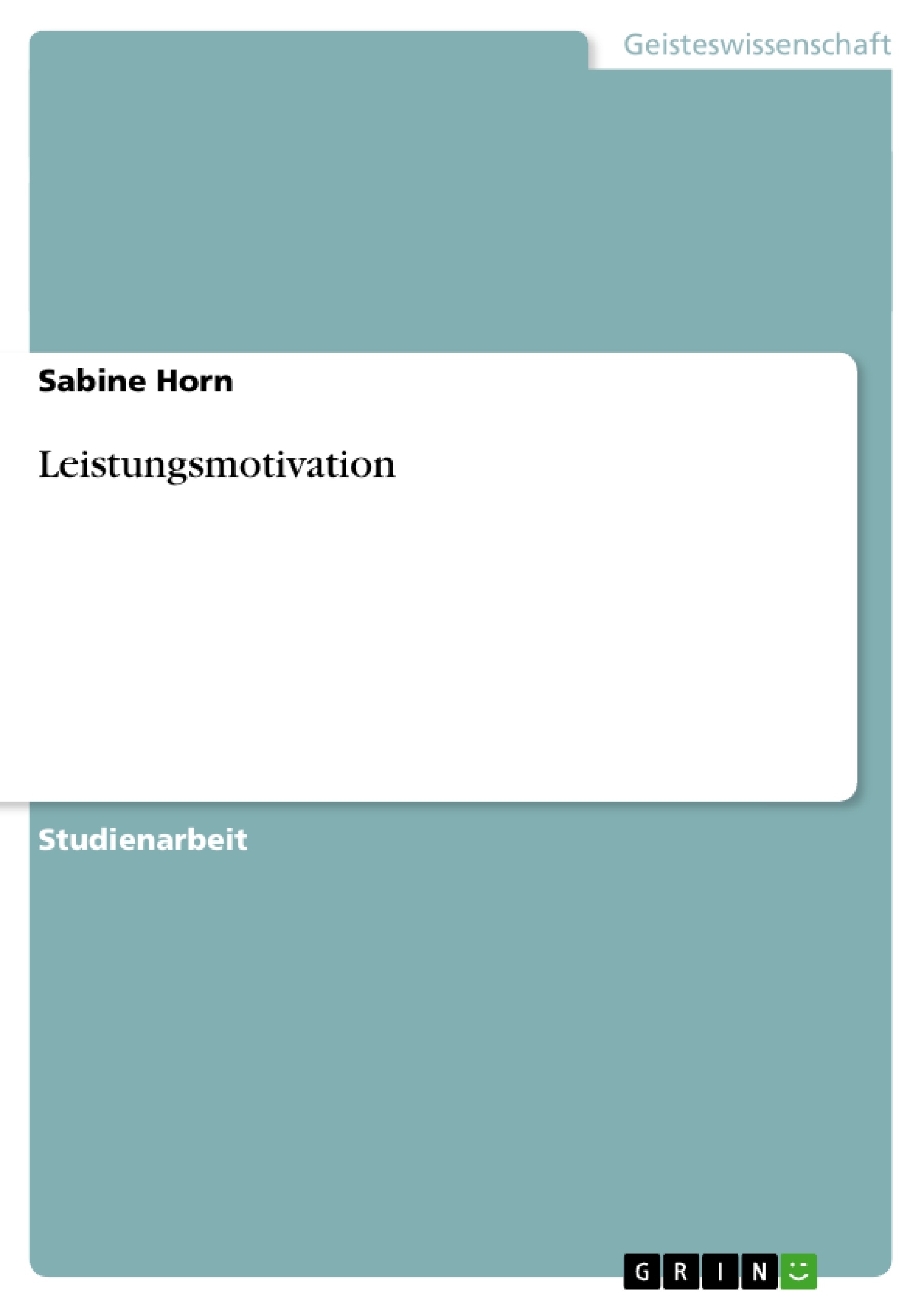Leistungsmotivation ist ein Begriff, der unzählig viele Fragen offen hält. Einige
davon sind wissenschaftlich schon weit erforscht, andere fast gar nicht. Allein bei
dem Begriff der Motivation, stellt sich doch schon die Frage: Wo kommt sie her?
Warum stehen wir morgens auf? Warum essen und trinken wir? Welche Motive
führen manche Menschen zur Magersucht? Schließlich wird dieses Ziel durch
ganz bewusste Handlungen und strenger Kontrolle der Nahrungsaufnahme
erreicht. Warum gehen wir einer bestimmten Freizeitbeschäftigung nach? Die
Motivation finden wir in allen Lebensbereichen, da sie unser innerer Antrieb ist,
der dazu führt, dass wir überhaupt irgendetwas tun. Uns interessiert jetzt der
Bereich der Leistungsmotivation, beziehungsweise welche Beweggründe der
Mensch hat bestimmte Leistungen zu erbringen. Für die Forschung sind dabei
Themen relevant wie zum Beispiel Wahlentscheidungen zwischen verschiedenen
Schwierigkeitsgraden, das Anspruchsniveau verschiedener Menschen, ihre
Ausdauer in Leistungssituationen, die Leistungseffizienz, die Wirkung von
Anstrengung auf die Leistung, unterschiedliche Schulleistungen, die Orientierung
an gesellschaftlichen Bezugsnormen und vieles mehr. In dieser Arbeit werden
jetzt einige Aspekte herausgegriffen, die uns die Grundzüge der Leistungsmotivationsforschung
verstehen lassen, unter anderen das Risiko-Wahl-Modell, die
Anspruchsniveausetzung und die Ausdauer. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf
der Wahlentscheidungstheorie von Atkinson, die die beiden Motive, Misserfolg
zu meiden und Erfolg aufzusuchen, integriert und differenziert.
Gliederung:
1 Einleitung
2 Definition einiger wichtiger Begriffe
2.1 Der Begriff des Motivs
2.2 Der Begriff der Motivation
2.3 Der Begriff der Leistung
2.4 Der Begriff der Leistungsmotivation
3 Verfahren zur Messung der Leistungsmotivation
3.1 Der Thematische Apperzeptionstest (TAT)
3.2 French Test of Insight (FTI)
3.3 Test Anxiety Questionaire (TAQ)
4 Das Risiko-Wahl-Modell zur Vorhersage von Wahlentscheidungen in Leistungssituationen
4.1 Lewins Verhaltensmodell als Gedankenanstoß
4.1.1 Das Personenmodell
4.1.2 Das Umweltmodell
4.2 Atkinsons Risiko-Wahl-Modell
4.2.1 Erfolgs- und Misserfolgsmotiv
4.2.2 Die Tendenz Erfolg anzustreben und ihre Wirkung auf das Leistungs- verhalten
4.2.3 Die Tendenz Misserfolg zu meiden und ihre Wirkung auf das Leistungs- verhalten
4.2.4 Die resultierende Tendenz
4.2.5 Ableitbare Hypothesen für die Aufgabenwahl
4.2.6 Überprüfung dieser Hypothesen durch Atkinson & Litwin (1960)
4.2.7 Kritik zum Risiko-Wahl-Modell
5 Auswirkungen von Erfolg und Misserfolg auf das Anspruchsniveau
5.1 Typische und atypische Anspruchsniveauverschiebung
6 Wirkung der Erfolgs- und Misserfolgstendenz auf die Ausdauer
6.1 Ausdauer als Dauer der kontinuierlichen Beschäftigung mit einer Aufgabe
6.2 Ausdauer als Wiederaufnahme misslungener oder unterbrochener Aufgaben
6.3 Ausdauer als langfristige Verfolgung eines übergreifenden Zieles
7 Resümee
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Leistungsmotivation ist ein Begriff, der unzählig viele Fragen offen hält. Einige davon sind wissenschaftlich schon weit erforscht, andere fast gar nicht. Allein bei dem Begriff der Motivation, stellt sich doch schon die Frage: Wo kommt sie her? Warum stehen wir morgens auf? Warum essen und trinken wir? Welche Motive führen manche Menschen zur Magersucht? Schließlich wird dieses Ziel durch ganz bewusste Handlungen und strenger Kontrolle der Nahrungsaufnahme erreicht. Warum gehen wir einer bestimmten Freizeitbeschäftigung nach? Die Motivation finden wir in allen Lebensbereichen, da sie unser innerer Antrieb ist, der dazu führt, dass wir überhaupt irgendetwas tun. Uns interessiert jetzt der Bereich der Leistungsmotivation, beziehungsweise welche Beweggründe der Mensch hat bestimmte Leistungen zu erbringen. Für die Forschung sind dabei Themen relevant wie zum Beispiel Wahlentscheidungen zwischen verschiedenen Schwierigkeitsgraden, das Anspruchsniveau verschiedener Menschen, ihre Ausdauer in Leistungssituationen, die Leistungseffizienz, die Wirkung von Anstrengung auf die Leistung, unterschiedliche Schulleistungen, die Orientierung an gesellschaftlichen Bezugsnormen und vieles mehr. In dieser Arbeit werden jetzt einige Aspekte herausgegriffen, die uns die Grundzüge der Leistungsmotiva-tionsforschung verstehen lassen, unter anderen das Risiko-Wahl-Modell, die Anspruchsniveausetzung und die Ausdauer. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Wahlentscheidungstheorie von Atkinson, die die beiden Motive, Misserfolg zu meiden und Erfolg aufzusuchen, integriert und differenziert.
2. Definitionen einiger wichtiger Begriffe
2.1 Der Begriff des Motivs
„Ein Motiv ( vom lateinischen Wort „motivum“ – Beweggrund – abgeleitet) ist ein Antrieb; es ruft Verhalten hervor und gibt ihm Energie und Richtung.“ (At-kinson 2001). Es sind innere Bedürfnisse oder Verhaltensziele, die ähnlich wie Charakterzüge über lange Zeit hinweg stabil bleiben. Die Richtung gibt an, was der Mensch tun möchte, die Energie leitet sich aus dem Grund ab, warum er es tun möchte. Beispielsweise hat ein Abiturient x die dringenden Bedürfnisse, mehr zu lernen, sich weiterzuentwickeln, Neues kennen zu lernen, aus seinem Leben etwas zu machen, einen interessanten Beruf auszuüben und sich selbst zu verwirklichen. Diese Beweggründe geben ihm die Energie ein Studium an der Universität zu absolvieren, womit die Richtung bestimmt wäre.
2.2 Der Begriff der Motivation
„Wird ein Motiv wirksam, so befinden wir uns in einem Zustand der Motiva-tion“ (vgl. Atkinson 2001). Diese Ziele werden aber nur dann in die Realität umge-setzt, wenn in der aktuellen Situation ein Anreiz liegt dies zu tun. Die Motivation besteht also zum Einen aus dem Motiv, dem inneren Antrieb, und zum Anderen aus dem gerade gegebenen Anreiz, die sich beide wechselseitig beeinflussen. Hat der oben genannte hoch leistungsmotivierte Abiturient x also eventuell die Absicht zu studieren, so wird er das wahrscheinlich wirklich tun, wenn er jetzt weiß, dass seine Eltern, Freunde und Bekannte genauso wie er anschließend sehr stolz auf seine Leistung sein können und werden und er, laut aktuellen Statistiken, gute Berufschancen hat. Man kann also sagen, eine Motivation entsteht durch die Bewertung der Handlungsfolgen.
2.3 Der Begriff der Leistung
Leistung bringen heißt etwas zu schaffen bzw. zu tun, woraus andere und / oder der Leistungsträger selbst Nutzen ziehen können, z.B. neue theoretische Kennt-nisse oder praktische Fertigkeiten erlernen, die denjenigen befähigen neue Auf-gaben zu übernehmen, oder etwas für die Firma oder andere herzustellen, oder ein Unternehmen zu leiten, d.h. die Arbeitsabläufe zu planen, zu organisieren oder eine Dienstleistung wie die Pflege älterer bzw. kranker Leute oder die Beratung Hilfesuchender usw..
2.4 Der Begriff der Leistungsmotivation
Die Leistungsmotivation ist die Bewertung der eigenen Tüchtigkeit in der Ausein-andersetzung mit einem Gütemaßstab, einem Anspruchsniveau (vgl. Heckhausen 1989). Dieser Gütemaßstab ist subjektiv, d.h. es geht um die Leistung, die man sich selbst vornimmt. Der Student x hat sich vielleicht vorgenommen besonders gut zu sein, sein Studium in der Regelstudienzeit zu schaffen und einen Abschluss mit dem Notendurchschnitt 1,5 zu machen. Einem anderen Student würde es möglicherweise auch ausreichen, wenn er die Klausuren sowie die Abschluss-prüfungen mit vier besteht, da er dafür ein Minimum an Aufwand betreiben möchte oder aber weil es für ihn persönlich eine sehr gute Leistung wäre.
3. Verfahren zur Messung der Leistungsmotivation
3.1 Der Thematische Apperzeptionstest ( TAT)
Zur Messung der Leistungsmotivation bzw. des Erfolgs- und Misserfolgsmotivs wurden einige projektive Tests entwickelt (vgl. Asendorpf 1999), da man annahm, dass jeder Mensch neben den bewussten auch unbewusste Bedürfnisse hat, die sich nur in Träumen oder Phantasien zeigen. Um diese latenten Bedürfnisse herauszufinden entwickelte Murray den Thematischen Apperzeptionstest ( TAT ), der in Asendorpf 1999 vorgestellt wird. Den Versuchspersonen werden dabei mehrdeutige Bilder gezeigt, zu denen sie kurze Bildbeschreibungen bzw. Geschichten erzählen sollen. Nach einer inhaltsanalytischen Kodierung werden diese dann ausgewertet. Wenn die Versuchsperson über bestimmte Themen gesprochen hat, bekommt sie jeweils einen Punkt. Die Punkte werden pro Motiv zusammengerechnet und dadurch auf ein Motiv rückgeschlossen. Der Gedanke dabei ist, dass die Personen Bedürfnisse, Ziele und Persönlichkeitseigenschaften in die Geschichte einbringen, indem sie sie z.B. auf bestimmte Personen der Erzählung übertragen. Wenn z.B. jemand sagt: „Die Arbeit macht ihm Spaß.“, dann spiegelt das seinen positiven Gefühlszustand wieder, was ein Hinweis auf das Erfolgsmotiv wäre. Der Satz: „Er hofft, dass der Meister den Fehler nicht bemerkt“, so ist das ein Bedürfnis nach Misserfolgsmeidung und somit dem Misserfolgsmotiv zuzuordnen.
Einige wesentliche Kritikpunkte der projektiven Verfahren zur Motivmessung sind die mäßige interne Konsistenz, die mäßige zeitliche Stabilität sowie die unklare Interpretation der Testergebnisse (vgl. Asendorpf 1999). Mit der mäßi-gen internen Konsistenz ist gemeint, dass die Motivwerte verschiedener Bilder zum Teil sehr unterschiedlich sind und nur gering miteinander korrelieren. Man müsste also sehr viele Bilder verwenden um dann im Durchschnitt auf ein bestimmtes Motiv zu schließen. Das ist aber aufgrund des Sättigungseffekts nicht möglich. Wenn die Personen zu viele Bilder zu einem motivationalen Thema bekommen, so wechseln sie das Thema in ihrer Geschichte. Deshalb bekommen sie jeweils nur etwa fünf Bilder. Mäßige zeitliche Stabilität bedeutet, dass bei Testwiederholung nach einiger Zeit teilweise andere Ergebnisse auftreten. D.h., mit diesen Tests lassen sich eher aktuell bedeutsame Themen der Versuchs-personen herausfinden, nicht aber Motive. Eine unklare Interpretation der Tester-gebnisse liegt darin, dass die Themen der Geschichte nicht immer ein projiziertes eigenes Motiv des Erzählers sein müssen. Es könnte auch sein, dass eine Person für ein Thema besonders sensitiv ist, z.B. für Gewalt. Daraus kann man aber nicht schließen, sie würde selbst zu gewalttätigem handeln tendieren.
3.2 French Test of Insight ( FTI )
Dieser ebenfalls projektive Test wurde von Elisabeth French ca. 1955 bis 1958 entwickelt (vgl. Heckhausen 1989). Der Unterschied zum TAT besteht in der Verwendung kurzer Geschichtenanfänge die anstatt der Bilder die Phantasie anregen sollen (z.B. John sagt: „Schau, was ich gemacht habe!“, oder „George meldet sich in der Regel bei schwierigen Aufgaben!“ (Heckhausen 1989)). Die inhaltsanalytische Kodierung für die Auswertung ist die gleiche wie beim TAT. Der FTI kommt dann zum Einsatz, wenn der Untersucher es für notwendig hält die bildliche Anregung durch die sprachliche zu ersetzen.
3.3 Test Anxiety Questionaire ( TAQ )
In der amerikanischen Motivationsforschung werden zur Bestimmung des Miss-erfolgsmotivs Ängstlichkeitsfragebogen herangezogen (vgl. Heckhausen 1989), meist zur Prüfungsangst ( TAQ ). Diesen stellten Mandler & Cowen 1958 vor. In dem Fragebogen müssen Sätze wie z.B. „In Prüfungssituationen bin ich nervös.“ mit stimmt, stimmt manchmal, …, oder stimmt nicht bewertet werden. Die Antworten, die man auf diese Weise erhält, können aber keine Motivtenden-zen erfassen, sondern nur Verhaltenssymptome, die die Versuchspersonen bei sich selbst wahrgenommen haben, als sie sich in entsprechenden Situationen befanden. Zwischen den Kennwerten des projektiven Verfahrens TAT und des Fragebogens TAQ gibt es keinerlei Zusammenhänge.
4. Das Risiko-Wahl-Modell zur Vorhersage von Wahlentscheidungen in Leis-tungssituationen
4.1 Lewins Verhaltensmodell als Gedankenanstoß
Nach Lewins Feldtheorie kann man Verhaltensweisen erklären, wenn man die gesamten Bedingungen der gegenwärtigen Situation und des Umfeldes der Person, sowie die Person selbst mit einbezieht (vgl. Heckhausen 1989). Sie beeinflussen sich wechselseitig und man kann sie nicht isoliert voneinander betrachten. „Der Begriff des Feldes umfasst Bedingungsfaktoren sowohl der „äußeren“ Situation ( der Umgebung ) wie der „inneren“ Situation ( der Person ).“
[...]
- Quote paper
- Sabine Horn (Author), 2003, Leistungsmotivation, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/21992