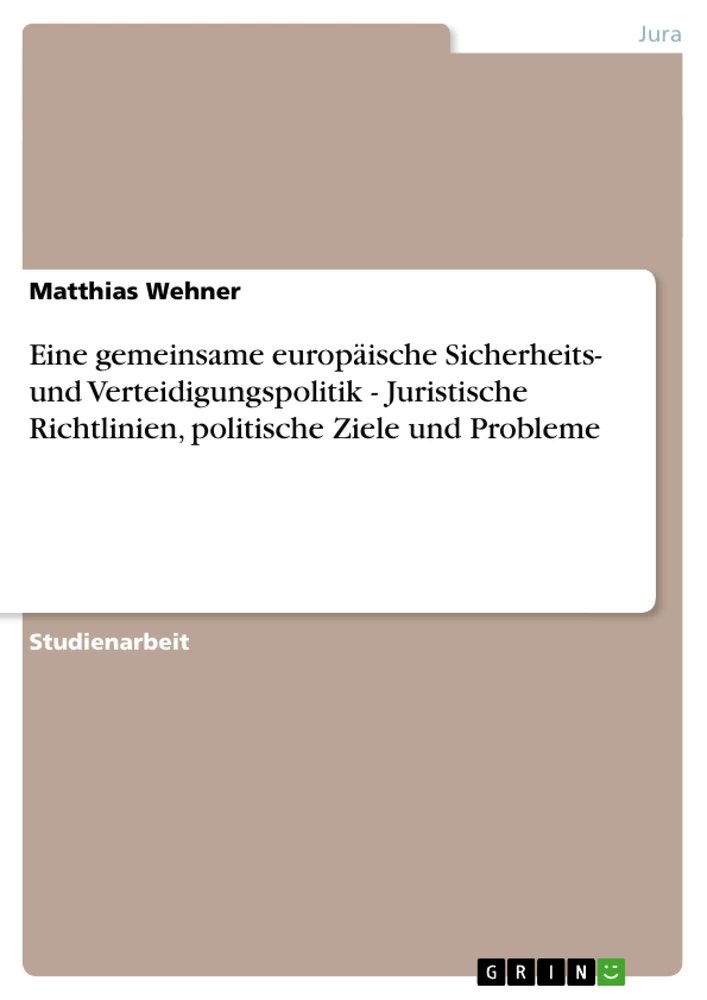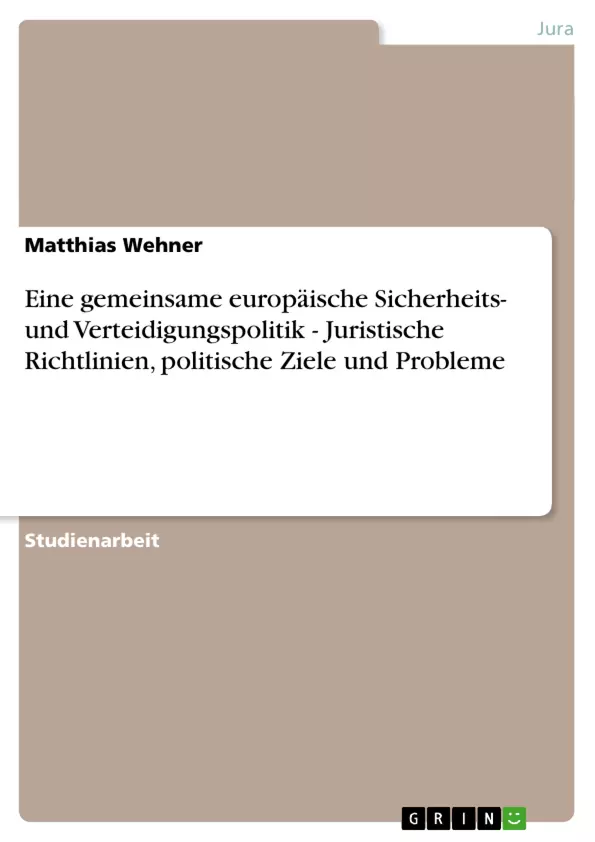Der Gedanke einer gemeinsamen europäischen Verteidigungspolitik, einer gemeinsamen europäischen Verteidigungsgemeinschaft, die in einer übernationalen europäischen Verteidigung ihren Höhepunkt finden soll, ist relativ alt. Doch noch nie war die Notwendigkeit ihrer Umsetzung so groß wie in den letzten Jahren, hat doch der Balkankonflikt 1999 die relative Handlungsunfähigkeit der Union in militärischer, aber auch nicht - militärischer Hinsicht im Sinne eines "Anti - Krisen - Managements" in blutiger Weise vor Augen geführt.
Noch nie ist in der Geschichte Europas dieser Gedanke mit einem solchen Elan vorangetrieben worden, wie es seit der Geburtsstunde der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik ( ESVP ), initiiert vom Europäischen Rat in Köln am 3./4. Juni 1999, geschieht. Viele Ziele sind auf den Nachfolgetreffen definiert worden, mit deren Auseinandersetzung ein Schwerpunkt dieser Arbeit gesetzt werden soll. Letztlich bleibt aber bereits von vornherein festzuhalten, dass sich die praktische Umsetzung dieser Ziele schon alleine durch die unterschiedlichen Rollenverteilungen der großen europäischen Nationalstaaten als eine mehr als anspruchsvolle Aufgabe erweisen wird.
Ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit liegt in der Beantwortung der Frage, welche Aufgaben einer gemeinsamen Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, in der Hauptsache resultierend aus dem Vertrag von Nizza ( 2000 ) zu teil werden sollen und welche wichtigen politischen Ziele und Hoffnungen damit verbunden sind. Unabdingbar ist dabei die Betrachtung der juristischen Grundlagen, z.B. in Form des Artikel 17 des Vertrages über die Europäische Union, um in Erfahrung zu bringen, wie sie sich auf diese Bestrebungen auswirken und welche Kompetenzen und Institutionen sie der ESVP zuweisen.
Auf mögliche Problemstellungen im Zusammenhang mit der europäischen Sicherheits - und Verteidigungspolitik, Gedanken zur geplanten Europäischen Verteidigungsunion sowie auf die Frage, welche Stellung die ESVP neben der NATO einnimmt bzw. einnehmen kann, wird am Ende dieser Arbeit eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Notwendigkeitsbegründung für eine ESVP
- Geschichtliche Hintergründe 1945 - 1999
- Die Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG )
- Die Westeuropäische Union. (WEU)
- Die Europäische Verteidigungsidentität ( ESVI)
- Die rechtlichen Grundlagen der ESVP
- Die Vertragswerke
- Die Bedeutung des Art. 17 EUV in der Fassung von Nizza
- Die Sicherheit der Union und die gemeinsame Verteidigungspolitik
- Respekt vor nationaler Ausrichtung der Politik in Hinblick auf Sicherheit und Verteidigung
- Regelungen über die „, Petersberg - Aufgaben“
- Beschlussfassung in der EU – Verteidigungspolitik
- Die,, Revisions – Klausel“
- Politische Zielsetzungen der ESVP
- Stärkung der Unionseigenen Handlungsfähigkeit
- Entlastung der NATO und der Vereinigten Staaten
- Förderung der Integration
- Terrorismusbekämpfung insbesondere nach dem 11.09.2003
- Die ESVP
- Stellung der ESVP innerhalb der GASP und ihre Organe
- Das Politische Komitee (PSK)
- Der Militärausschuss
- Der Hohe Vertreter des Rates/ der GASP
- Die ESVP und die NATO
- Der Gedanke einer Europäischen Verteidigungsunion ( ESVU )
- Stellung der ESVP innerhalb der GASP und ihre Organe
- Probleme der ESVP
- Osterweiterung 2004
- Der finanzielle Aspekt
- Nationale Interessen
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Thema einer gemeinsamen europäischen Verteidigungspolitik. Die Arbeit analysiert die Notwendigkeit einer solchen Politik, untersucht deren geschichtliche Entwicklung und die rechtlichen Grundlagen, beleuchtet politische Zielsetzungen und diskutiert die Herausforderungen, die mit ihrer Implementierung verbunden sind.
- Die Notwendigkeit einer gemeinsamen europäischen Verteidigungspolitik
- Die historischen Hintergründe und Entwicklungsschritte
- Die rechtlichen Grundlagen und Institutionen der ESVP
- Politische Ziele und Erwartungen
- Herausforderungen und Probleme im Kontext der ESVP
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung verdeutlicht die Aktualität und Bedeutung einer gemeinsamen europäischen Verteidigungspolitik im Kontext der europäischen Sicherheitslandschaft. Kapitel 2 analysiert die Gründe, die eine solche Politik notwendig machen, insbesondere im Hinblick auf die Herausforderungen nach dem Ende des Kalten Krieges.
Kapitel 3 beleuchtet die historischen Hintergründe der europäischen Verteidigungspolitik, indem es auf die Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG), die Westeuropäische Union (WEU) und die Europäische Verteidigungsidentität (ESVI) eingeht.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit den rechtlichen Grundlagen der ESVP, insbesondere mit der Bedeutung des Artikels 17 EUV in der Fassung von Nizza.
Kapitel 5 fokussiert auf die politischen Zielsetzungen der ESVP, wie die Stärkung der europäischen Handlungsfähigkeit, die Entlastung der NATO und die Förderung der europäischen Integration.
Kapitel 6 analysiert die Stellung der ESVP innerhalb der GASP und ihre Organe, die Beziehung zur NATO und den Gedanken einer Europäischen Verteidigungsunion.
Kapitel 7 beleuchtet verschiedene Probleme der ESVP, darunter die Osterweiterung 2004, den finanziellen Aspekt und nationale Interessen.
Schlüsselwörter
Gemeinsame europäische Verteidigungspolitik, ESVP, GASP, NATO, EU, Artikel 17 EUV, Petersberg Aufgaben, Sicherheit, Verteidigung, Integration, Handlungsfähigkeit, Probleme, Herausforderungen, Historische Entwicklung, Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG), Westeuropäische Union (WEU), Europäische Verteidigungsidentität (ESVI), Osterweiterung, Finanzielle Aspekte, Nationale Interessen. ¹
- Arbeit zitieren
- Matthias Wehner (Autor:in), 2003, Eine gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik - Juristische Richtlinien, politische Ziele und Probleme, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/21897