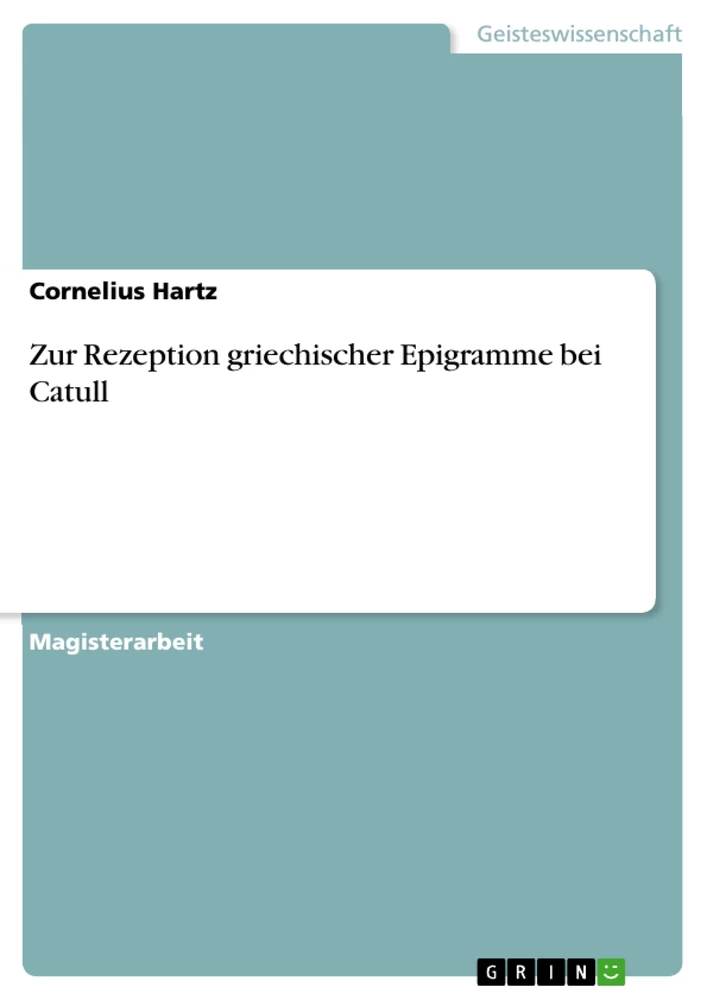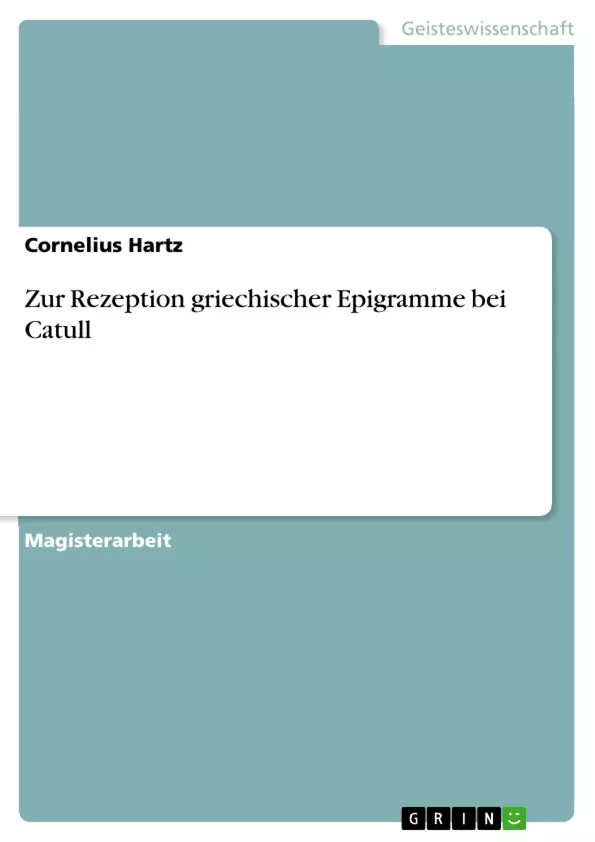Die Gedichte des C. Valerius Catullus nehmen in der römischen Lyrik eine Sonderstellung ein. Sie werden in der Forschung meist als Beginn einer neuen Epoche in der römischen Literatur angesehen, der Entwicklung einer Lyrik, die persönliche Gefühle ausdrückt. Im Zuge dessen wird oft Catulls ,,Unmittelbarkeit"1 herausgestellt, allerdings oft mit der Einschränkung, sein Werk zerfalle ,,in ,spontane′ kleine Gedichte und schwer zugängliche alexandrinische Kunstgedichte". Die ,,spontanen" Gedichte haben sogar dazu geführt, in Catulls Dichtung eine Parallele zur Entwicklung der Lyrik im 20. Jahrhundert zu sehen, wie Quinn es in ,,The Catullan Revolution" getan hat. Darüber hinaus hat die singuläre Stellung, die Catull in seiner Epoche in der römischen Dichtung inne zu haben scheint, oft einen Genie-Gedanken genährt, wie beispielsweise Havelock ihn in ,,The Lyric Genius of Catullus" programmatisch vertritt.
Mit solchen Analogien und Bewertungen Catulls ist jedoch vorsichtig umzugehen. Es gibt keinen Dichter der Antike, der einen ähnlichen Bekanntheitsgrad genießt, über den aber gleichzeitig so wenig biographische Fakten überliefert sind und dessen Werk in vergleichbar schlechter Weise überliefert ist. Die gesamte moderne Überlieferung Catulls entstammt einem einzigen Codex aus dem 13. Jh., und von den wenigen überlieferten Lebensdaten sind einige widersprüchlich oder ohne sichere Autorität.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Selbstverständnis der poetae novi
- 3. Das hellenistische Kunstprinzip in Rom vor Catull
- 3.1 Entwicklung der hellenistischen Literatur
- 3.2 Das hellenistische Epigramm
- 3.2.1 Entwicklung des griechischen Epigramms bis zum ersten Jahrhundert v. Chr.
- 3.2.2 Stilistische Merkmale des hellenistischen Epigramms
- 3.2.3 Analyse von Kallimachos ep. 41
- 3.3 Einfluss der hellenistischen Literatur in Rom
- 4. Einflüsse griechischer Literatur in Catull außerhalb der Epigramme
- 4.1 Vorbemerkung: Verschiedene Ansätze zur Unterteilung des Catulli liber
- 4.2 Lange Gedichte
- 4.3 Polymetra
- 5. Einflüsse hellenistischer Epigramme in Catulls Epigrammen
- 5.1 Hellenistische Epigramme als direkte Vorbilder
- 5.1.1 Kallimachos ep. 25 und Catullus c. 70
- 5.1.2 Kallimachos ep. 30 und Catull c. 80
- 5.2 Allgemeine und indirekte Einflüsse hellenistischer Epigramme
- 5.2.1 Analyse von Catull c. 78
- 5.2.2 Analyse von Catull c. 85
- 5.2.3 Analyse von Catull c. 77
- 5.1 Hellenistische Epigramme als direkte Vorbilder
- 6. Catulls dichterisches Selbstverständnis im Kontext der Epigramm-Rezeption
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Rezeption griechischer Epigramme im Werk des römischen Lyrikers Catull. Sie analysiert den Einfluss hellenistischer Epigramme auf Catulls eigene Gedichte und beleuchtet das Selbstverständnis des Dichters im Kontext seiner Rezeption griechischer Traditionen.
- Die Bedeutung der "poetae novi" für die Entwicklung der römischen Lyrik
- Die Rolle des hellenistischen Kunstprinzips in der römischen Literatur vor Catull
- Die Rezeption griechischer Epigramme in Catulls Werk
- Die Analyse von Catulls Selbstverständnis als Dichter im Lichte der Epigrammtradition
- Die "Unmittelbarkeit" von Catulls Dichtung im Kontext seiner literarischen Vorbilder
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einführung in die Persönlichkeit und das Werk Catulls und beleuchtet die besonderen Herausforderungen, die sich aus der spärlichen Quellenlage ergeben. Im zweiten Kapitel wird das Selbstverständnis der "poetae novi", zu denen auch Catull zählt, untersucht und der Einfluss hellenistischer Literaturelemente auf ihre poetischen Ziele hervorgehoben. Das dritte Kapitel analysiert die Verbreitung des hellenistischen Kunstprinzips in Rom vor Catull, wobei die Entwicklung des griechischen Epigramms und der Einfluss von Kallimachos besonders hervorgehoben werden. In Kapitel 4 werden Einflüsse griechischer Literatur in Catulls Werk außerhalb der Epigramme betrachtet, während das fünfte Kapitel sich mit der Rezeption hellenistischer Epigramme in Catulls eigenen Epigrammen beschäftigt. Dabei werden sowohl direkte als auch indirekte Einflüsse anhand konkreter Beispiele analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Rezeption griechischer Epigramme im Werk Catulls, wobei die Rolle des hellenistischen Kunstprinzips, die "poetae novi" und die Analyse von Catulls Selbstverständnis als Dichter im Kontext der Epigrammtradition im Vordergrund stehen.
- Quote paper
- Cornelius Hartz (Author), 2001, Zur Rezeption griechischer Epigramme bei Catull, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/2185