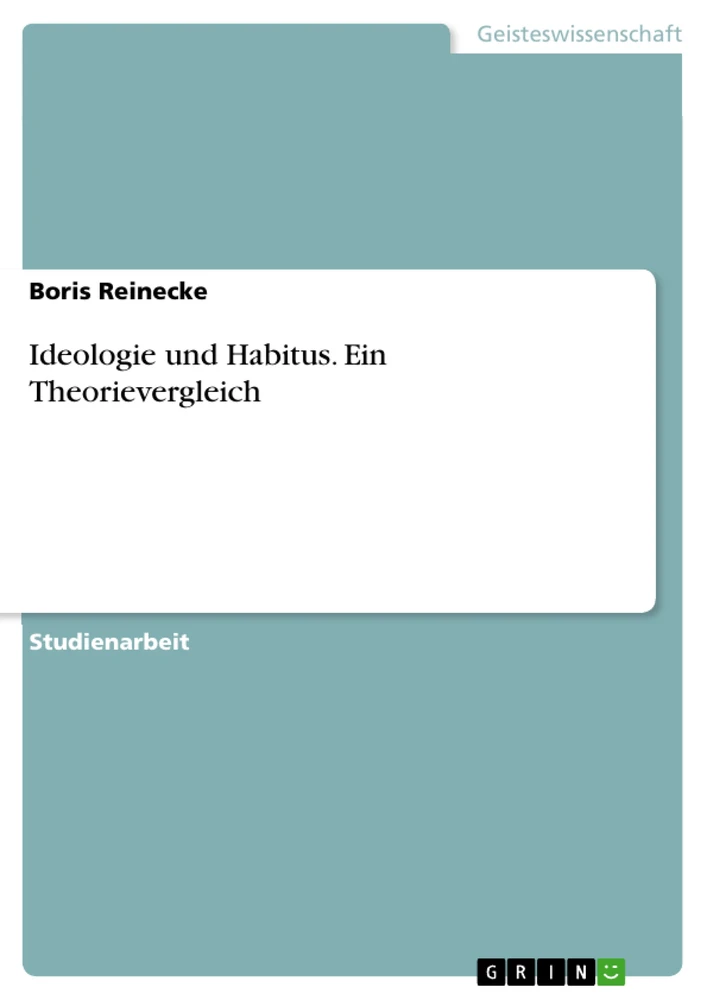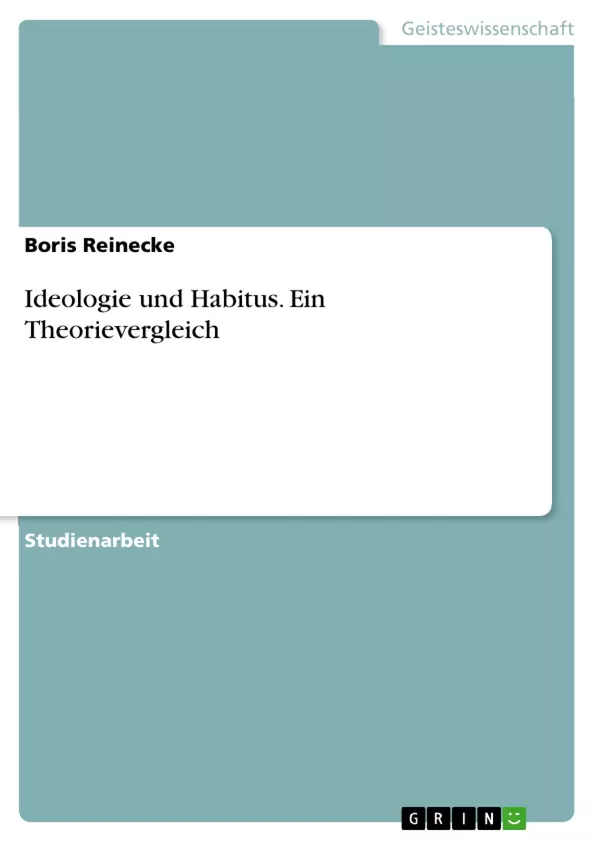Soll es um Wissenssoziologie gehen, so drängt sich zuallererst das soziologische Standardwerk von Berger und Luckmann über die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit auf, das wohl wie keine zweite Arbeit zu erklären versuchte, wie Alltagswissen gesellschaftlich produziert und reproduziert wird (vgl. Berger und Luckmann 1980). Jedoch soll das kein Ende der Theorieentwicklung bedeuten und den Blick auf ältere oder neuere theoretische Ansätze versperren. Daher sei in dieser Arbeit der Fokus auf einen Theorieentwurf gerichtet, der lange vor Berger und Luckmanns Werk entstand, sowie auf einen der erst später das Licht der Welt erblickte. Beide Ansätze haben allerdings gemeinsam, sich nicht als explizit wissenssoziologische Theorien zu verstehen: Bei Marx und Engels heißt unser Gegenstand Ideologie oder Bewusstsein, bei Pierre Bourdieu ist Wissen einerseits in den Begriff des kulturellen Kapitals, andererseits in den des Habitus eingeflochten. Es liegt auf der Hand, dass Wissen nicht gleich Wissen ist: Es kann sich um wissenschaftlich hergestelltes Wissen handeln, das methodisch kontrolliert hergestellt und evaluiert wird, oder um Alltagswissen, das sich dadurch legitimiert, dass es Handlungsfähigkeit erzeugt oder bewahrt. Es kann die Rede sein von explizitem Wissen, das den wissenden Subjekten auch als solches entgegensteht, aber auch implizitem Wissen, das alltäglich angewendet und produziert wird, ohne als solches überhaupt Gegenstand der Reflexion zu werden. Im Rahmen dieser Arbeit soll nun herausgearbeitet werden, welche Wissensformen durch Ideologie und Habitus beschrieben werden, wie sie erklärt werden und worin der theoretische Mehrwert dieser Begriffe liegen kann. Der Bourdieu'sche Kapitalbegriff - und damit auch der des kulturellen Kapitals - wird an dieser Stelle nicht diskutiert, da er unter anderem auf den Habitus rekurriert und im Hinblick auf die Frage nach der Herstellung und Reproduktion von Wissen den Habitusbegriff nicht an Erklärungskraft übertrifft.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Ideologie und Bewusstsein bei Marx und Engels
- 2.1 Kritik am Deutschen Idealismus
- 2.2 Die materielle Basis der gesellschaftlichen Verhältnisse
- 2.3 Der Ideologiebegriff . . .
- 2.4 Die wissenssoziologische Bedeutung
- 3 Pierre Bourdieus Habituskonzept
- 3.1 Der Habitusbegriff .
- 3.2 Der Wissenssoziologische Aspekt des Habituskonzeptes
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage, wie Wissen in unterschiedlichen soziologischen Theorien verstanden wird. Im Fokus stehen die Konzepte von Ideologie und Bewusstsein bei Karl Marx und Friedrich Engels sowie das Habituskonzept von Pierre Bourdieu. Ziel ist es, die jeweiligen Wissensformen, ihre Erklärungen und den theoretischen Mehrwert der beiden Ansätze herauszuarbeiten.
- Kritik am Deutschen Idealismus und die Rolle des Bewusstseins
- Materielle Bedingungen der Produktion und ihre Auswirkungen auf gesellschaftliche Verhältnisse
- Der Ideologiebegriff als Instrument zur Erklärung von Wissen und Herrschaft
- Der Habitus als ein Konzept, das die Verbindung zwischen individueller Praxis und sozialen Strukturen erklärt
- Die Bedeutung von Wissen für die soziale Reproduktion und die gesellschaftliche Ordnung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt die beiden zu untersuchenden Theorien - Ideologie und Bewusstsein bei Marx und Engels sowie den Habitus bei Bourdieu - vor. Der Text betont, dass beide Theorien, trotz ihrer unterschiedlichen Entstehungszeit, wichtige Erkenntnisse über die Produktion und Reproduktion von Wissen liefern.
2 Ideologie und Bewusstsein bei Marx und Engels
Dieses Kapitel behandelt die Kritik von Marx und Engels am Deutschen Idealismus und stellt die materiellen Bedingungen der Produktion als Grundlage für gesellschaftliche Verhältnisse dar. Es beleuchtet den Ideologiebegriff und seine Relevanz für die Wissenssoziologie.
2.1 Kritik am Deutschen Idealismus
Dieser Abschnitt fokussiert auf die Kritik von Marx und Engels an der idealistischen Philosophie der Junghegelianer. Sie argumentieren, dass diese Philosophen die Kritik auf die Religion beschränkten und damit die bestehenden Verhältnisse unhinterfragt akzeptierten. Sie fordern stattdessen, die materiellen Grundlagen des Denkens zu untersuchen.
2.2 Die materielle Basis der gesellschaftlichen Verhältnisse
Dieser Abschnitt beleuchtet die zentrale These von Marx und Engels, dass die Produktion der Lebensmittel die Grundlage für die Entwicklung der Gesellschaft ist. Die jeweilige Lebensweise wird durch die materiellen Bedingungen der Produktion beeinflusst und diese wiederum durch den Verkehr der Menschen untereinander und die Arbeitsteilung geprägt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Hausarbeit sind Ideologie, Bewusstsein, Habitus, Wissenssoziologie, Produktion, Reproduktion, gesellschaftliche Verhältnisse, materiellen Bedingungen, Arbeitsteilung, Kritik am Deutschen Idealismus, soziale Strukturen.
- Quote paper
- Boris Reinecke (Author), 2012, Ideologie und Habitus. Ein Theorievergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/215923