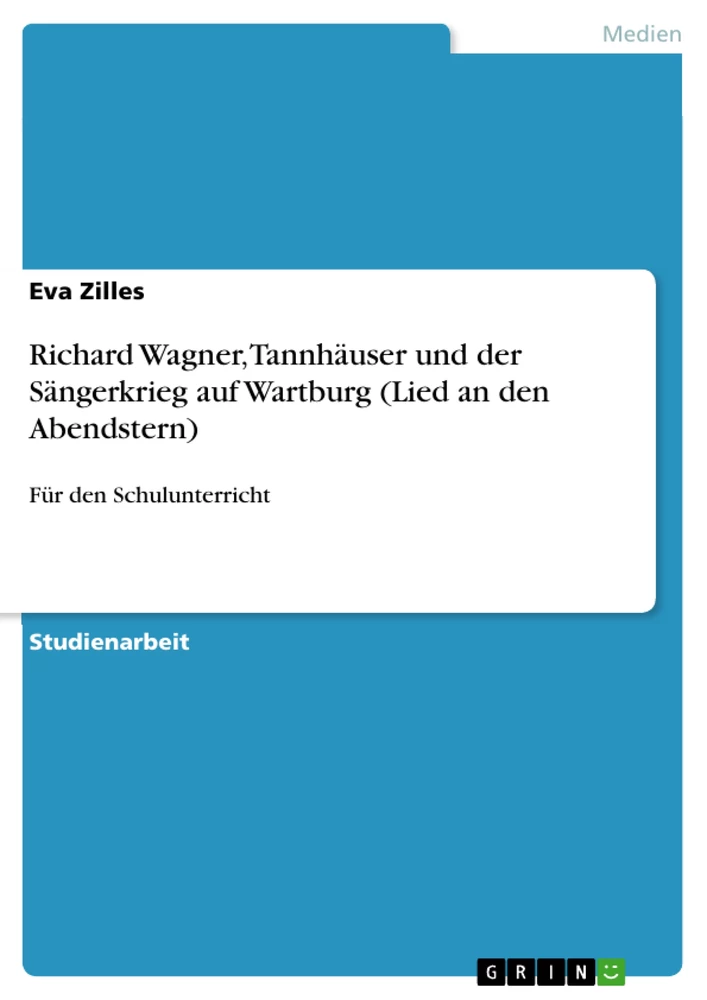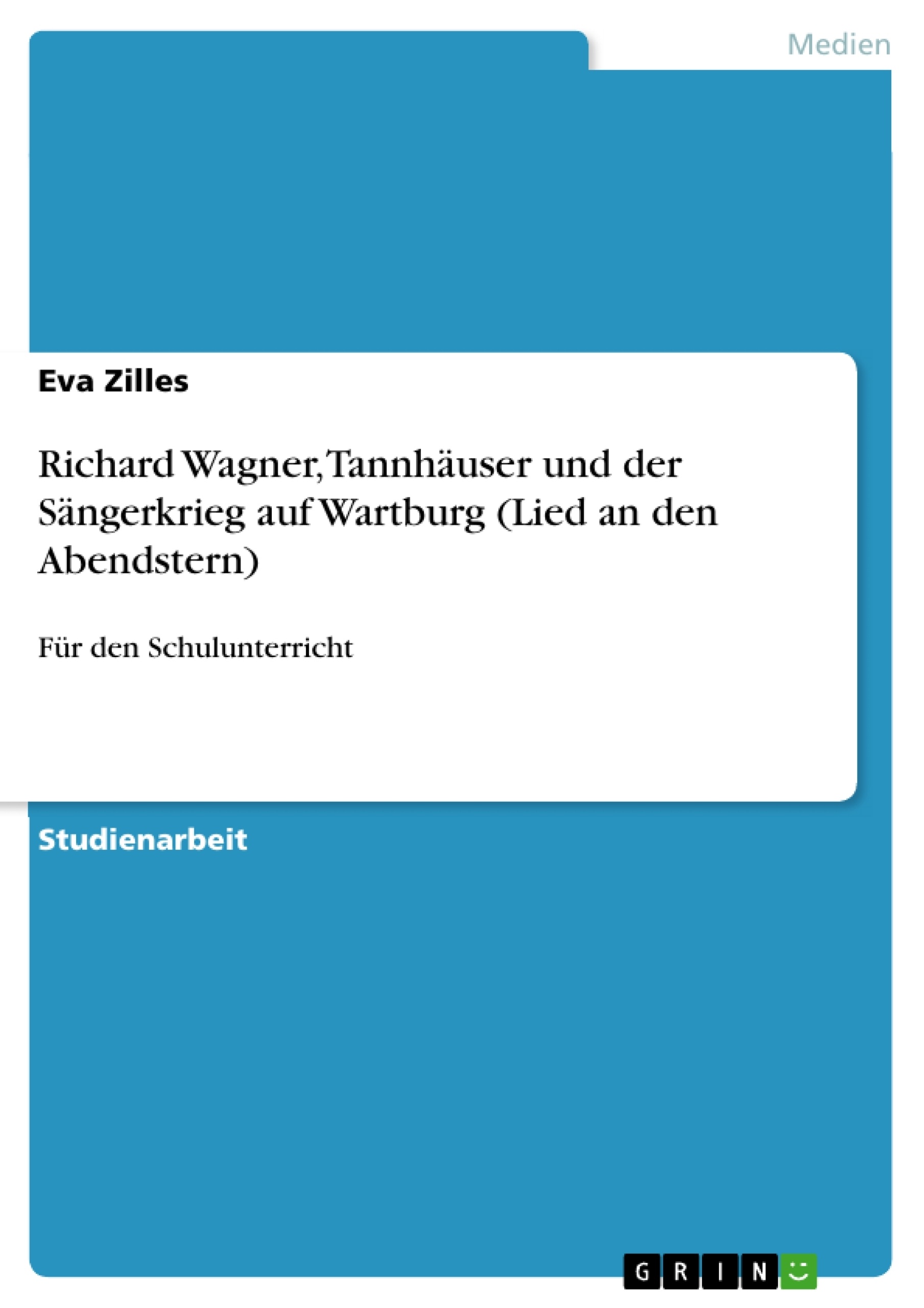Richard Wagner studierte zahlreiche Quellen für sein Werk „Tannhäuser“. Wie auch beim „Fliegenden Holländer“ war Heinrich Heine eine Anregung, 1837 erschien sein Gedicht „Tannhäuser. Eine Legende“. Auch die Erzählung „Phantasus: Der getreue Eckard und der Tannhäuser“ von Friedrich Tieck hatte Wagner gelesen. Außerdem gab ihm die „Tannhäuser-Ballade“ aus „Der Knaben Wunderhorn“ von 1806 Inspiration. Wagner nannte die Ballade zwar nicht als Quelle für seine Tannhäuser-Dichtung, hat sie aber sicherlich gekannt. Die gemeinsamen Motive der Schmerzbegierde bei Tannhäusers Abschied von Venus und des öffentlichen Preislieds auf Venus sind erkennbar.
Den Sängerkrieg kannte Wagner aus E. T. A. Hoffmanns „Kampf der Sänger“ und „Über den Krieg von Wartburg“ von C. T. L. Lucas.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort/Entstehungsgeschichte
- Quellen
- Der „echte" Tannhäuser
- Der „echte" Wolfram von Eschenbach
- Biographischer Hintergrund
- Handlung der Oper
- Inhalt Akt 1
- Inhalt Akt 2
- Inhalt Akt 3
- Musikalischer Inhalt
- zu „Tannhäuser" allgemein
- zum „Lied an den Abendstern"
- Schluss/Wagner in der Schule
- Biographisches
- Bayreuther Festspiele
- Oper und „Lied an den Abendstern"
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Oper „Tannhäuser" von Richard Wagner, einem der bedeutendsten Werke des Komponisten. Sie analysiert die Entstehung des Werkes, beleuchtet den biografischen Hintergrund, beschreibt die Handlung und erörtert den musikalischen Inhalt. Darüber hinaus werden die Bayreuther Festspiele, die Richard Wagner ins Leben rief, sowie die Verwendung von Wagners Werken im Schulunterricht thematisiert.
- Die Entstehung und Entwicklung der Oper „Tannhäuser"
- Die Bedeutung von Wagners Biographie für die Entstehung des Werkes
- Die Handlung der Oper und die Darstellung der beiden Welten: Venusberg und Wartburg
- Die musikalische Gestaltung der Oper und die charakteristischen Elemente von Wagners Musik
- Die Bayreuther Festspiele und ihre Bedeutung für Wagners Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die Entstehung der Oper „Tannhäuser" und die Quellen, die Wagner für sein Werk nutzte. Es wird deutlich, dass Wagner sich von verschiedenen literarischen Vorlagen inspirieren ließ, darunter Gedichte von Heinrich Heine und Erzählungen von Friedrich Tieck. Das Kapitel beleuchtet auch die historischen Figuren Tannhäuser und Wolfram von Eschenbach, die Wagner in seine Oper einbezog.
Das zweite Kapitel widmet sich dem biografischen Hintergrund der Oper. Es beschreibt Wagners Reise nach Paris und seinen Aufenthalt dort, der ihn mit Heinrich Heine in Kontakt brachte. Die Reise nach Thüringen und der Anblick der Wartburg inspirierten Wagner zur Komposition des „Tannhäusers". Das Kapitel schildert außerdem die Entstehung des Werkes, von den ersten Ideen bis zur Uraufführung und den späteren Änderungen, die Wagner am Werk vornahm.
Das dritte Kapitel fasst die Handlung der Oper „Tannhäuser" zusammen. Es beschreibt die beiden Welten, in denen die Oper spielt: den Venusberg, ein Reich der Sinnlichkeit, und die Wartburg, ein Ort des christlichen Glaubens. Die Handlung folgt Tannhäusers Konflikt zwischen den beiden Welten, seinem Liebesverhältnis zu Venus und seiner Sehnsucht nach Elisabeth.
Das vierte Kapitel analysiert den musikalischen Inhalt der Oper. Es beschreibt die charakteristischen Elemente von Wagners Musik, die Verwendung von Kontrasten und die Darstellung der beiden Welten durch unterschiedliche musikalische Mittel. Das Kapitel widmet sich außerdem dem „Lied an den Abendstern" von Wolfram von Eschenbach und erläutert seine musikalische Gestaltung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Richard Wagner, die Oper „Tannhäuser", die Entstehung des Werkes, die Handlung der Oper, den musikalischen Inhalt, die Bayreuther Festspiele und die Verwendung von Wagners Werken im Schulunterricht. Die Arbeit beleuchtet die Quellen, den biografischen Hintergrund, die Handlung und die musikalische Gestaltung der Oper sowie die Bedeutung von Wagners Werk im Kontext der Musikgeschichte und der Kulturgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Welche Quellen nutzte Wagner für die Oper „Tannhäuser“?
Wagner ließ sich von Heinrich Heines Gedichten, Friedrich Tiecks Erzählungen und der „Tannhäuser-Ballade“ aus „Des Knaben Wunderhorn“ inspirieren.
Worum geht es im „Sängerkrieg auf Wartburg“?
Es ist ein zentraler Akt der Oper, bei dem Ritter und Sänger (u.a. Wolfram von Eschenbach und Tannhäuser) über das Wesen der Liebe streiten.
Was symbolisieren der Venusberg und die Wartburg?
Der Venusberg steht für sinnliche, erotische Lust, während die Wartburg das Ideal der christlichen, tugendhaften Liebe repräsentiert.
Was ist das Besondere am „Lied an den Abendstern“?
Es ist eine berühmte Arie von Wolfram von Eschenbach im 3. Akt, die durch ihre sanfte Melodik und die Darstellung von Sehnsucht und Todesahnung besticht.
Welche Bedeutung haben die Bayreuther Festspiele für Wagner?
Wagner gründete die Festspiele, um einen Ort zu schaffen, an dem seine Werke (als Gesamtkunstwerk) unter idealen akustischen und inszenatorischen Bedingungen aufgeführt werden können.
- Quote paper
- Eva Zilles (Author), 2011, Richard Wagner, Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg (Lied an den Abendstern) , Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/215724