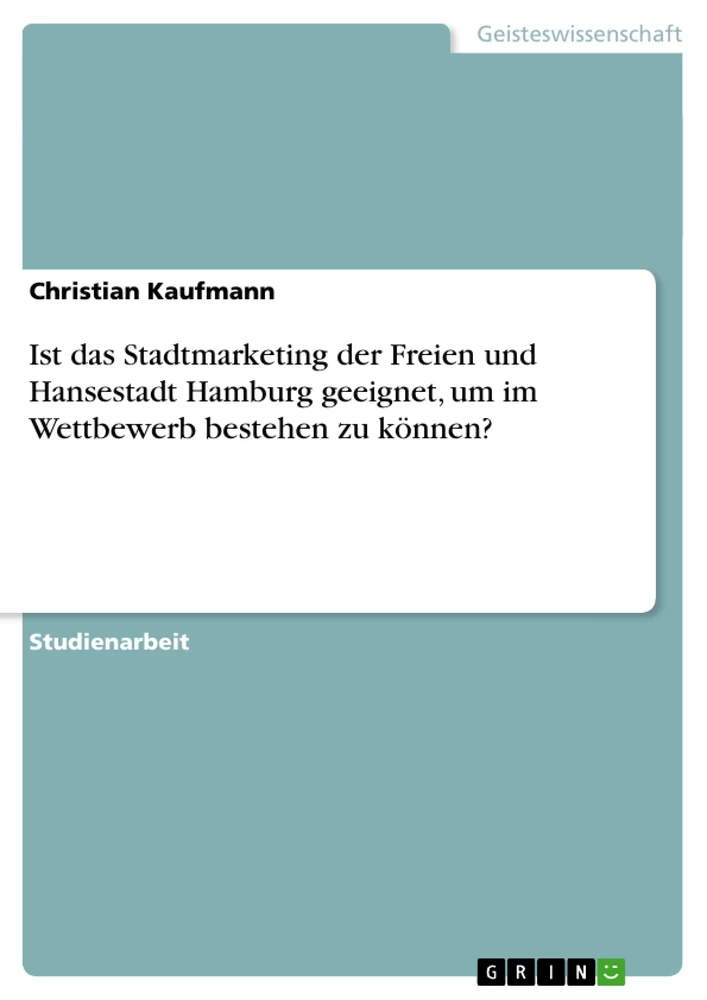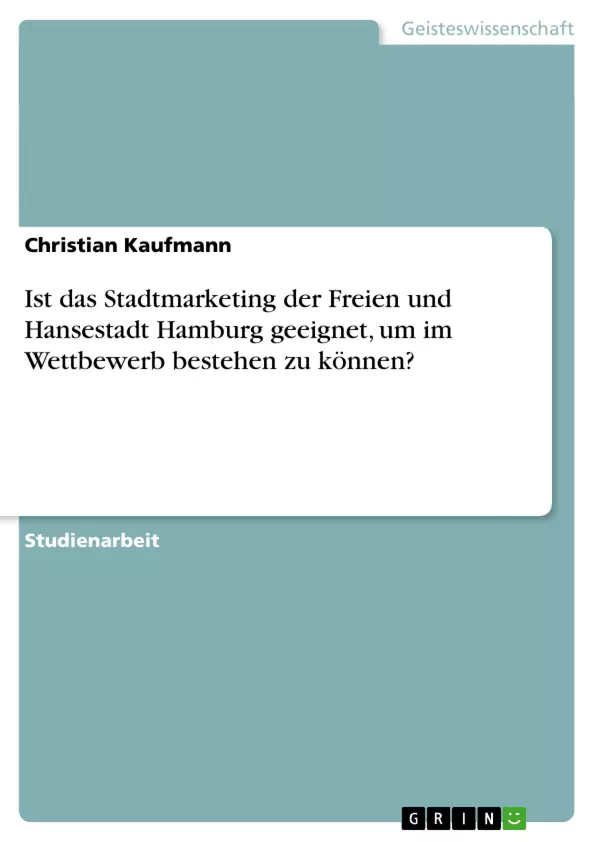In einem Prospekt der Hansestadt Hamburg wurde vor einigen Jahren die Frage aufgeworfen, ob auch eine Welt- und Handelsmetropole wie Hamburg überhaupt Marketing betreiben muss. Diese Frage wurde wie folgt beantwortet:
„Die Eigenschaften einer Stadt, die Ansiedlung von Industrie, Dienstleistungsbetrieben und Handel zu fördern, erschöpfen sich nicht in der realen Qualität ihrer Standortbedingungen. Wesentlich dafür ist der Faktor Image, der ganz entscheidend von ‚weichen‘ Größen wie Bekanntheit, Ruf, Ansehen oder Flair abhängt. Wer Investoren anziehen will, muss auch ihren Arbeitskräften etwas zu bieten haben.“ (Konken 2004, S. 18)
Heute scheint es Konsens zu sein, dass das Stadtmarketing ein unabdingbares Instrument der Stadtentwicklung ist, das jede Stadt gezielt einsetzen und nachhaltig weiterentwickeln muss. Die „generelle Ökonomisierung der Perspektive“ (Grabow/Hollbach-Grömig 2006, S. 7) hat auch dazu geführt, dass sich das Verständnis dessen verändert hat, was eine Stadt ist oder ausmacht. Sie gilt zunehmend als Einheit, die sich wie ein Unternehmen dem Wettbewerbsdruck der globalen Wirtschaft stellen muss.
Das generelle Ziel der vorliegenden Arbeit soll sein, die Stärken und Schwächen des Standorts Hamburg aus der Perspektive des Stadtmarketings zu untersuchen und darauf aufbauend eine Analyse der Marke Hamburg durchzuführen. Zudem soll gefragt werden, ob es der Hansestadt Hamburg gelungen ist, auf Grundlage ihrer Stärken und vorhandenen Potenziale ein unverwechselbares und international wettbewerbsfähiges Markenprofil zu schaffen. Welche Stärken und Schwächen hat dieser Standort also generell? Und aus welchen Faktoren setzt sich die Marke Hamburg speziell zusammen? Wie hat sich die Hansestadt positioniert? Und ist das gegenwärtige Stadtmarketingkonzept erfolgsversprechend – oder kann es womöglich verbessert werden?
Um diese Fragen systematisch abhandeln zu können, wurde diese Hausarbeit in drei Kapitel unterteilt: Im ersten Kapitel soll zunächst das Instrument des Stadtmarketings skizziert werden, um daran anschließend verschiedene theoretische Konzepte des Stadtmarketings zu erläutern. Im zweiten Kapitel folgt eine Standortanalyse, in der die Stärken und Schwächen der Hansestadt Hamburg herausgearbeitet werden sollen, bevor im dritten Kapitel eine Untersuchung der einzelnen Bausteine der Marke Hamburg vorgenommen und ein alternativer Profilansatz erstellt werden soll.
Gliederung
Einleitung
1 Stadtmarketing als Instrument der Stadtentwicklung
1.1 Begriffsdefinition
1.2 Bedeutung und Ziele
1.3 Erklärungsansätze für Stadtmarketingaktivitäten
1.3.1 Konzept der Gouvernementalität von Foucault
1.3.2 Laclau ’ sches und Mouffe ’ sches Hegemoniekonzept
1.4 Akteure und Adressaten
1.5 Probleme des Stadtmarketings
2 Analyse der Metropole Hamburg
2.1 Hamburg in Zahlen
2.2 Standortanalyse für Hamburg
2.2.1 Primärer und Sekundärer Sektor
2.2.2 Tertiärer Sektor
2.2.2.1 Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister
2.2.2.2 Handel, Gastgewerbe und Verkehr
2.2.2.3 Öffentliche und private Dienstleister
2.2.3 Sonstige Standortfaktoren
3 Untersuchung des Profils der Marke Hamburg
3.1 Vermarktungskonzept der Elbmetropole
3.2 Erfolgsbausteine der Marke Hamburg
3.2.1 Hamburgische Volksfeste
3.2.2 Attraktive Business- und Handelsmetropole
3.2.3 Shopping-Metropole
3.2.4 Lebenswerte Metropole am Wasser
3.2.5 Hochwertige kulturelle Darbietungen
3.2.6 Wachstum und Umwelt
3.2.7 Szenen und Vergnügungsmeilen
3.3 Entwicklungsansatz eines alternativen Profils
Fazit
Anhang
Literaturverzeichnis
Einleitung
In einem Prospekt der Hansestadt Hamburg wurde vor einigen Jahren die Frage aufgeworfen, ob auch eine Welt- und Handelsmetropole wie Hamburg überhaupt Marketing betreiben muss. Diese Frage wurde wie folgt beantwortet:
„Die Eigenschaften einer Stadt, die Ansiedlung von Industrie, Dienstleistungsbetrieben und Handel zu fördern, erschöpfen sich nicht in der realen Qualität ihrer Standortbedingungen. Wesentlich dafür ist der Faktor Image, der ganz entscheidend von ‚weichen‘ Größen wie Bekanntheit, Ruf, Ansehen oder Flair abhängt. Wer Investoren anziehen will, muss auch ihren Arbeitskräften etwas zu bieten haben.“ (Konken 2004, S. 18)
Heute scheint es Konsens zu sein, dass das Stadtmarketing ein unabdingbares Instrument der Stadtentwicklung ist, das jede Stadt gezielt einsetzen und nachhaltig weiterentwickeln muss. Die „generelle Ökonomisierung der Perspektive“ (Grabow/Hollbach-Grömig 2006, S. 7) hat auch dazu geführt, dass sich das Verständnis dessen verändert hat, was eine Stadt ist oder ausmacht. Sie gilt zunehmend als Einheit, die sich wie ein Unternehmen dem Wettbewerbsdruck der globalen Wirtschaft stellen muss.
Das generelle Ziel der vorliegenden Arbeit soll sein, die Stärken und Schwächen des Standorts Hamburg aus der Perspektive des Stadtmarketings zu untersuchen und darauf aufbauend eine Analyse der Marke Hamburg durchzuführen. Zudem soll gefragt werden, ob es der Hansestadt Hamburg gelungen ist, auf Grundlage ihrer Stärken und vorhandenen Potenziale ein unverwechselbares und international wettbewerbsfähiges Markenprofil zu schaffen. Welche Stärken und Schwächen hat dieser Standort also generell? Und aus welchen Faktoren setzt sich die Marke Hamburg speziell zusammen? Wie hat sich die Hansestadt positioniert? Und ist das gegenwärtige Stadtmarketingkonzept erfolgsversprechend – oder kann es womöglich verbessert werden?
Um diese Fragen systematisch abhandeln zu können, wurde diese Hausarbeit in drei Kapitel unterteilt: Im ersten Kapitel soll zunächst das Instrument des Stadtmarketings skizziert werden, um daran anschließend verschiedene theoretische Konzepte des Stadtmarketings zu erläutern. Im zweiten Kapitel folgt eine Standortanalyse, in der die Stärken und Schwächen der Hansestadt Hamburg herausgearbeitet werden sollen, bevor im dritten Kapitel eine Untersuchung der einzelnen Bausteine der Marke Hamburg vorgenommen und ein alternativer Profilansatz erstellt werden soll.
Die Auswahl des Themas dieser Arbeit ist dem Umstand geschuldet, dass es zum Stadtmarketing als Instrument der Stadtentwicklung zwar reichlich Literatur gibt – dass aber interessanterweise bisher keine Analyse des Markenprofils der Hansestadt Hamburg existiert. Diese sei hiermit also nachgeholt.
1 Stadtmarketing als Instrument der Stadtentwicklung
Aufgrund des weltweiten wirtschaftlichen Strukturwandels und der sich schnell ändernden globalen Rahmenbedingungen, denen nicht nur Länder, sondern zunehmend auch Städte und Metropolregionen ausgesetzt sind, aber auch aufgrund der gestiegenen Partizipationsansprüche der Bürger hat das Stadtmarketing als neues Instrument der Stadtentwicklung seit Mitte der 1980er Jahre enorm an Bedeutung gewonnen. Der Einsatz dieses Instruments ist jedoch nicht das Resultat der autonomen Suche nach und Entwicklung von neuen Möglichkeiten, den Stadtentwicklungsprozess zu verbessern, sondern vielmehr eine Folge der Übertragung der ursprünglich für Unternehmen entwickelten Marketingkonzeptionen auf Non-Profit-Organisationen und der vorangehenden Fachdiskussion in den 1960er Jahren (vgl. Mensing/Söhl 1998, S. 13). Was verbirgt sich konkret hinter dem Begriff des Stadtmarketings?
1.1 Begriffsdefinition
In der Literatur existieren teilweise recht unterschiedliche Auffassungen und Abgrenzungen des Begriffs Stadtmarketing. Einerseits wird der Begriff relativ eng als Werbe- und Verkaufsstrategie definiert, andererseits jedoch recht weit als ein umfassendes Marketing-Konzept für geografische Räume, das dazu dient, sich im internationalen Standortwettbewerb zu behaupten (vgl. Putz 2008, S. 6 ff.).
Grundlegend lässt sich festhalten, dass das Stadtmarketing ein mittel- bzw. langfristig angelegtes Führungs- und Handlungskonzept ist, das auf den gesamten Stadtbereich ausgerichtet ist und auf einer Leitidee basiert. Es umfasst die Kommunikation, Gestaltung und Zielfestschreibung aller für das Stadtmarketing relevanten Handlungs- und Politikfelder einer Stadt unter der Prämisse, möglichst große Teile der Bevölkerung an der zukünftigen Entwicklung zu beteiligen (vgl. Konken 2004, S. 27). Warum ist das Stadtmarketing für die Stadtentwicklung so bedeutend geworden?
1.2 Bedeutung und Ziele
Das Instrument des Stadtmarketings dient in erster Linie dazu, ein ‚individuelles‘ und attraktives städtisches Erscheinungsbild zu schaffen, das sich gegenüber dem anderer Städte deutlich absetzt, um möglichst viele potenzielle Unternehmen und Touristen anzusprechen und deren Investitions- und Kaufkraft zu binden. Zudem soll es quasi nach innen wirken, um die Zustimmung Einheimischer zu kommunalpolitischen Entscheidungen sowie die Identifikation der Mitarbeiter städtischer Dienste mit ‚ihrer‘ Stadt zu stärken und insgesamt ein positives Image bei möglichst vielen Menschen zu schaffen.
Das grundlegende Ziel des Stadtmarketings ist es also, eine ‚Stadtmarke‘ zu entwickeln, um eine marktorientierte Stadtentwicklungspolitik zu ermöglichen. Die Stadt soll in ihrer Gesamtheit ‚individualisiert‘ und im interkommunalen Wettbewerb profiliert werden (vgl. Mensing/Rahn 2000, S. 26). In diesem Wettbewerb prosperieren Städte nur dann, wenn es ihnen gelingt, sich ein einzigartiges Markenzeichen zu geben – es sei denn, sie hätten quasi ‚von Natur aus‘ Einzigartiges zu bieten (vgl. Löw 2008, S. 121). Abbildung 1 zeigt die wichtigsten Ziele des Stadtmarketings aus Sicht seiner Initiatoren:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Ziele des Stadtmarketings (in Anlehnung an DifU 2004)
Eine Umfrage des Deutschen Instituts für Urbanistik (DifU) aus dem Jahr 2004 zeigt, dass die Steigerung der Attraktivität einer Stadt (51%) das wichtigste Ziel von Städten und Gemeinden ist, die explizites Stadtmarketing betreiben. An zweiter Stelle folgt das Ziel der Förderung des Handels in der Innenstadt (43%) vor dem der Profilierung der Stadt im Städtewettbewerb (34%). Die Häufigkeit der Nennung des Zieles, die Stadt durch Stadtmarketing zu bewerben, ist im Vergleich zu einer im Jahr 1995 durchgeführten Umfrage um die Hälfte auf nur noch 25% gesunken. Von nicht geringer Bedeutung sind auch die Ziele Förderung von Kooperationen zwischen öffentlichen und privaten Akteuren (24%) sowie strategische Ausrichtung der Entwicklung einer Stadt (23%).
1.3 Erklärungsansätze für Stadtmarketingaktivitäten
Nach der Beschreibung der Zielsetzungen des Stadtmarketings soll im Folgenden der Frage nachgegangen werden, warum Stadtmarketingaktivitäten überhaupt notwendig sind. Zur Klärung dieser Frage eignet sich besonders ein Blick auf das Konzept der Gouvernementalität von Michel Foucault sowie auf das Hegemoniekonzept von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe, da beide diskurstheoretischen Ansätze verdeutlichen, durch welche Entwicklungen und Risikoszenarien das Stadtmarketing legitimiert und geformt wurde und wie es in die Praktiken der Wettbewerbsorientierung, Individualisierung und Ökonomisierung eingebunden ist. Beide Konzepte werden, entgegen ihrer ursprünglich eher historischen Ausrichtung, heutzutage vor allem zur Klärung aktueller sozialer, wirtschaftlicher oder politischer Probleme herangezogen, wie eben beispielsweise bei der Erklärung von Stadtmarketingaktivitäten.
1.3.1 Konzept der Gouvernementalität von Foucault
Michel Foucault geht in seinem Konzept der Gouvernementalität davon aus, dass die Praktiken des Stadtmarketings als Ausdruck großflächiger diskursiver Verschiebungen zu interpretieren sind und er verdeutlicht dabei insbesondere, dass Stadtmarketing kein isoliertes Phänomen darstellt. Es ist vielmehr das Symptom einer weitgreifenden Ökonomisierung der Gesellschaft, d. h. es ist vor dem Hintergrund des paradigmatischen Wandels hin zur Betonung des Ökonomischen zu sehen (vgl. Mattissek 2008, S. 67 ff.). Der Begriff des Stadtmarketings ist also nicht nur eine modische Floskel, sondern vielmehr eine Antwort auf den ökonomistischen ‚Zeitgeist‘ (Grabow/Hollbach-Grömig 2006, S. 22).
Foucault identifiziert – neben dem paradigmatischen Wandel hin zum Ökonomischen, also weg vom sozialstaatlichen Konsens – insbesondere die fortschreitende Globalisierung als Ursache für die Zunahme von Stadtmarketingaktivitäten und er verweist auf den schmalen Grad zwischen den Chancen, die sie bieten (z. B. Erschließung neuer Touristengruppen), und den weitreichenden Gefahren, die sie zur Folge haben können (z. B. Verödung der Innenstadt), wenn eine Stadt im Wettbewerb versagt.
Allerdings ist es nicht nur das Bedrohungsszenario der Globalisierung des Wettbewerbs, das Foucault als Erklärungsansatz für die zunehmende Bedeutung der Städte als Akteure des Marketings in eigener Sache heranzieht. Die Verschiebung ökonomischer und politischer Verantwortlichkeiten zulasten der Städte ist ebenso auf das sich in allen innergesellschaftlichen Bereichen hegemonial durchsetzende Ideal ökonomisch rationalen Verhaltens zurückzuführen (vgl. Mattissek 2008, S. 56 ff.). Mit der immer weitergehenden Ausbreitung betriebswirtschaftlicher Bewertungskriterien und Managementkonzepte verstärken sich zunehmend auch die Anforderungen an die Städte. Auch sie müssen immer effizienter und ‚profitabler‘ arbeiten. Und das geht kaum ohne Marketing in eigener Sache.
1.3.2 Laclau’sches und Mouffe’sches Hegemoniekonzept
Ernesto Laclau und Chantal Mouffe beschreiben in ihrem Hegemoniekonzept, ähnlich wie Michel Foucault, dass der flottierende Signifikant ‚Stadt‘ im Laufe der Zeit eine Umdefinition erfahren hat. Das früher gültige Leitbild der wohlfahrtsstaatlichen Entwicklung und des sozialen Interessenausgleichs wurde auch innerhalb der Stadt durch ein neoliberales Modell der freien Entfaltung marktwirtschaftlicher Mechanismen und des weitgehenden Rückzugs staatlicher und städtischer Institutionen aus der Verantwortung für die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Belange der Bürger ersetzt (vgl. Mattissek 2008, S. 96 ff.). Dieser Paradigmenwechsel ist Ausdruck davon, dass ab einem gewissen Zeitpunkt der Wohlfahrtsstaat, verstanden als gültiges diskursives Bezugssystem, nicht mehr in der Lage war, die Bedürfnisse der wachsenden Zahl von Menschen mit Partikularinteressen – vom Arbeitslosen bis zum Obdachlosen oder Migranten – zu befriedigen.
Demzufolge wuchs die Bereitschaft zur Ausbildung neuer antagonistischer Grenzziehungen und zur Koalition mit neuen hegemonialen Angeboten, die Besserung erwarten ließen. Durch die Ausbreitung der neoliberalen Logik, die mit Termini wie Fortschritt, Wettbewerbsfähigkeit, Effizienz und ökonomische Sicherheit argumentiert, wurde diskursiv eine Gesellschaft und Gemeinschaft konstituiert, die sich selbst als, je nachdem, ‚Unternehmen Staat‘ oder ‚Unternehmen Stadt‘ versteht (vgl. Mattissek 2008, S. 97 ff.).[1] Damit sich die Stadt, die in erster Linie als ökonomischer Akteur agiert, im Standortwettbewerb behaupten kann, muss sie sich diskurskonform verhalten und möglichst erfolgreich vermarkten. Sie läuft sonst Gefahr, in irgendeiner Weise mit dem ‚unaussprechlichen‘ Wort „Außen“ (Mattissek 2008, S. 97) beschrieben und damit abgewertet zu werden. Genau das wird aber passieren, wenn eine Stadt im globalen Wettbewerb versagt.
1.4 Akteure und Adressaten
Stadtmarketing basiert auf einer Kooperation zwischen öffentlichen und privaten Akteuren, die den ‚Lebensraum Stadt‘ leitbildgemäß definieren und damit auch in Form aktiver Einflussnahme gestalten. Hierbei handelt es sich nicht um Maßnahmen, die der Bevölkerung ‚von oben‘ aufoktroyiert werden oder die ausschließlich Folge eines Rückzugs öffentlicher Akteure aus kommunalen Steuerungsprozessen sind, sondern vielmehr um die Einbeziehung einer Vielzahl ‚neuer‘ Akteure (u. a. Bürger und Akteure aus dem Wirtschaftsbereich) in die Planungsprozesse des Stadtmarketings (vgl. Mattissek 2008, S. 13). Zur Gruppe der öffentlichen Akteure gehören vor allem die städtischen Verwaltungsmitarbeiter, der Bürgermeister, die Fraktionen des Stadtparlaments (Stadtrat, Bürgerschaft etc.) sowie auch Touristik- und Fremdenverkehrsorganisationen (vgl. Beyer 1995, S. 28). Private Akteure hingegen sind Vertreter mit primär wirtschaftlichen Interessen, etwa Banken, Gewerbetreibende oder Grundstückseigentümer (vgl. Grabow/Hollbach-Grömig 1998, S. 70 ff.).
Die Adressaten des Stadtmarketings sind eine Vielzahl von Personen und gesellschaftlichen Gruppen mit unterschiedlichsten Interessen. Demzufolge kann die Zielgruppenansprache – je nach Sozialstruktur der betreffenden Stadt – sehr unterschiedlich sein. Als interne Zielgruppen gelten, je nachdem, die Bürger in ihrem Gesamt oder nur die am Prozess beteiligten Personen oder auch nur die Vertreter der heimischen Wirtschaft. Als externe Zielgruppen gelten insbesondere touristische Besucher, Pendler, ansiedlungswillige Unternehmen sowie kommunal relevante externe Medienvertreter, Meinungsbildner oder Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft (vgl. Putz 2008, S. 31 ff.).
1.5 Probleme des Stadtmarketings
Bei der Durchführung des Stadtmarketings können verschiedene Probleme auftreten, wie z. B. eine unzureichende Zielgruppenansprache. So dürfen die Akteure des Stadtmarketings nicht nur externe Personengruppen ansprechen. Sie müssen gleichermaßen versuchen, die Bewohner der Stadt an den Standort zu binden und ein ‚nach innen‘ wirkendes Zusammengehörigkeitsgefühl zu schaffen, also ein positives Stadtimage auch bei der eigenen Bevölkerung zu verankern (vgl. Mattissek 2008, S. 17). Ein anderer Aspekt, der beachtet werden muss, bezieht sich ebenfalls auf die Gruppe der Akteure des Stadtmarketings. Sie dürfen keine eigenen Interessen verfolgen, sondern müssen allein den Interessen der Stadt und ihrer Bevölkerung dienen. Persönliches Statusdenken, ökonomische Interessen oder der Drang nach Anerkennung dürfen im Stadtmarketing keine Rolle spielen (vgl. Konken 2004, S. 361). Der Punkt des Stadtmarketings, der die gravierendsten Probleme zur Folge hat, ist eine verfehlte Positionierung der Stadt.[2] So führt eine falsche Repräsentation der Stadt nicht nur zu einem Wettbewerbsnachteil, sondern verhindert auch die Etablierung eines homogenen, in sich geschlossenen Images (vgl. Mattissek 2008, S. 18 ff.).
2 Analyse der Metropole Hamburg
Um das Profil der Marke Hamburg bzw. das Vermarktungskonzept des Hamburger Stadtmarketings zu untersuchen, ist es zunächst erforderlich, die Metropole Hamburg hinsichtlich ihrer Stärken und Schwächen zu analysieren. Der Charakter und das Erscheinungsbild der Hansestadt haben sich in den vergangenen Jahrzehnten aufgrund der Globalisierung und des wirtschaftlichen Strukturwandels sukzessive verändert (siehe Abschnitt 1.3.1 zum Konzept von Michel Foucault). So hat sich Hamburg von einer in starkem Maße auf ihren Hafen orientierten Stadt an der Elbe zu einem der bedeutendsten Dienstleistungs- und Technologiestandorte in Europa entwickelt, also quasi „from ship to chip“ (Schilling 2000, S. 45). Wie attraktiv ist der Standort Hamburg nach diesem „Verlust der Seemannsromanik“ (Gudat 2010, S. 25) aber noch? Bevor dieser Frage nachgegangen werden kann, müssen zunächst einige grundlegende Fakten geklärt werden.
2.1 Hamburg in Zahlen
Hamburg ist mit einer Fläche von 755 km2 das zweitkleinste Bundesland Deutschlands, jedoch mit rund 1,8 Millionen Einwohnern die zweitgrößte deutsche Stadt. Im Zeitraum von 2003 bis 2009 wuchs die Bevölkerung Hamburgs um 2,3%, wobei dieser Zuwachs vor allem auf die zahlreichen Zuwanderer (von 2003 bis Ende 2009 waren es insgesamt 52.955 Menschen) zurückzuführen ist (Döll/Stiller 2010, S. 32). Die gegenwärtige Arbeitslosenquote in Hamburg (Stand Juli 2011) beträgt 8,0% (Bundesagentur für Arbeit 2011).[3] Im Jahr 2010 konnte die Hansestadt 1.136.100 Erwerbstätige verzeichnen, was im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 0,7% bedeutet (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2010a).[4] Bemerkenswert ist das relativ hohe Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf, das im Jahr 2010 insgesamt 49.638 € betrug und im Vergleich zum Vorjahr um 4,5% gestiegen war (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2010b). Der Bundesdurchschnitt liegt nämlich bei nur 30.566 €.
Um die Attraktivität der Elbmetropole detaillierter beurteilen zu können, sollen im Folgenden die einzelnen Wirtschaftssektoren sowie ausgewählte Standortfaktoren (Umwelt, Lebensqualität etc.) etwas genauer betrachtet werden.
2.2 Analyse des Standorts Hamburg
Die folgende Standortanalyse soll dazu dienen, die Stärken und Schwächen Hamburgs als Identitätskomponenten der Stadt zu ermitteln, um sie im dritten Kapitel mit dem Markenprofil der Stadt Hamburg abzugleichen. Hilfreich für diese Analyse ist der sogenannte Lokationsquotient (siehe Anhang A). Bei diesem handelt es sich um das Verhältnis zwischen regionalen und nationalen Beschäftigungsanteilen eines Wirtschaftszweiges an der Gesamtbeschäftigung, wodurch indiziert wird, in welchen Bereichen ein Standort gewissen Spezialisierungsmustern folgt. Beträgt der Wert des Quotienten eins, bedeutet das eine dem nationalen Durchschnitt entsprechende Konzentration der Beschäftigten in diesem Wirtschaftszweig. Je mehr der Wert eins übersteigt, desto spezialisierter ist die betreffende Stadt (oder Region etc.) in diesem Bereich, wohingegen Werte unterhalb von eins auf das Gegenteil hinweisen (vgl. Döll/Stiller 2010, S. 34).
2.2.1 Primärer und Sekundärer Sektor
Der Primäre Sektor (Land-, Forstwirtschaft und Fischerei) spielt in der Hansestadt Hamburg seit vielen Jahren in wirtschaftlicher Hinsicht keine entscheidende Rolle mehr und ist gegenwärtig mit einem Wertschöpfungsanteil von nur 0,2% fast bedeutungslos (Statistikamt Nord 2010).
Der Stellenwert des Sekundären Sektors (Verarbeitendes Gewerbe, d. h. Handwerk und Industrie, sowie Energie- und Wasserversorgung und Bergbau) ist in der Elbmetropole aufgrund der fortschreitenden Tertiärisierung der Wirtschaft und des Wegbrechens industrieller Arbeitsplätze ebenfalls gesunken. So erwirtschaftete der industrielle Sektor im Jahr 2009 lediglich 16,1% der Wertschöpfung (Statistikamt Nord 2010). Nichtsdestoweniger gibt es in Hamburg, insbesondere im Bereich der forschungsintensiven Industrien, einige wirtschaftlich sehr erfolgreiche industrielle Sparten, zu denen beispielsweise die Mineralölverarbeitung, die Kokerei, der Maschinenbau sowie die Herstellung von Medizin-, Mess-, Steuer- und Reglungstechnik gehören. So war der Beschäftigungsanteil forschungsintensiver Industrien am gesamten Verarbeitenden Gewerbe in Hamburg im Jahr 2007 mit 63% der höchste unter den deutschen Bundesländern (vgl. Döll/Stiller 2010, S. 37).
Gesamtwirtschaftlich betrachtet hat sich Hamburg in vielen Bereichen jedoch, teilweise gezwungenermaßen aufgrund fehlender staatlicher Subventionen und Investoren, von altindustriellen Strukturen gelöst und zu einer Art Management- und Kompetenzcenter für eine Vielzahl moderner Dienstleistungen (besonders im Bereich der Logistik- und Medienwirtschaft) entwickelt, wie die folgenden Abschnitte verdeutlichen werden (vgl. Schilling 2000, S. 58).
2.2.2 Tertiärer Sektor
Die Hansestadt Hamburg hat sich im Lauf der letzten Jahrzehnte zu einer der führenden deutschen Dienstleistungsmetropolen entwickelt. In ihr werden 83,7% der Wertschöpfung im Dienstleistungssektor erbracht. Den höchsten Anteil am Tertiären Sektor hat hierbei der Wirtschaftszweig Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister mit 38,6%, gefolgt von Handel, Gastgewerbe und Verkehr mit 25,1% sowie den privaten und öffentlichen Dienstleistungen, die einen Wert von 20% aufweisen. Der fortschreitende Strukturwandel zur Dienstleistungsökonomie spiegelt sich u. a. in der sektoralen Entwicklung der Erwerbstätigen wider. Hierbei konnte der Wirtschaftsbereich Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister im Zeitraum von 2003 bis 2009 mit 17,6% die höchsten Zuwächse realisieren (Statistikamt Nord 2010).
[...]
[1] In Hamburg war es der frühere SPD-Bürgermeister von Dohnanyi, der im November 1983 das „Unternehmen Hamburg“ ausrief (Volkmann 2005, S. 6).
[2] Positionierung ist das Bestreben, die Einzigartigkeit und Unverwechselbarkeit einer Stadt herauszustellen. Sie bildet somit die strategische Grundlage für alle Marketing-Aktivitäten.
[3] Die Quote bezieht sich auf alle zivilen Erwerbspersonen. Diese Gruppe setzt sich gemäß der Definition der Bundesagentur für Arbeit aus abhängig beschäftigten zivilen Erwerbspersonen und Selbstständigen samt mithelfender Familienangehöriger zusammen.
[4] Zu den Erwerbstätigen zählen in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung alle Personen, die als Arbeitnehmer oder als Selbstständige bzw. als mithelfende Familienangehörige eine auf wirtschaftlichen Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben, unabhängig vom Umfang dieser Tätigkeit. Personen mit mehreren Beschäftigungsverhältnissen werden nur einmal erfasst.
- Arbeit zitieren
- Master of Arts (M.A.) Christian Kaufmann (Autor:in), 2011, Ist das Stadtmarketing der Freien und Hansestadt Hamburg geeignet, um im Wettbewerb bestehen zu können?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/215135