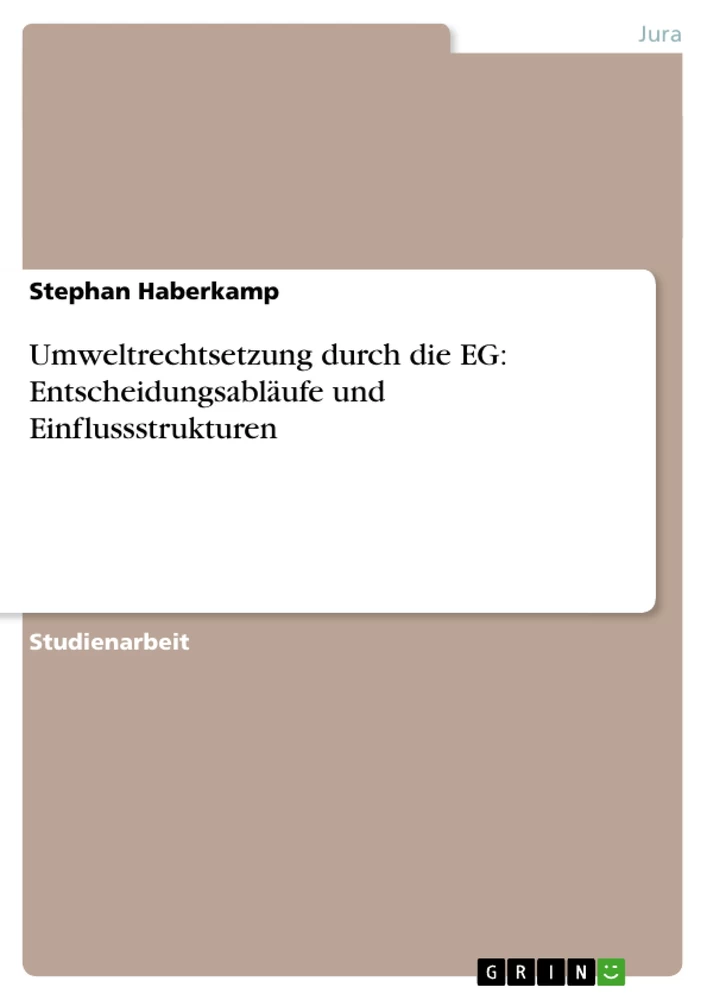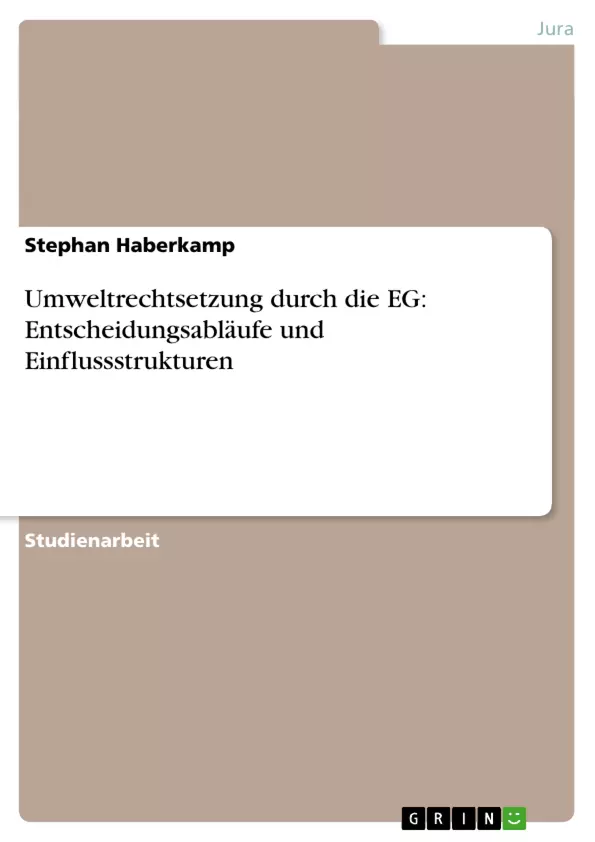Die Tätigkeit der Europäischen Gemeinschaft ist zunehmender Kritik ausgesetzt. Insbesondere im Hinblick auf die Vielzahl gemeinschaftlicher Regelungen werden Einwände erhoben. Es wird vielfach beanstandet, dass die zunehmende Zahl von Rechtsakten der EG nationalen Besonderheiten nicht hinreichend Rechnung trage und den Mitgliedstaaten keine eigenen Regelungsspielräume verblieben. Im Umweltrecht sind diese Bedenken mit der Befürchtung verbunden, die Gemeinschaft werde modernes mitgliedstaatliches Umweltrecht durch weniger schutzintensives, zu stark an der Gewährleistung des Binnenmarktes orientiertes EG-Recht verdrängen. Die Verteilung der Rechtssetzungsbefugnisse zwischen Gemeinschaft und Mitgliedstaaten ist von erheblicher Bedeutung für die Funktionstüchtigkeit des darauf aufbauenden materiellen Rechts.
Im Umweltrecht gewinnt die Aufgabenverteilung zwischen den zwei Entscheidungsebenen besondere Bedeutung. So weisen zum Beispiel einerseits die regionalen Anforderungen an ein Umweltschutzrecht in einem System von kontinentalen Ausmaßen wie der Gemeinschaft erhebliche Unterschiede auf. Andererseits stellt der gemeinschaftsweite einheitliche Markt erhebliche Anforderungen an die Einheitlichkeit sowohl produktbezogener als auch produktionsbezogener Regelungen. Hinzu kommt, dass im Umweltbereich deutliche Meinungsdifferenzen bezüglich eines angemessenen Schutzniveaus bestehen. Auch hierfür muss der Mechanismus der Aufgabenverteilung zwischen den beiden Ebenen Lösungen bieten. In der vorliegenden Seminararbeit wird dargestellt, wie die Aufgaben im Umweltrecht auf Gemeinschaft und Mitgliedstaaten der EG verteilt sind und wie die Tätigkeit auf diesen beiden Ebenen hierdurch voneinander getrennt oder miteinander verbunden ist. Vorab wird in allgemeiner Form dargestellt, wie sich die Umweltpolitik im Verlaufe der letzten 30 Jahre entwickelt hat und welche Grundprinzipien bzw. Ziele mit dieser Politik verbunden sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Teil
- I. Einführung
- II. Ursprung und Entwicklung der Umweltpolitik durch die EG
- 1. Drei Phasen europäischer Umweltpolitik
- III. Grundprinzipien und Ziele europäischer Umweltpolitik
- 2. Teil
- A. Umweltrechtliche Handlungsspielräume der Gemeinschaftsebene in der Europäischen Gemeinschaft
- I. Kompetenzen der Europäischen Gemeinschaft
- 1. Grundkonzepte der Kompetenz und Entscheidungsstruktur
- a. Prinzipien der Kompetenzverteilung und Kompetenzausübung
- 2. Rechtsetzungsverfahren, Art. 250 ff. EG
- II. Kompetenzen und weitere umweltrechtliche Vorgaben
- III. Angleichung der mitgliedstaatlichen Rechtsvorschriften, Art. 94 ff. EG
- 1. Allgemeine Harmonisierungskompetenz, Art. 94 EG
- 2. Maßnahmen zur Rechtsangleichung nach Art. 95 EG
- IV. Abgrenzung zwischen dem Anwendungsbereich des Art. 175 EG und anderen Kompetenzen
- B. Grenzen der Ausübung von Gemeinschaftskompetenzen gegenüber den Mitgliedstaaten
- I. Rechtliche Konzepte für die Beschränkung des Gemeinschaftsgesetzgebers
- 1. Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit
- C. Umweltrechtliche Handlungsspielräume der EG-Mitgliedstaaten
- I. Die eingeschränkte Souveränität der Mitgliedstaaten und die Entscheidungsbefugnis des EuGH
- II. Kompetenzen der Mitgliedstaaten
- D. Verbleibende mitgliedstaatliche Handlungsspielräume bei Existenz sekundären Gemeinschaftsrechts
- I. Sperrwirkung im Umweltbereich
- II. Primärrechtliche Abweichungsermächtigungen
- III. Sekundärrechtliche Abweichungsermächtigungen
- 3. Teil
- Zusammenfassung und Bewertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht die Verteilung von Kompetenzen im Umweltrecht zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten. Sie zielt darauf ab, die Funktionstüchtigkeit des Umweltrechts unter dem Aspekt dieser Aufgabenverteilung zu beleuchten. Die Arbeit beleuchtet, wie die Umweltpolitik der EG sich im Laufe der Zeit entwickelt hat und welche Grundprinzipien und Ziele damit verbunden sind.
- Die Entwicklung der Umweltpolitik in drei Phasen
- Die Kompetenzen der Europäischen Gemeinschaft im Umweltrecht
- Die Grenzen der Gemeinschaftskompetenzen gegenüber den Mitgliedstaaten
- Die Handlungsspielräume der EG-Mitgliedstaaten im Umweltrecht
- Die Auswirkungen von Gemeinschaftsrecht auf nationale Umweltgesetzgebung
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit führt in die Thematik ein und beleuchtet die wachsende Kritik an der EG-Gesetzgebung, insbesondere im Hinblick auf das Umweltrecht. Der zweite Teil betrachtet die Kompetenzen der Gemeinschaft im Umweltrecht, einschließlich der rechtlichen Grundlagen, der Entscheidungsverfahren und der Grenzen der Kompetenz. Der dritte Teil analysiert die Kompetenzen der Mitgliedstaaten und die Grenzen ihrer Handlungsspielräume im Kontext der Gemeinschaftsgesetzgebung.
Schlüsselwörter
Umweltrecht, Europäische Gemeinschaft, Kompetenzverteilung, Entscheidungsbefugnis, Mitgliedstaaten, Harmonisierung, Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit, Binnenmarkt, Umweltschutz
- Quote paper
- Stephan Haberkamp (Author), 2003, Umweltrechtsetzung durch die EG: Entscheidungsabläufe und Einflussstrukturen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/21458