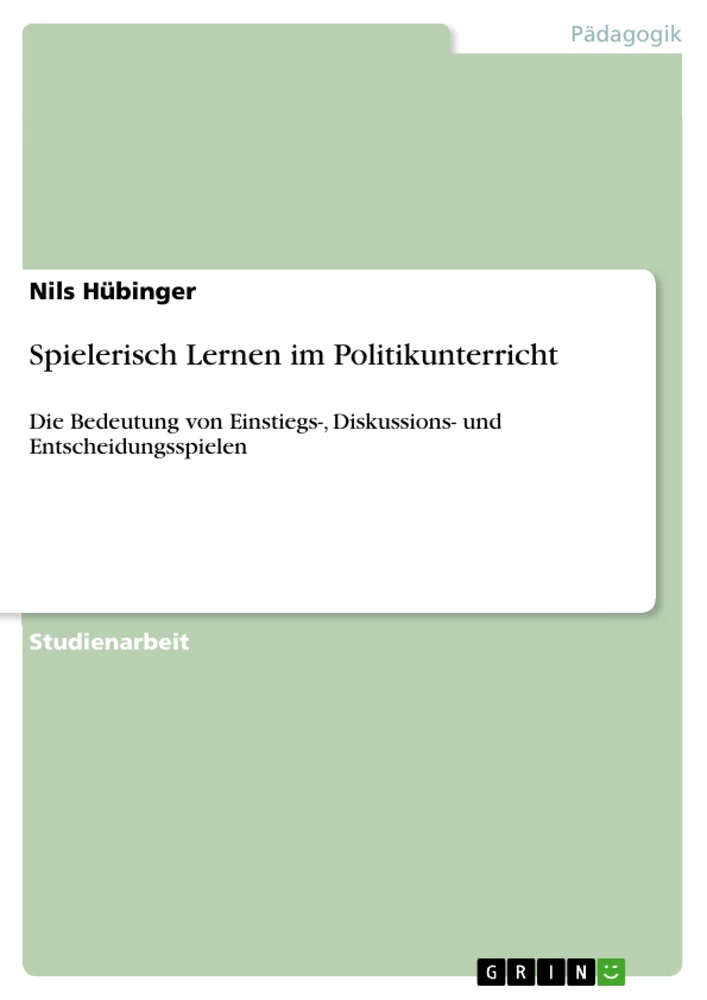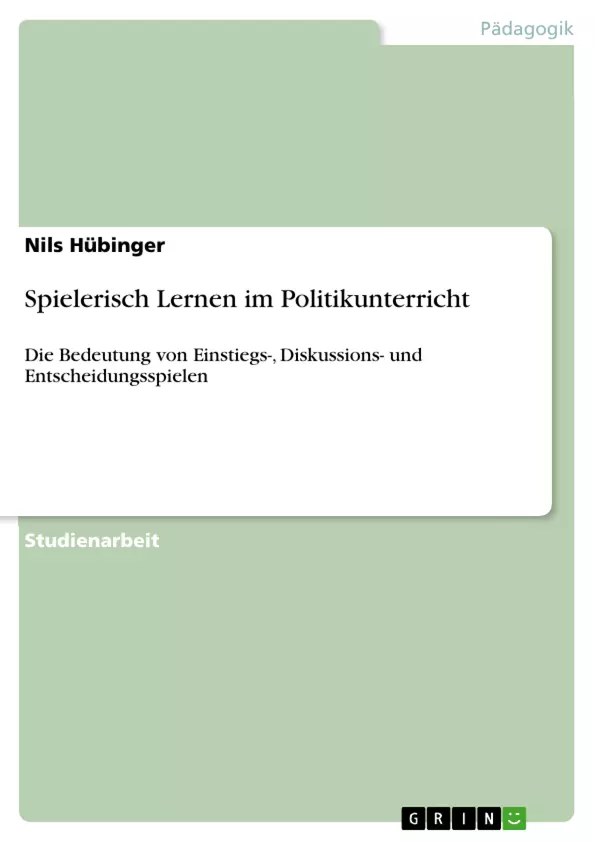Spätestens seit Ende der 1990er Jahre gehört ein breites Spektrum an Spielformen zum Methodenrepertoire des Politikunterrichts. Das Angebot reicht von Assoziations- und Einstiegsspielen, Diskussions- und Entscheidungsspielen, Simulationsspielen, Interaktions- und Kooperationsspielen, sowie Wissensspielen, bis hin zu szenischen Spielformen und spielerischen Präsentations- und Produktionsformen. Nicht zuletzt ein zunehmendes Desinteresse unter Schülern und Schülerinnen an dem Unterrichtsfach Politik und Wirtschaft führte dazu, dass dem Fach neue Attraktivität durch spielerische Elemente verliehen wurde. Spiele im Politikunterricht verfolgen jedoch nicht ausschließlich das Ziel, dem Politikunterricht im Allgemeinen größere Popularität zu verschaffen. Vor allem ermöglichen sie es den Schüler und Schülerinnen auf ungezwungene und spannende Weise ihre politische Urteils- und Handlungsfähigkeit auszubauen und sich zu demokratischen, mündigen und selbstständigen Bürgern zu entwickeln. Es steht fest, dass es sich bei Spielen und Lernen nicht um Komponenten handelt, die sich gegenseitig ausschließen. Vielmehr ermöglicht eine Kombination hieraus, dass Schüler und Schülerinnen spielerisch ihre Sozialkompetenzen, politische Urteilsfähigkeit und Handlungsfähigkeit ausbauen, sowie ihre methodischen Kompetenzen erweitern. Von besonderer Bedeutung für die politische Bildung sind Diskussions- und Entscheidungsspiele. So lernen Schüler und Schülerinnen beispielsweise in einer Pro-Contra-Debatte, dass es für eine bestimmte politische Ja-Nein-Streitfrage keine einvernehmliche Lösung gibt, da der Gehalt in hohem Maße kontrovers ist. In einer solchen Debatte lernen die Schüler und Schülerinnen beispielsweise Argumente aufzubereiten, Gegenargumente zu entwickeln oder multiperspektivisch einen Sachverhalt zu durchleuchten und sich in die Rollen ihrer Kontrahenten hineinzuversetzen. Die Pro-Contra-Debatte ist für das Erreichen der Lernziele des Politikunterrichts von erheblicher Bedeutung. Spiele müssen jedoch nicht immer fest in der Erarbeitungsphase des Politikunterrichts verankert sein. Gerade zu Beginn einer neuen Unterrichtseinheit sind Assoziations- und Einstiegsspiele besonders wertvoll und sorgen für einen belebenden Unterrichtseinstieg. Durch den gezielten Einsatz diverser Einstiegsspiele, wird zu Beginn der Unterrichtsstunde das Interesse der Schüler und Schülerinnen für das zu behandelnde Thema geweckt, sowie deren Vorwissen aktiviert.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Spielen im Politikunterricht
2.1 Was versteht man unter Spielen?
2.2 Welche Bedeutung haben Spiele im Politikunterricht?
3. Spielender Einstieg in den Unterricht
4. Diskussions- und Entscheidungsspiele und deren Berechtigung
4.1 Was bieten Diskussions- und Entscheidungsspiele im Politikunterricht?
4.2 Das Potenzial der Pro-Contra-Debatte
5. Zusammenfassung und Fazit
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Warum werden Spiele im Politikunterricht eingesetzt?
Spiele erhöhen die Attraktivität des Fachs und fördern die politische Urteils- und Handlungsfähigkeit sowie die Sozialkompetenz der Schüler.
Welche Spielformen gibt es im Politikunterricht?
Das Spektrum reicht von Assoziations- und Einstiegsspielen über Simulations- und Diskussionsspiele bis hin zu szenischen Spielformen.
Was ist der Vorteil einer Pro-Contra-Debatte?
Schüler lernen, Argumente aufzubereiten, multiperspektivisch zu denken und sich in die Rollen ihrer Kontrahenten hineinzuversetzen.
Wann sollten Einstiegsspiele genutzt werden?
Einstiegsspiele sind ideal zu Beginn einer neuen Unterrichtseinheit, um das Interesse zu wecken und Vorwissen zu aktivieren.
Schließen sich Spielen und Lernen im Unterricht aus?
Nein, im Gegenteil: Die Kombination ermöglicht eine ungezwungene und effektive Erweiterung methodischer und sozialer Kompetenzen.
- Arbeit zitieren
- Nils Hübinger (Autor:in), 2010, Spielerisch Lernen im Politikunterricht, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/213778