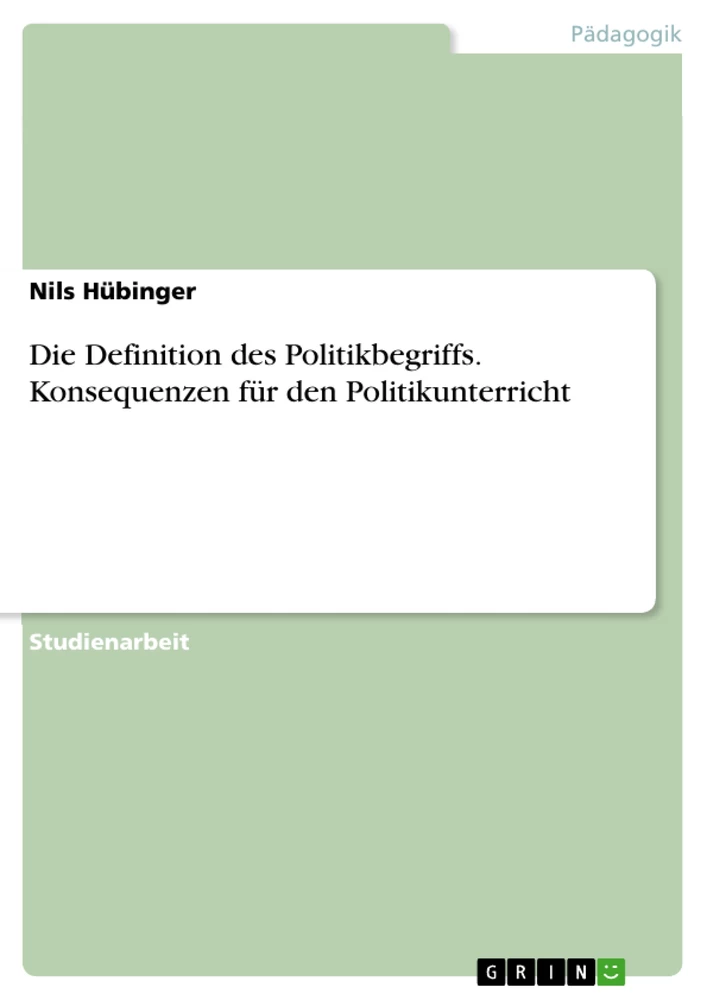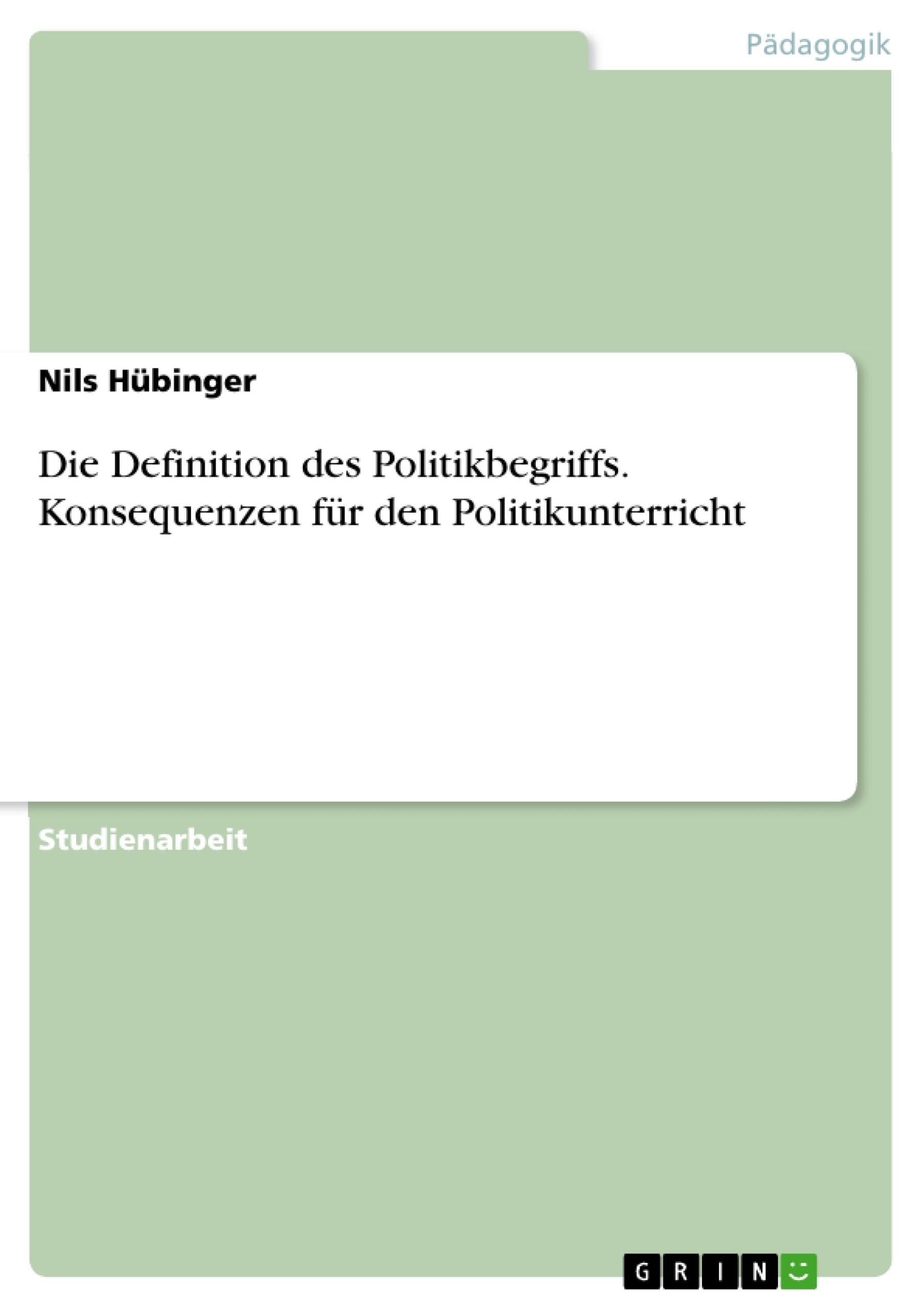Der Begriff „Politik“ wird im täglichen Leben auf vielfältige Weise verwendet. Für die Einen ist Politik menschliches Handeln um Konflikte zu lösen, für die Anderen ist es die Grundlage gesellschaftlichen Zusammenlebens. Manche sehen in der Politik ein Mittel zur Förderung des Gemeinwohls, während andere sie als reines Machtmittel auffassen. Oftmals wird der Begriff „Politik“ auch in Zusammenhang mit staatlichem Handeln genannt. Übereinstimmend lässt sich konstatieren, dass Politik etwas mit Macht, dem Staat, Gemeinwohl und Konflikten zu tun hat. Doch wieso fällt es so schwer den Politikbegriff eindeutig zu definieren und wie soll sich daraufhin die politische Bildung mit dem Gegenstandsfeld Politik auseinandersetzen?
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Definition des Gegenstandsfeldes „Politik“ und dessen unmittelbare Auswirkung auf die politische Bildung, bzw. den Politikunterricht in der Schule
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Komplexität des Politikbegriffs
- Konsequenzen verschiedener Politikbegriffe für den Unterricht
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Schwierigkeiten bei der Definition des Begriffs „Politik“ und die daraus resultierenden Konsequenzen für den Politikunterricht. Ziel ist es, die Vielschichtigkeit des Politikbegriffs aufzuzeigen und dessen Einfluss auf die politische Bildung zu beleuchten.
- Die Komplexität und Vielschichtigkeit des Politikbegriffs
- Der Einfluss verschiedener Definitionen auf den Politikunterricht
- Die Rolle von Macht, Herrschaft und Gemeinwohl im Politikbegriff
- Der Einfluss subjektiver Wahrnehmung und gesellschaftlicher Faktoren
- Die Bedeutung des historischen Kontextes für das Verständnis von Politik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Frage nach der Schwierigkeit einer eindeutigen Definition des Politikbegriffs und dessen Auswirkungen auf die politische Bildung. Es wird die Vielschichtigkeit des Begriffs im Alltag und in der wissenschaftlichen Literatur aufgezeigt und die Zielsetzung der Arbeit, die Untersuchung der Definition des Begriffs „Politik“ und dessen Auswirkung auf den Politikunterricht, dargelegt.
Die Komplexität des Politikbegriffs: Dieses Kapitel analysiert die Schwierigkeiten bei der Definition eines allgemeingültigen Politikbegriffs. Es werden unterschiedliche Definitionen aus Lexika und die Perspektiven von Politikwissenschaftlern wie Wolfgang Sander und Karl Rohe vorgestellt, die die Vielschichtigkeit des Begriffs hervorheben. Die Kapitel erläutert, wie gesellschaftliche, wissenschaftliche und anthropologische Grundannahmen die jeweilige Interpretation des Politikbegriffs beeinflussen und zu einem differenzierten Verständnis führen. Der Einfluss subjektiver Wahrnehmung, historischer Kontext und die ständige Veränderung des Politikgegenstandes werden detailliert diskutiert, um die Unmöglichkeit einer einfachen, allumfassenden Definition zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Politikbegriff, Politische Bildung, Politikunterricht, Macht, Herrschaft, Gemeinwohl, Konflikt, Subjektivität, Gesellschaft, Wissenschaft, Definition, Vielschichtigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Der Politikbegriff und seine Konsequenzen für den Politikunterricht
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Schwierigkeiten bei der Definition des Begriffs „Politik“ und die daraus resultierenden Konsequenzen für den Politikunterricht. Sie beleuchtet die Vielschichtigkeit des Politikbegriffs und dessen Einfluss auf die politische Bildung.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Komplexität und Vielschichtigkeit des Politikbegriffs, den Einfluss verschiedener Definitionen auf den Politikunterricht, die Rolle von Macht, Herrschaft und Gemeinwohl im Politikbegriff, den Einfluss subjektiver Wahrnehmung und gesellschaftlicher Faktoren sowie die Bedeutung des historischen Kontextes für das Verständnis von Politik.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Komplexität des Politikbegriffs und ein Kapitel zu den Konsequenzen verschiedener Politikbegriffe für den Unterricht, sowie eine Zusammenfassung und ein Fazit. Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Forschungsfrage. Das Kapitel zur Komplexität analysiert verschiedene Definitionen und den Einfluss verschiedener Faktoren auf das Verständnis von Politik. Das Kapitel zu den Konsequenzen für den Unterricht beleuchtet die Auswirkungen der unterschiedlichen Definitionen auf die politische Bildung.
Wie wird die Komplexität des Politikbegriffs dargestellt?
Die Hausarbeit analysiert die Schwierigkeiten bei der Definition eines allgemeingültigen Politikbegriffs. Sie präsentiert unterschiedliche Definitionen aus Lexika und die Perspektiven von Politikwissenschaftlern. Sie erläutert, wie gesellschaftliche, wissenschaftliche und anthropologische Grundannahmen die Interpretation des Politikbegriffs beeinflussen. Der Einfluss subjektiver Wahrnehmung, des historischen Kontextes und der ständigen Veränderung des Politikgegenstandes wird diskutiert, um die Unmöglichkeit einer einfachen, allumfassenden Definition zu verdeutlichen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Politikbegriff, Politische Bildung, Politikunterricht, Macht, Herrschaft, Gemeinwohl, Konflikt, Subjektivität, Gesellschaft, Wissenschaft, Definition, Vielschichtigkeit.
Was ist das Ziel der Hausarbeit?
Das Ziel der Hausarbeit ist es, die Vielschichtigkeit des Politikbegriffs aufzuzeigen und dessen Einfluss auf die politische Bildung zu beleuchten. Sie möchte die Schwierigkeiten einer eindeutigen Definition des Politikbegriffs und dessen Auswirkungen auf den Politikunterricht herausstellen.
- Quote paper
- Nils Hübinger (Author), 2009, Die Definition des Politikbegriffs. Konsequenzen für den Politikunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/213624