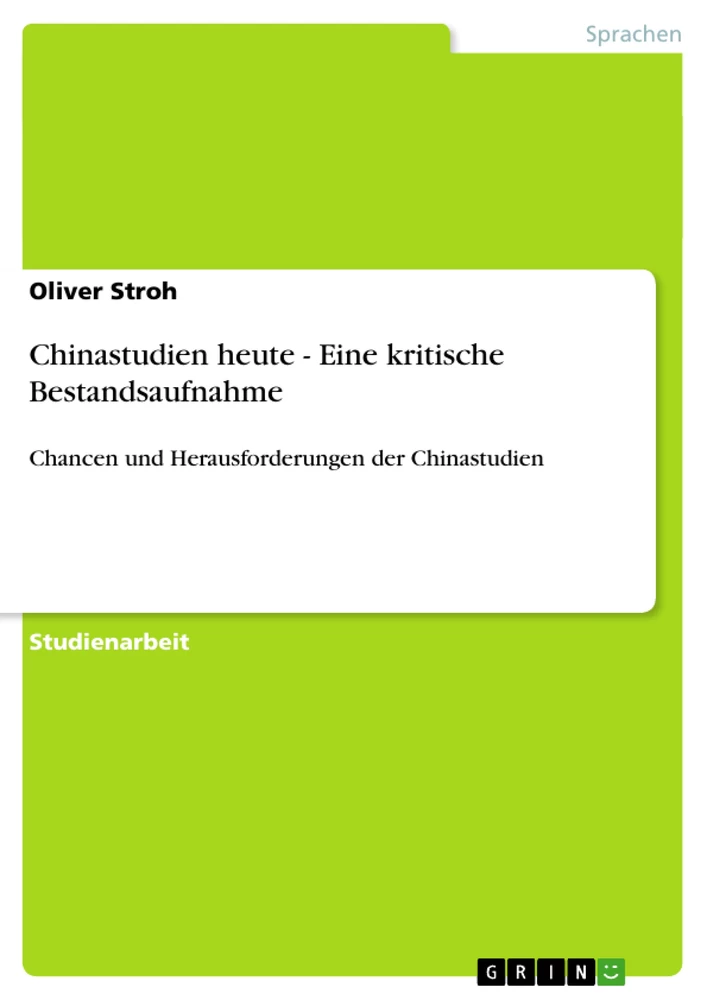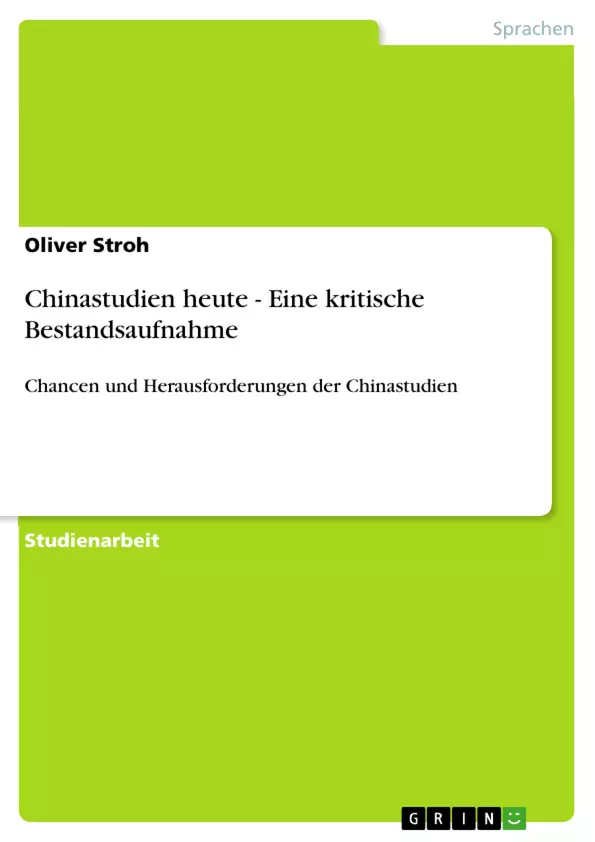„Man bedenke, dass die Sinologie sowohl die Kenntnis des Altertums, als auch durch diese die der Gegenwart vermitteln soll.“ (Otto Franke)
Obwohl dieses Zitat des deutschen Sinologen Otto Franke bereits aus dem Jahre 1911 stammt, ist seine scheinbare zeitlose Aussagekraft bis heute eines der zentralen Spannungsfelder, in denen sich die gegenwärtige Sinologie bewegt. Schließlich inkludiert Frankes Aussage nicht nur das Erschließen und Bewahren interessanter Bestandteile der Menschheitsgeschichte, sondern gleichzeitig umfasst seine Definition ebenso die chinesische Gegenwart, welche durch die sinologische Erforschung des Altertums erkannt und erklärt werden soll.1
Kurz gesagt geht es darum, mit Hilfe der in jahrhundertealter Tradition aufgezeichneten kulturellen Errungenschaften Chinas die aktuellen dortigen sozialen, politischen, geistigen und nicht zuletzt ökonomischen Verhältnisse verstehen und veranschaulichen zu können. Die entscheidende Frage dabei ist allerdings, mit welchen Inhalten, Paradigmen, Werten und Mitteln diese sinologische Wissensvermittlung in Deutschland stattfinden soll. Zwar ist diese Frage beinahe genauso alt wie das Betätigungsfeld der Sinologie selber, nichtsdestotrotz ist eine finale, allgemeingültige und zugleich umfassende Beantwortung dieser Frage im wissenschaftlichen Diskurs noch lange nicht in Sicht.
Aus diesem Grund setzt sich die vorliegende Hausarbeit mit aktuellen Kritikpunkten und Problemen der deutschen Sinologie, aber auch mit ihren Chancen sowie vieldiskutierten Lösungsansätzen zur Bewältigung der zuvor dargelegten Problematiken auseinander.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Sinologie in Deutschland – Eine Definition
- 3. Das Selbstbild der deutschen Sinologie zu Beginn des 20. Jahrhunderts
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht aktuelle Kritikpunkte und Herausforderungen der deutschen Sinologie, beleuchtet Chancen und Lösungsansätze. Sie analysiert die Sinologie als interkulturellen Wissenstransfer und untersucht das Selbstverständnis der Sinologie zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Kontext gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen.
- Definition und Entwicklung der Sinologie in Deutschland
- Das Selbstbild der deutschen Sinologie zu Beginn des 20. Jahrhunderts
- Kritikpunkte und Herausforderungen der gegenwärtigen Chinaforschung
- Lösungsansätze und zukünftige Potentiale
- Sinologie als interkultureller Wissenstransfer
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Frage nach der Wissensvermittlung in der deutschen Sinologie. Sie thematisiert die zeitlose Relevanz von Otto Frankes Aussage über die Sinologie als Brücke zwischen dem Verständnis des alten und des modernen Chinas. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich mit aktuellen Problemen, Chancen und Lösungsansätzen der deutschen Sinologie auseinandersetzt. Sie betont die Bedeutung des gesellschaftlichen Kontextes für die sinologische Forschung und leitet zur Analyse der Paradigmen-Debatte in Bezug auf den chinesischen Modernisierungsprozess über.
2. Die Sinologie in Deutschland – Eine Definition: Dieses Kapitel definiert die Sinologie als Wissenschaft, die sich aus deutscher Perspektive mit der chinesischen Gesellschaft auseinandersetzt. Es betont die interkulturelle Natur dieser Auseinandersetzung, da der wissenschaftliche Erfahrungsraum durch die eigene Gesellschaft (Deutschland) geprägt ist. Das Kapitel hebt die Bedeutung des interkulturellen Wissenstransfers hervor und umfasst sowohl die universitäre als auch die außeruniversitäre Chinaforschung, wobei die Begriffe Sinologie, Chinastudien und Chinawissenschaften synonym verwendet werden.
3. Das Selbstbild der deutschen Sinologie zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Dieses Kapitel analysiert das Selbstbild der deutschen Sinologie zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Kontext des damaligen gesellschaftlichen und politischen Klimas. Es wird deutlich, dass ein massives Überlegenheitsdenken gegenüber China vorherrschte, wobei sinologische Forschung stark von kolonialpolitischen Interessen geleitet war. Die Kapitel stellt die gegensätzlichen Ansichten von Jan J.M. de Groot, einem Vertreter eines stark missionarischen und zivilisatorischen Ansatzes, und Wilhelm Grube gegenüber, der eine weniger aggressive, aber dennoch hegemoniale Rolle Europas postuliert. Beide vertraten ein negatives Bild der chinesischen Kultur, das auf verschiedenen Argumentationslinien basierte.
Schlüsselwörter
Sinologie, Chinawissenschaften, Chinastudien, interkultureller Wissenstransfer, Modernisierungsprozess Chinas, Kolonialismus, Zivilisierungsparadigma, Chinaforschung, wissenschaftliche Paradigmen, gesellschaftspolitischer Kontext.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Die Deutsche Sinologie – Ein kritischer Blick
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit untersucht die deutsche Sinologie, ihre Entwicklung, aktuelle Herausforderungen und zukünftige Potentiale. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Selbstverständnis der Sinologie zu Beginn des 20. Jahrhunderts und ihrer Rolle als interkultureller Wissenstransfer.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Entwicklung der Sinologie in Deutschland, das Selbstbild der deutschen Sinologie zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Kontext gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen, aktuelle Kritikpunkte und Herausforderungen der Chinaforschung, sowie Lösungsansätze und zukünftige Potentiale der Sinologie als interkultureller Wissenstransfer.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Definition der Sinologie in Deutschland, ein Kapitel zum Selbstbild der deutschen Sinologie zu Beginn des 20. Jahrhunderts und beinhaltet eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche zentrale Frage wird in der Einleitung gestellt?
Die Einleitung thematisiert die zentrale Frage nach der Wissensvermittlung in der deutschen Sinologie und der zeitlosen Relevanz von Otto Frankes Aussage über die Sinologie als Brücke zwischen dem Verständnis des alten und des modernen Chinas.
Wie wird die Sinologie in dieser Arbeit definiert?
Die Sinologie wird als Wissenschaft definiert, die sich aus deutscher Perspektive mit der chinesischen Gesellschaft auseinandersetzt und die interkulturelle Natur dieser Auseinandersetzung betont. Die Begriffe Sinologie, Chinastudien und Chinawissenschaften werden synonym verwendet.
Wie wird das Selbstbild der deutschen Sinologie zu Beginn des 20. Jahrhunderts beschrieben?
Das Kapitel analysiert ein massives Überlegenheitsdenken gegenüber China, wobei sinologische Forschung stark von kolonialpolitischen Interessen geleitet war. Es werden gegensätzliche Ansichten von Jan J.M. de Groot und Wilhelm Grube gegenübergestellt, die beide ein negatives Bild der chinesischen Kultur vertraten, wenngleich auf unterschiedlichen Argumentationslinien basierend.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Sinologie, Chinawissenschaften, Chinastudien, interkultureller Wissenstransfer, Modernisierungsprozess Chinas, Kolonialismus, Zivilisierungsparadigma, Chinaforschung, wissenschaftliche Paradigmen, gesellschaftspolitischer Kontext.
Welche Perspektiven werden in der Hausarbeit eingenommen?
Die Hausarbeit nimmt eine kritische Perspektive auf die deutsche Sinologie ein, analysiert sowohl historische als auch gegenwärtige Entwicklungen und beleuchtet die Sinologie als interkulturellen Wissenstransfer im Kontext gesellschaftlicher und politischer Einflüsse.
- Arbeit zitieren
- Oliver Stroh (Autor:in), 2012, Chinastudien heute - Eine kritische Bestandsaufnahme, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/210007