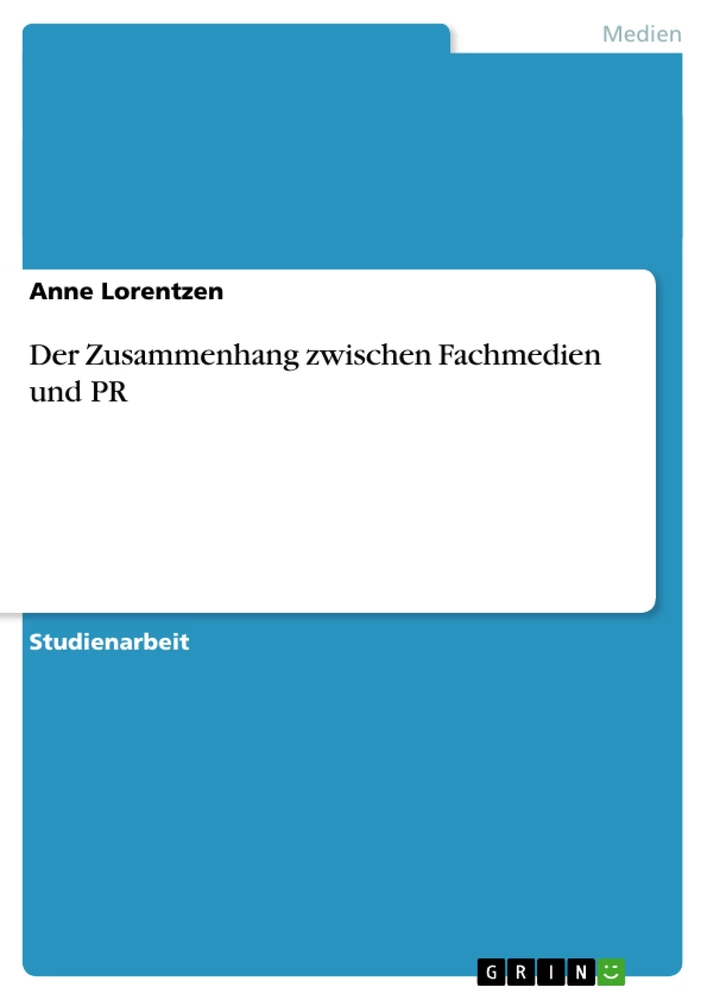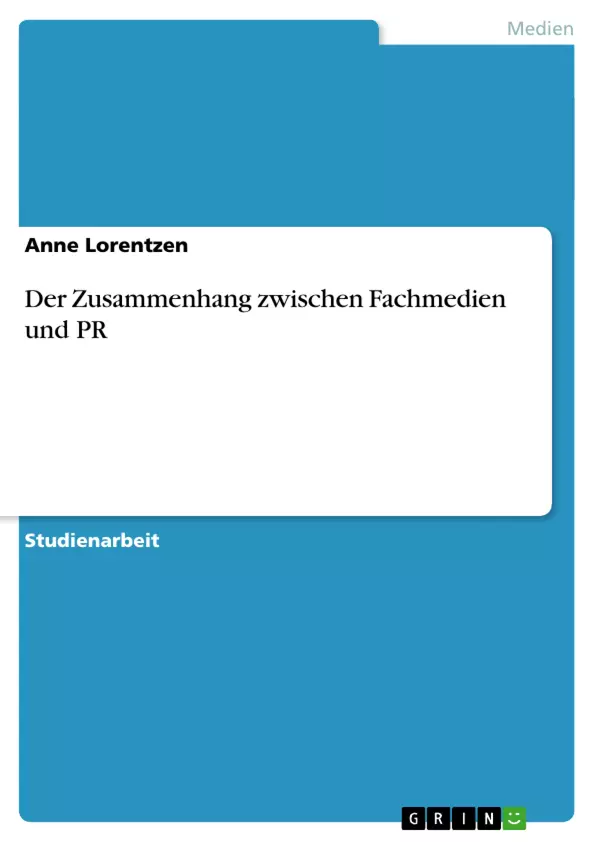Schlägt man ein beliebiges Magazin auf und durchblättert es, so ist es kaum möglich die darin enthaltene Werbung nicht zu sehen, sie erschlägt den Leser nahezu. Bei genauerem hinsehen entdeckt der Leser wahrscheinlich auch, dass sich Werbung nicht nur in halbseitigen Anzeigen findet, sondern auch in den journalistischen Beiträgen. Was un-abhängige journalistische Recherche vermuten lässt, ist zum Teil nichts anderes als Gefälligkeitsjournalismus, hübsch verpackte PR-Artikel, die unkritisch und unreflektiert übernommen wurden. Günter Bentele ist der Ansicht, dass dies in der Fach-PR unwahrscheinlicher ist, da dort auch die Journalisten Fachleute sein. Die vorliegende Arbeit setzt sich genau mit diesem Thema auseinander. Anhand von drei Fachmagazinen aus dem Bereich der Klassischen Musik sollen Hinweise für den Zusammenhang zwischen Fachjournalismus und PR aufgezeigt werden. Als theoretische Vorüberlegungen werden zuerst die Begrifflichkeiten „Fachjournalismus“, „Musikjournalismus“ sowie „Fach-PR“ definiert und in Zusammenhang gebracht. Ebenso werden die Determinationsthese und das Intereffikationsmodell erläutert. In den Methoden wird kurz auf die Inhaltsanalyse eingegangen sowie die Rahmenbedingungen der Untersuchung abgesteckt. Nachfolgend geht es in die Analyse der drei ausgewählten Zeitschriften. Hier werden nach einem kurzen Blick in die Mediadaten ausgewählte Beiträge vorgestellt und auf ihren Inhalt – insbesondere auf möglichen PR-Einsatz hin untersucht. Abschließend sollen dann die im Methodenteil aufgestellten Annahmen überprüft werden.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Theorie
2.1. Definition Fachjournalismus, Musikjournalismus, Fach-PR
2.2. Determinationsthese
2.3. Intereffikationsmodell
2.4. Besonderheiten im Verhältnis von Fachjournalismus und Fach-PR
3. Methoden
4. PR als Quelle in Fachmedien am Beispiel
4.1. MusikForum
4.2. Neue Zeitschrift für Musik
4.3. crescendo
5. Fazit
Quellenverzeichnis
Zeitschriften:
Internetquellen:
1. Einleitung
Schlägt man ein beliebiges Magazin auf und durchblättert es, so ist es kaum möglich die darin enthaltene Werbung nicht zu sehen, sie erschlägt den Leser nahezu. Bei genauerem hinsehen entdeckt der Leser wahrscheinlich auch, dass sich Werbung nicht nur in halbseitigen Anzeigen findet, sondern auch in den journalistischen Beiträgen. Was unabhängige journalistische Recherche vermuten lässt, ist zum Teil nichts anderes als Gefälligkeitsjournalismus, hübsch verpackte PR-Artikel, die unkritisch und unreflektiert übernommen wurden. Günter Bentele ist der Ansicht, dass dies in der Fach-PR unwahrscheinlicher ist, da dort auch die Journalisten Fachleute sein.[1] Die vorliegende Arbeit setzt sich genau mit diesem Thema auseinander. Anhand von drei Fachmagazinen aus dem Bereich der Klassischen Musik sollen Hinweise für den Zusammenhang zwischen Fachjournalismus und PR aufgezeigt werden. Als theoretische Vorüberlegungen werden zuerst die Begrifflichkeiten „Fachjournalismus“, „Musikjournalismus“ sowie „Fach-PR“ definiert und in Zusammenhang gebracht. Ebenso werden die Determinationsthese und das Intereffikationsmodell erläutert. In den Methoden wird kurz auf die Inhaltsanalyse eingegangen sowie die Rahmenbedingungen der Untersuchung abgesteckt. Nachfolgend geht es in die Analyse der drei ausgewählten Zeitschriften. Hier werden nach einem kurzen Blick in die Mediadaten ausgewählte Beiträge vorgestellt und auf ihren Inhalt – insbesondere auf möglichen PR-Einsatz hin untersucht. Abschließend sollen dann die im Methodenteil aufgestellten Annahmen überprüft werden.
2. Theorie
2.1. Definition Fachjournalismus, Musikjournalismus, Fach-PR
„Unsere aktuelle Gesellschaftsform lässt sich wesentlich als marktwirtschaftlich organisierte Informations- und Kommunikationsgesellschaft kennzeichnen“[2], so beginnt Günter Bentele die einleitenden Worte zu seinem Sammelband „PR für Fachmedien“. Er erklärt dann nachfolgend kurz, wie eine solche Gesellschaft aufgebaut ist und was ihre wesentliche Bestandteile sind. Unter Punkt drei fallen dann auch erstmals die Worte Public Relations, deren Verbindung zur Informationsgesellschaft er kurz darlegt ohne näher darauf einzugehen.
Fachjournalismus ist die Informationsvermittlung von Experten zu Experten, die zwar bereits in den Wurzeln des Wissenschaftsjournalismus verankert ist, aber trotzdem zu den neuen journalistischen Ausprägungen gehört.
„Der Idealtypus des Fachjournalismus sammelt Themen und Informationen in einem – meist durch berufliche Interessen – eingegrenztes Fachgebiet, bearbeitet diese nach allgemeinen publizistischen Regeln (Recherche, Genres, Nachrichtenwerte, Layout etc.) und auf der Grundlage eines spezifischen an Wissen und Erfahrungen der Produzenten wie der Rezipienten anknüpfenden Programms. […] Fachjournalismus nutzt verschiedene fachkompetente, v.a. wissenschaftliche Quellen und stellt das Produkt einer eingrenzbaren, relativ homogenen Nutzergruppe zur Verfügung.“[3]
Beatrice Dernbach gibt hier eine sehr umfangreiche und vielsagende Definition für Fachjournalismus. Sie führt weiter aus, dass sich in Bezug auf Aktualität, Periodizität, Universalität und Publizität eigene fachjournalistische Standards ergeben. Das bedeutet, dass nur Themen gewählt werden, die für die Akteure des Themenfeldes relevant und aktuell sind. Jene Informationen werden dann zwar in Formaten publiziert, die einem breiten Publikum zur Verfügung stehen, sind jedoch durch ihre sehr spezielle Themenauswahl im Verbreitungskreis eingeschränkt und eher an einen potenziellen Rezipientenkreis gerichtet. Daher findet sich Fachjournalismus überwiegend in Fachzeitschriften und Very-Special-Interest Angeboten. Zentrale Funktionen des Fachjournalismus sind die Wissensvermittlungs-, die Bildungs- sowie die (berufliche) Sozialisationsfunktion, der Beitrag zu Meinungsbildung sowie auch die Ratgeber-, Service- und Orientierungsfunktion in relevanten Wissensgebieten.[4] Fachjournalismus ist aber eben nicht nur, wie eingangs gesagt, das von Experten an Experten weitergegebene Wissen, sondern vermittelt jenes zum Teil auch in die Laienwelt. Dieses richtet sich danach, was für eine Zielgruppe damit angesprochen werden soll und welche Themenschwerpunktsetzung es gibt.
Da es in der folgenden Untersuchung um Musikjournalismus im Speziellen geht, soll dieser hier genauer erläutert werden. Musikjournalismus kann definiert werden als „jede beschreibende, analysierende und bewertende Berichterstattung über musikalisches Geschehen und seine Zusammenhänge in Massenmedien“.[5] Ein Großteil dieser journalistischen Bestrebungen beschäftigt sich mit der Kritik oder der Rezension ernster Musik, der sogenannten E-Musik in Printmedien.[6] Beatrice Dernbach hält fest, dass die Aufgaben des Musikjournalismus vielfältig sind. Zum einen gehöre dazu alles, was mit Produktion, Verbreitung und Rezeption zu tun hat, beispielsweise also Veranstaltungsankündigungen, Neuerscheinungen und Kritiken. Andererseits aber auch den Musikbereich im Gesamten zu beobachten, zu bewerten und kommentieren und so zum Beispiel Nachrufe auf bedeutende Künstler zu verfassen und neue Bewegungen auf dem Musikmarkt zu verfolgen.[7] Wie all diese Anforderungen in welchem Maße umgesetzt werden, hängt selbstverständlich davon ab, an welche Zielgruppe in welcher musikalischen Sparte sie der Journalismus richtet. Bedeutend für den Musikjournalismus ist, dass Musik zu einem ständigen Begleiter im Alltag geworden ist, egal ob über bewusst über Kopfhörer in der S-Bahn oder über die Lautsprecher im Auto aufgenommen, oder unbewusst über das Radio im Einkaufszentrum oder beim Friseur. Gerade in einer Zeit, in der jeder zu jeder Zeit, an jedem Ort Musik hören kann, sie bewerten aber auch selbst Musikmachen kann, spielt der Musikjournalismus eine entscheidende Rolle, vor allem um neue Entwicklungen, die insbesondere durch die schnelle Verbreitungsmöglichkeit der Internets gegeben sind, zu reflektieren
Heute findet Musikjournalismus hauptsächlich in Fachzeitschriften statt, wodurch sich dieser, insbesondere auch durch seinen stark ausgeprägten Fachjargon, selbst in die Isolation manövriert. Es gibt jedoch Bestrebungen, zum Beispiel des Deutschen Musikrats, solche Entwicklungen zu stoppen. Dies soll vor allem durch stärkere Medienpräsenz zeitgenössischer Musik, den Ausbau des fachlichen Diskurses und durch verbesserte Rahmenbedingungen für Musikjournalisten geschehen.[8]
Zur Nutzung und Wirkung von Musikjournalismus liegen allenfalls fragmentarische Befunde vor. So schreibt Reus: „Als gesichert kann gelten: Wer sich auf Wortbeiträge über Musikgeschehen überhaupt einlässt, erwartet in erster Linie Information, Beschreibung und Einordnungshilfen. Das trifft alters- und genreübergreifend sowohl auf Klassikhörer im Radio zu […] wie auf die jugendlichen Hörer von Spartenangeboten […] und die Nutzer von (Online-)Musikzeitschriften.“[9]
Zu neuen Ausprägungen kommt es auch im Bereich der Public Relations, vor allem durch die Entwicklung von PR-Agenturen. Fach-PR ist hierbei als fachlich spezialisierte PR zu sehen, „die sich an spezifische und spezialisierte Fachöffentlichkeiten richtet.“[10] Nach Dernbach hat Fach-PR zur Ziel, Organisations- und Kommunikationsinteressen durchzusetzen, und insbesondere Beziehungen zu speziellen Teilöffentlichkeiten aufzubauen und zu pflegen. Eine der Hauptaufgaben ist der Aufbau und die Aufrechterhaltung von Kontakten zu den Zielgruppen, also im Speziellen Fachjournalisten, Kunden und Geschäftspartnern. Fach-PR findet sich vorwiegend in Business-to-business-Publikationen, Broschüren, Newslettern sowie Kunden-, Mitarbeiter- und Mitgleider-zeitschriften. Die Zielgruppe definiert sich sowohl in interne, also Mitglieder, wie externe, Kunden, Partner und andere, insbesondere aber in der Fachöffentlichkeit im Sinne der am Thema interessierten erreichbaren Personen, sowie Medien und Journalisten als Multiplikator.[11]
Von großer Bedeutung ist, dass sowohl auf der Sender-, also der PR-Seite, also auch auf der Empfängerseite Journalisten und Experten arbeiten. Dies unterscheidet im Wesentlichen, neben Faktoren wie der Zahl der Empfänger-Medien oder der Beziehungen zu den Zielgruppen, Fach-PR von Publikums-PR.[12] Hierbei spielen primär die Sach- und die Fachkompetenz eine hervortretende Rolle. Sachkompetenz bezieht sich hierbei auf den Gegenstand und Bereich der Kommunikation, wohingegen Fachkompetenz eher auf das kommunikative Produktions- und Vermittlungswissen der kommunikativen Tätigkeit abzielt. Hinzu kommt in einigen Fällen ebenfalls die reflexive Kompetenz, also jene Kompetenz, das eigene Handeln zu reflektieren. Sachkompetenz ist für Kommunikationsverantwortliche in jeder Branche Grundvoraussetzung und sollte zumindest in den Grundzügen beherrscht werden. Es braucht also für eine sachkompetente Kommunikation eine fachliche Spezialisierung auf beiden Seiten. Die Vereinigung aller drei Kompetenzen gilt als Ideal, wird aber nur selten zur Realität. „Fachöffentlichkeitsarbeit bewegt sich in aller Regel auf einem fachlich bzw. inhaltlich hohen Niveau.“[13], da hier Prinzip wie beim sprechen einer gemeinsamen Fremdsprache greift: man versteht sich, ohne große Übersetzungsarbeit leisten zu müssen.
2.2. Determinationsthese
Obwohl sie den Begriff nie selbst benutzt hat, geht die Determinationsthese doch auf Barbara Baerns und die von ihr 1985 durchgeführte Studie „Öffentlichkeitsarbeit oder Journalismus. Zum Einfluß im Mediensystem“ zurück. Diese Untersuchung fokussiert, ob und welche Rolle Öffentlichkeitsarbeit als Quelle von Nachrichten spielt. Baerns macht das am Beispiel der Landespolitik Nordrhein-Westfalens und weist dabei nach, dass Öffentlichkeitsarbeit Themen und Timing der Medienberichterstattung unter Kontrolle hat. Erst im Nachhinein wurde an Hand dieser Feststellung der Begriff der „Determinationsthese“ oder auch „Determinierungshypothese“ geprägt.[14]
Die Anfangsfragestellung könnte also lauten, warum über verschiedene Medien hinweg so hohe Übereinstimmung bei der Behandlung von Themen auftritt. Die Determinationsforschung versucht hier durch die Untersuchung der Inhalte Rückschlüsse auf den Umgang mit Quellen und der journalistischen Selektion zu ziehen.[15]
In der ersten empirischen Untersuchung zu diesem Themenbereich untersuchte Leon Sigal (1973) in wie weit Informationsbeschaffung journalistische Routine ist, in dem er alle redaktionellen Beiträge, die innerhalb von zwei Wochen in der New York Times und der Washington Post erschienen, in drei Kategorien einteilte: standardisierte Informationskanäle, also Pressekonferenzen, Pressemitteilungen und offizielle Anlässe, informelle Kanäle wie Hintergrundgespräche und die journalistische Eigenleistung. Nachdem er die Untersuchung fünfmal im Abstand von jeweils fünf Jahren wiederholte, gelangte Sigal zu dem Ergebnis, dass bei über 70 Prozent der untersuchten Beiträge der Aufhänger auf standardisierte Informationsquellen zurückzuführen sei.[16]
[...]
[1] Vgl. Bentele, Günter (2006), PR für Fachmedien, S. 17.
[2] Bentele, S. 11.
[3] Dernbach, Beatrice (2010), Vielfalt des Fachjournalismus, S. 43.
[4] Vgl. ebd. S. 43.
[5] Reus, Gunter(2008), Musikjournalismus, S. 86.
[6] Vgl. Reus, S. 89.
[7] Vgl. ebd. S. 195.
[8] www.musikrat.de
[9] Reus, S. 98.
[10] Bentele, S. 14.
[11] Vgl. ebd. S. 96-99.
[12] Vgl. Bentele, S. 18.
[13] Bentele, S. 16.
[14] Vgl. Raupp, Juliana, Determinationsthese. In: Handbuch der Public Relations, S.192.
[15] Vgl. Raupp S. 193
[16] Vgl. Raupp, S. 193
- Quote paper
- Anne Lorentzen (Author), 2012, Der Zusammenhang zwischen Fachmedien und PR, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/209883