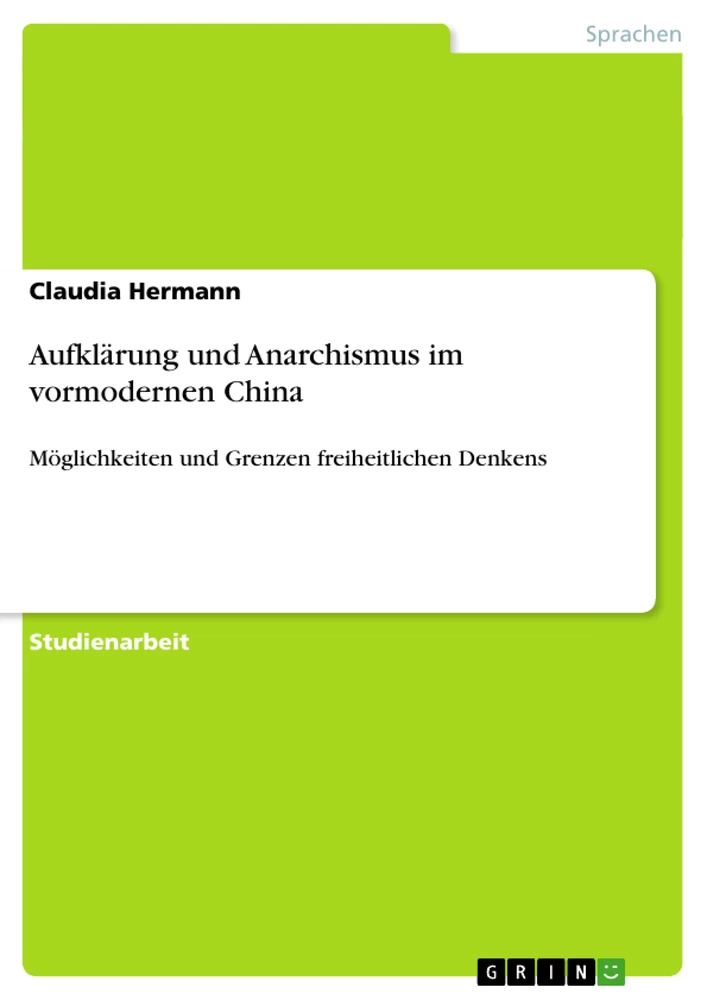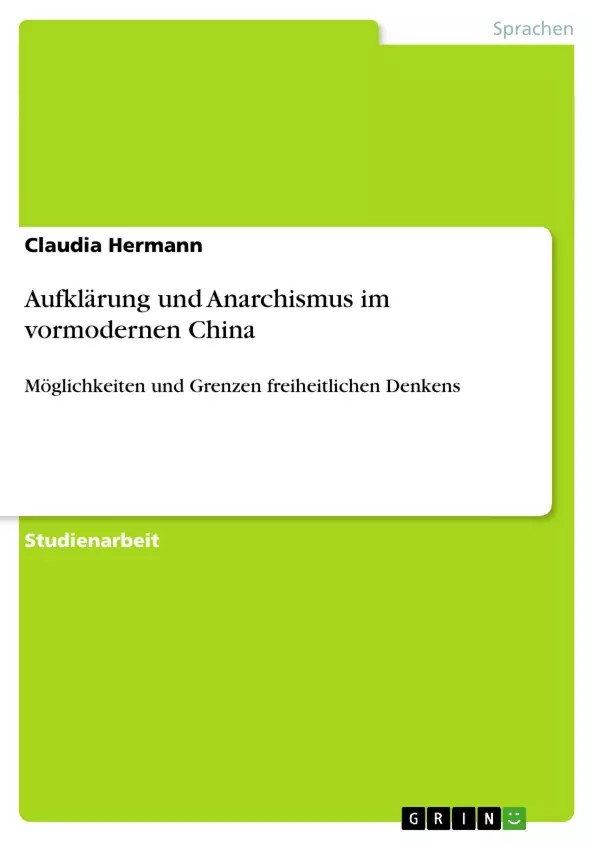Ziel dieser Hausarbeit ist es aufklärerische und anarchistische Denkweisen im vormodernen China aufzuzeigen und zu untersuchen, inwiefern die chinesische Geschichte dem allgemeinen Vorurteil gerecht wird, in China gäbe es keine demokratische Traditionen und freiheitlichen Denker. Dabei werde ich nicht detailliert auf die umfangreichen Darstellungen reformistischer Strömungen eingehen, da das der Rahmen dieser Hausarbeit nicht zulässt, sondern exemplarische Beispiele zu meinen Schwerpunktthemen Aufklärung und Anarchismus darlegen.
Trotz der berechtigten Kritik an eurozentrischen Paradigmen, werde ich zunächst den in meiner Arbeit fokussierten Begriff der Aufklärung aus europäischer Sicht erläutern. Im Sinne einer vergleichenden Analyse gehe ich sodann auf die Rolle der chinesischen Philosophen des 17. Jahrhunderts ein, die während des Untergangs der Ming-Dynastie und der Machtetablierung der Mandschu ähnliche Ansichten vertraten wie die europäischen Aufklärer.
Die Diskussion über das Thema der Freiheit werde ich erweitern durch die Analyse der Stellung des Individuums in China. Am Beispiel des Neo-Konfuzianismus sollen Kriterien dargelegt werden, inwiefern entartete Tradition bei der Umsetzung von freiheitlichen Ideen hinderlich sein kann.
Darauf aufbauend gehe ich auf die Idee des Anarchismus ein. Zunächst im Allgemeinen versuche ich dann im Daoismus anarchistische Tendenzen aufzuzeigen.
In Folge verwende ich das Hanyu-Pinyin als Umschrift für das Chinesisch. Ausgenommen hiervon sind wörtliche Zitate und Buchtitel mit anderen Umschriften.
Inhalt
1. Einleitung
2. Die universelle Idee der Aufklärung
2.1 Verstand und Freiheit in der Aufklärung Europas
2.2 Aufklärerische Tendenzen des 17. Jahrhunderts in China
3. Kollektiv vs. Individuum
3.1 Konfuzianische Ethik – Pro und Kontra
4. Die Idee der Anarchie
4.1 Anarchie im Daoismus
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Ziel dieser Hausarbeit ist es aufklärerische und anarchistische Denkweisen im vormodernen China aufzuzeigen und zu untersuchen, inwiefern die chinesische Geschichte dem allgemeinen Vorurteil gerecht wird, in China gäbe es keine demokratische Traditionen und freiheitlichen Denker. Dabei werde ich nicht detailliert auf die umfangreichen Darstellungen reformistischer Strömungen eingehen, da das der Rahmen dieser Hausarbeit nicht zulässt, sondern exemplarische Beispiele zu meinen Schwerpunktthemen Aufklärung und Anarchismus darlegen.
Trotz der berechtigten Kritik an eurozentrischen Paradigmen, werde ich zunächst den in meiner Arbeit fokussierten Begriff der Aufklärung aus europäischer Sicht erläutern. Im Sinne einer vergleichenden Analyse gehe ich sodann auf die Rolle der chinesischen Philosophen des 17. Jahrhunderts ein, die während des Untergangs der Ming-Dynastie und der Machtetablierung der Mandschu ähnliche Ansichten vertraten wie die europäischen Aufklärer.
Die Diskussion über das Thema der Freiheit werde ich erweitern durch die Analyse der Stellung des Individuums in China. Am Beispiel des Neo-Konfuzianismus sollen Kriterien dargelegt werden, inwiefern entartete Tradition bei der Umsetzung von freiheitlichen Ideen hinderlich sein kann.
Darauf aufbauend gehe ich auf die Idee des Anarchismus ein. Zunächst im Allgemeinen versuche ich dann im Daoismus anarchistische Tendenzen aufzu-zeigen.
In Folge verwende ich das Hanyu-Pinyin als Umschrift für das Chinesisch. Ausgenommen hiervon sind wörtliche Zitate und Buchtitel mit anderen Um-schriften.
2. Die universelle Idee der Aufklärung
Die Aufklärung und der Begriff der Aufklärung ist eine europäische Idee, die sich aufgrund der politischen und religiösen Situation im 17. und 18. Jahrhundert in Europa formierte. Interessant jedoch sind in diesem Zusammenhang die Parallelen, die man zur gleichen Zeit auch in China beobachten kann. Der Untergang der Ming-Dynastie und die Eroberung Chinas durch die Mandschu (1644) brachte eine neue Generation an Philosophen hervor, deren Grundgedanken eine erstaunliche Ähnlichkeit zu denen der europäischen Philosophen aufweisen. Obwohl sich die chinesische Elite nach dieser kurzen Reformperiode den neuen mandschurischen Herrschern anschloss und der autoritäre Staat in der Qing-Dynastie eine letzte Blütezeit erreichte[1], so hatten doch die Ideen der chinesischen Philosophen dieser Zeit einen enormen Einfluss auf die Reformbewegungen des 19. und 20. Jahrhunderts, die schließlich in der Xinhai-Revolution und zur Gründung einer Republik in China mündeten. Aufgrund dieser Gemeinsamkeiten scheint mir der universelle Charakter der europäischen Aufklärung bewahrheitet. So heißt es wortwörtlich im ersten Artikel des deutschen Grundgesetzes: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflich-tung aller staatlichen Gewalt.“[2] Die Betonung liegt hier auf aller staatlichen Gewalt, was neben Deutschland auch alle anderen Staaten dieser Welt mit einschließt. Darin einbezogen ist nicht nur der rein praktische und rechtliche Aspekt der Gewährung von Menschenrechten, sondern auch die geistige Fähigkeit jedes Menschen zum freiheitlichen Denken überhaupt, unabhängig von Geburt und Erziehung.
Da die Aufklärungsbewegungen in den einzelnen Ländern Europas in unterschied-lichen Ursachen und Ereignissen begründet wurden und die Ausprägungen je nach Kulturraum unterschiedliche Formen annahmen, ist es sinnvoll von verschiedenen Aufklärungen in Europa zu sprechen.[3] So wurde in England mit der Glorious Revolution von 1688 der Weg zu einer parlamentarischen Monarchie bereitet, in Frankreich führte das Edikt von Nantes 1685 zur religiös motivierten brutalen Vertreibung der Protestanten und in Deutschland stieß eine Universitätsreform eine allgemeine Kultur- und Gesellschaftsreform an. Dennoch lassen sich Gemeinsamkeiten und grundsätzliche Ziele formulieren, die ich im Folgenden kurz skizzieren möchte.
2.1 Verstand und Freiheit in der Aufklärung Europas
Die europäische Aufklärung war eine Reaktion auf politische, religiöse und gesellschaftliche Verhältnisse im 17. Jahrhundert in Europa. Der Staat wurde von einem absolutistischen Herrscher regiert, der die uneingeschränkte Macht über die Führung des Landes und der Bevölkerung für sich beanspruchte. Der damit einhergehende Machtmissbrauch einer politischen und religiösen Elite resultierte in der Unterdrückung breiter Schichten der Bevölkerung. Die europäische Aufklärung war daher eine Kritik am Staat und an religiösen Institutionen, die die Bürger entmündigten, um sich Privilegien zu sichern. Der Begriff der Freiheit ist somit eng verbunden mit dem Begriff der Mündigkeit.[4] Der Bürger ist aufge-fordert selbst und unabhängig zu denken und sich von seiner eigenen Vernunft leiten zu lassen. Die Entwicklung der neuen Wissenschaften bekräftigte die Forderung nach vernünftigen, empirisch überprüfbaren Informationen, durch die die Bürger in der Lage seien, kritisch zu denken und zu unterscheiden. Die Unter-scheidung zwischen Wissen und Glauben wird auch beim Kampf gegen Aberglaube und Fanatismus, nicht zuletzt auch gegen die Religion und die Existenz eines Gottes selbst, deutlich. Der Glaube fällt aus dem Bereich des Wissens heraus, da er subjektiv und letztendlich nicht nachweisbar ist. Allenfalls wird eine natürliche Religion gefordert, die der eigenen Moral unterliegt, unabhängig von den propagierten Dogmen einer kirchlichen Institution. Politische sowie religiöse Unvernunft sollte mit Vernunft und Wissen bekämpft werden. Die Bestimmung des Menschen sei es letztendlich ein freier und mündiger Selbstdenker zu werden, der Zweck für sich selbst ist und nicht Mittel für andere. Die Fortschritte im Buchdruck ermöglichten die Verbreitung der aufklärerischen und revolutionären neuen Ideen. Es entstanden Verlage (Presse, Zeitschriften) und Salons, durch die ein öffentlicher Raum der Kommunikation geschaffen wurde. Der autonome Selbstdenker war eingebunden in ein Netzwerk, in dem man darüber diskutierte, was man für vernünftig hielt.
Bereits zum Ende des 18. Jahrhundert verlor die Aufklärung an Zugkraft und musste gegen sich formierende Gegenaufklärungen kämpfen. Mit dem Ausbruch der Französischen Revolution 1789 endete in allen europäischen Ländern das Zeitalter der Aufklärung. Die Aufklärung war und bleibt aber ein Prozess, der nie abgeschlossen sein wird, deren Ideen und Ziele immer aktuell bleiben und in den heutigen Auswüchsen des Kapitalismus wohl einen neuen Gegner finden.
2.2 Aufklärerische Tendenzen des 17. Jahrhunderts in China
Es mag zunächst erstaunen den Begriff der Aufklärung für das kaiserliche vormoderne China zu verwenden, da es ganz offensichtlich keine Aufklärung im europäischen Sinne im chinesischen Kaiserreich gegeben hat. Dennoch setzte in der Mitte des 17. Jahrhundert mit dem Niedergang der Ming-Dynastie eine Reformbewegung ein, deren Philosophen ganz ähnliche Ideen und Einstellungen verfolgten, wie ihre europäischen Kollegen. Im Vordergrund stand die „Kritik an den Institutionen und geistigen Grundlagen des autoritären Reichs“[5]. Der Sturz der Ming-Dynastie durch die „Barbaren“[6] (die Mandschuren) verursachte einen Aufschrei in der intellektuellen Elite des Landes, die damit die Schwäche des chinesischen Staates und seinen Institutionen bestätigt sah. Die Dekadenz des Staates und der wachsende Einfluss der Eunuchen am Hofe des Kaisers waren hierbei nur einige Kritikpunkte, die hervorgebracht wurden. Wie auch bei der europäischen Aufklärung vertrat man die Meinung, dass der Herrscher dem Volke zu dienen hatte und dieses nicht als das Eigentum einer politischen Elite zu betrachten sei. Die wachsende Kluft zwischen der Führungsschicht und dem Volk als auch zwischen der Zentralregierung und den Amtsträgern der Provinzen im konkreten sei eine Ursache für die Schwäche des chinesischen Kaiserreiches. Gu Yanwu (1613-1682), Mitglied der Erneuerungsgesellschaft[7] und einflussreichster Philosoph seiner Zeit, sprach sich daher für die Stärkung lokaler Autonomie aus, um die Machtkonzentration zu zerschlagen und das persönliche Verantwortungs-gefühl der Beamten zu fördern.
[...]
[1] Jacques Gernet, Die chinesische Welt (Frankfurt am Main: Insel Verlag, 1997), 426.
[2] § 1 Abs. 1 GG
[3] Werner Schneiders, Das Zeitalter der Aufklärung (München: Verlag C.H.Beck oHG, 1997), 16-17.
[4] Werner Schneiders, Das Zeitalter der Aufklärung (München: Verlag C.H.Beck oHG, 1997), 10.
[5] Jacques Gernet, Die chinesische Welt (Frankfurt am Main: Insel Verlag, 1997), 418.
[6] Anm. d. Autorin: Traditionell wurden die Staaten außerhalb Chinas als Barbaren bezeichnet als Zeichen fehlender Kultiviertheit, die man diesen Völkern unterstellte.
[7] Anm. d. Autorin: Die Erneuerungsgesellschaft wurde im 17. Jahrhundert von Gelehrten gegründet. Sie kritisierten den Absolutismus des Kaisers.
- Arbeit zitieren
- Claudia Hermann (Autor:in), 2012, Aufklärung und Anarchismus im vormodernen China, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/209481