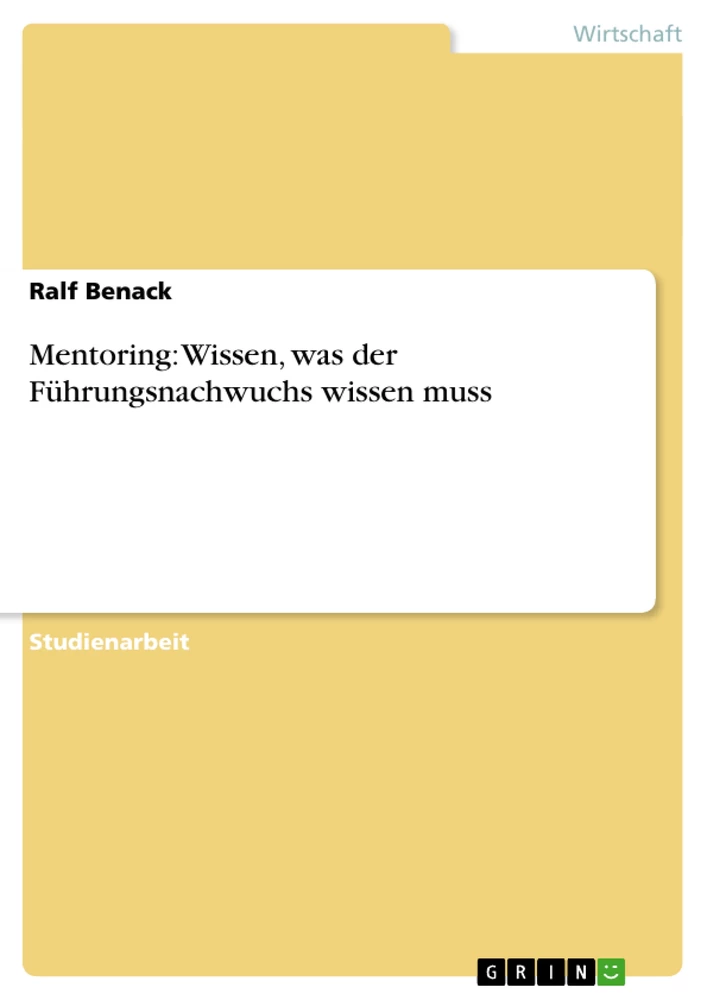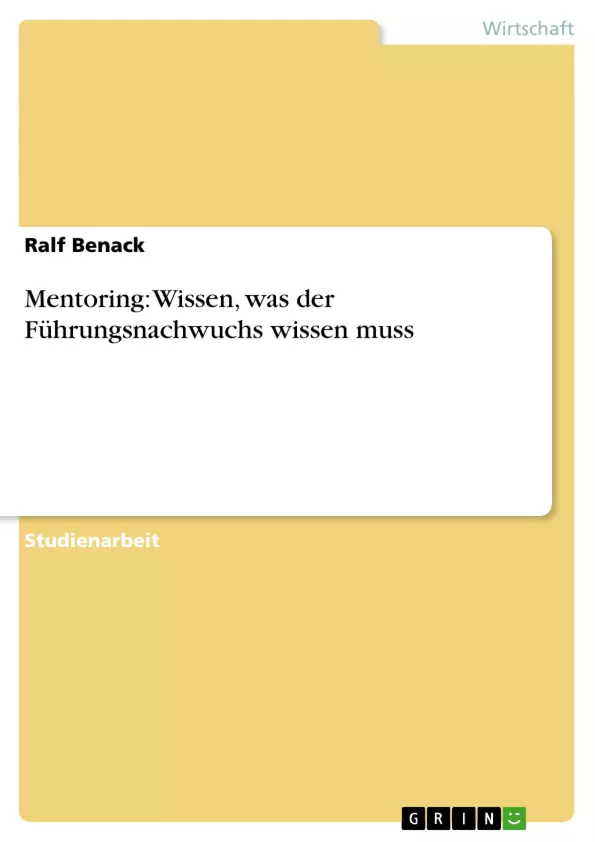Angesichts der vielfach zitierten „Megatrends“ 1 der Jahrtausendwende wie die Globalisierung der Märkte oder der Wandel von einer Industrie- zur Wissensgesellschaft wird „Wissen“ und dessen Management für die Unternehmungen im Kampf um das Überleben zu einem bedeutenden Faktor. Entscheidend in diesem Zusammenhang sind die Verfügbarkeit und damit auch die Weitergabe des relevanten Wissens. 2 Problematisch ist hier allerdings, dass ein wesentlicher Aspekt des Wissensaustausches in Organisationen nicht explizierbar ist. Speziell ungeschriebene Erfahrungen und Routinen – das so genannte im- plizite Wissen – müssen durch Interaktion der Individuen übertragen und verteilt werden und gerade diese wichtige Dimension des Wissensaustausches erfordert besondere Beach- tung, damit vorhandenes Wissen nicht verloren geht und später unter Umständen teuer neu erworben werden muss. 3 Um individuelles Lernen – und damit in der Summe organisationales Lernen – auf diese Weise zu initiieren, gilt es, Rahmenbedingungen zu schaffen und Barrieren bei den Beteiligten abzubauen. Vielfach hervorgehoben wird besonders die Be- deutung einer lernförderlichen Atmosphäre in Unternehmungen sowie die Bereitschaft der
Mitarbeiter Wissen zu teilen. 4 Bereits in den siebziger Jahren wurde vor allem in den USA das Potenzial von damals überwiegend informellen Mentoring-Beziehungen bei der Wissensweitergabe erkannt. 5 Heute existieren Mentoring-Konzepte in den unterschiedlichsten
Ausprägungen, denn die Idee des Mentoring stellt einen möglichen Ansatz auf dem Weg zur Bewältigung der oben geschilderten Problematik dar.
Zielsetzung dieser Arbeit ist es – nach der Entwicklung einer prozessorientierten Vorge- hensweise – Möglichkeiten aufzuzeigen, welche die Implementierung ausgewählter Mentoring-Konzepte für den Einzelnen und in Folge dessen für das Unternehmen als Ganzes bietet. Dabei sollen neben den direkten Potenzialen für den oben angesprochenen Prob- lemkontext auch Entwicklungsmöglichkeiten für angrenzende Problemstellungen herausgearbeitet werden. Der Einsatz des Mentoring speziell zur Förderung von Frauen im Management wird als weit verbreiteter Aspekt anerkannt, in der vorliegenden Arbeit je- doch nicht weiter vertieft, da er nur ein mögliches Anwendungsfeld des Mentoring darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- Mentoring: Ansatzpunkte und Impulsgeber für ein effektives Wissensmanagement
- Konzeptionelle Grundlagen des Mentoring
- Terminologisches Grundverständnis und Abgrenzung des Mentoring zum Coaching
- Grundlegende Einsatzfelder und Ziele von Mentoring-Programmen im betriebswirtschaftlichen Kontext
- Ausgewählte Ansätze zum Mentoring und ihre Diskussion vor dem Hintergrund einer wissensorientierten Unternehmungsführung
- Ausgewählte Mentoring-Ansätze im Überblick
- Der „klassische“ Mentoring-Ansatz und die Sonderformen des Cross-Mentoring sowie des Reverse-Mentoring
- Entwicklung und Implementierung einer prozessorientierten Vorgehensweise
- Prozessstufen einer formellen Mentoring-Konzeption
- Die Auswahl von Mentee und Mentoren als bedeutender Faktor auf dem Weg zu einem effektiven Mentoring
- Maßnahmen und Instrumente zur Unterstützung und Umsetzung der Mentoring-Aktivitäten
- Bedeutung des Mentoring im Wissensmanagement, sowie für angrenzende und weiterführende Problemstellungen
- Individuelle und organisationale Nutzenpotenziale von Mentoring-Verhältnissen
- Entwicklungspotenziale des Mentoring vor dem Hintergrund einer vitalisierenden Wirkung der Ressource Wissen
- Mentoring im Wissensmanagement: Eine abschließende Betrachtung sowie Ausblick auf weitere potenzielle Gestaltungsfelder
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Bedeutung von Mentoring im Kontext des Wissensmanagements. Sie untersucht, wie Mentoring-Programme im Unternehmenskontext implementiert werden können und welche Potenziale sie für die Weitergabe von Wissen und die Förderung von Lernen bieten.
- Die Rolle von Mentoring in einer wissensbasierten Wirtschaft
- Konzeptionelle Grundlagen des Mentorings und die Abgrenzung zu Coaching
- Verschiedene Ansätze des Mentorings, darunter klassisches, Cross- und Reverse-Mentoring
- Entwicklung und Implementierung von Mentoring-Programmen
- Nutzen und Herausforderungen des Mentorings für Individuen und Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Dieses Kapitel führt in die Thematik des Wissensmanagements und der Bedeutung von Wissen in der heutigen Wirtschaft ein. Es stellt die Problematik des impliziten Wissens und die Herausforderungen der Wissensweitergabe dar.
- Kapitel 2: Das Kapitel beleuchtet die konzeptionellen Grundlagen des Mentorings und grenzt es vom Coaching ab. Es analysiert die Einsatzfelder und Ziele von Mentoring-Programmen im betriebswirtschaftlichen Kontext.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Entwicklung und Implementierung einer prozessorientierten Vorgehensweise bei der Einführung von Mentoring-Programmen. Es betrachtet die Auswahl von Mentee und Mentoren sowie die notwendigen Maßnahmen und Instrumente zur Unterstützung der Mentoring-Aktivitäten.
- Kapitel 4: Das Kapitel untersucht die Bedeutung von Mentoring im Wissensmanagement und beleuchtet die individuellen und organisationalen Nutzenpotenziale von Mentoring-Verhältnissen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Wissensmanagement, Mentoring, Coaching, implizites Wissen, explizites Wissen, Wissensweitergabe, Lernkultur, Unternehmenskultur, individuelles Lernen, organisationales Lernen.
- Quote paper
- Ralf Benack (Author), 2003, Mentoring: Wissen, was der Führungsnachwuchs wissen muss, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/20932