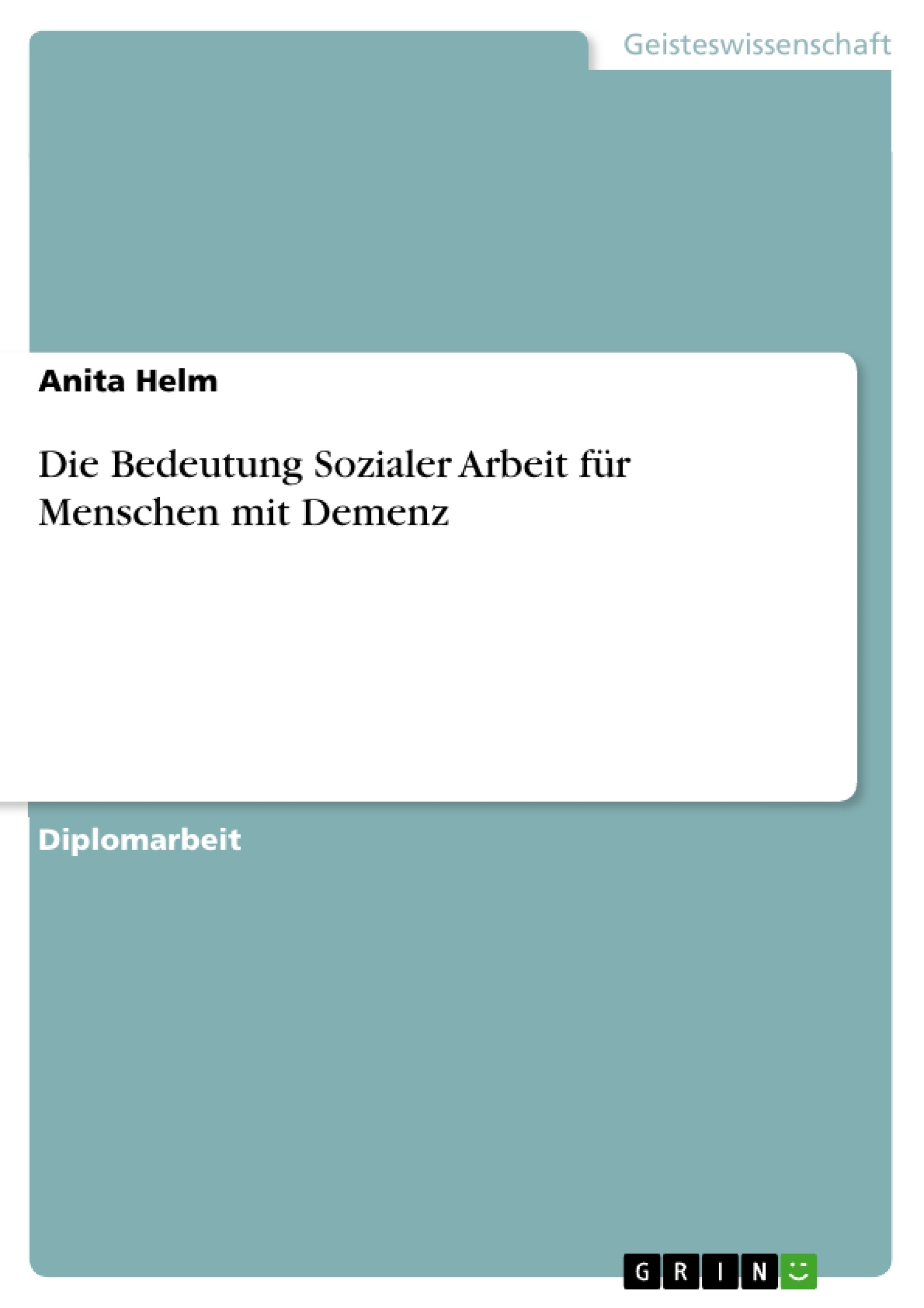Um erste Erkenntnisse über das Personsein und die Bedürfnisse von Personen zu erwerben, setze ich mich mit dem „Standardparadigma von Demenz“, dem person-zentrierten Ansatz Tom Kitwoods auseinander. Der Begriff steht beispielhaft für eine extrem negative und deterministische Sichtweise von Demenz, die sich in dem gängigen Image eines „Todes, der den Körper zurücklässt“ zum Ausdruck bringt. Dieses (medizinische) Standardparadigma wurzelt in der Hypothese, dass ein Faktor oder Faktoren X zu neuropathischen Veränderungen und diese zur Demenz führen. Alle geistigen und emotionalen Symptome wären demnach ausschließlich das direkte Ergebnis einer Reihe katastrophaler Veränderungen im Gehirn. Diese Degeneration sei irreversibel und führt unabwendbar zu einer Verschlechterung des gesamten Zustands einer Person. Dabei vernachlässigt dieses vereinfachte Modell jedoch den Fakt, dass beträchtliche neuropathologische Zustände auch ohne eine Demenzerkrankung vorhanden sein können, und das eine Demenz auch ohne signifikante Neuropathologie bestehen kann. Ebenso wird eine Vielzahl von Aspekten der Nervenarchitektur ignoriert, die entwicklungsbedingt sind und somit keiner statischen Verschlechterung unterworfen sein können. Darüber hinaus existiert eine Reihe von psycho-sozialen Zuständen, die einen demenzähnlichen Zustand verursachen oder eine bestehende Demenz verstärken können.
In dieser Arbeit soll daher im Besonderen betont werden, dass jegliche Entwicklung von Personen individuell einzigartig verläuft und über die gesamte Lebensspanne hinweg, positiv oder negativ, beeinflussbar bleibt - auch während einer Demenzerkrankung. Das unmittelbare psycho-soziale Umfeld von Personen bildet einen solchen Einflussfaktor. Auch Kitwood setzt das Individuum, in seinem psycho-sozialen Modell von Demenz, zu seiner sozialen Umwelt in Wechselwirkung. Dabei definiert er das Thema Menschenwürde in Form einer Bedürfnistheorie, wobei der Erhalt der Menschenwürde unmittelbar damit verbunden ist, inwieweit die Bedürfnisse von Personen (die sich aus den Menschenrechten ergeben) befriedigt werden.
Abschließend soll anhand einer DCM-Evaluation (Dementia Care Mapping) in einem Tageszentrum gezeigt werden, inwieweit diese Methode sinnvolle Rückschlüsse zur Einleitung adäquater Intervention im Rahmen Sozialer Arbeit ermöglicht. Mit dem Ziel, die erlebte Lebensqualität und das subjektive Wohlbefinden von Menschen mit Demenz, langfristig zu erhalten und ihr Personsein zu würdigen und zu stärken.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Entwicklungen über den Verlauf der Lebensspanne...
- 2.1 Das SOK-Modell nach Baltes
- 2.2 Die Sozio-emotionale Selektivitätstheorie nach Carstensen
- 2.3 Exkurs: Gedächtnisentwicklung
- 3. Eine kurze Beschreibung von Demenz
- 3.1 Die Symptome einer Demenzerkrankung
- 3.2 Depression und andere Zustände, die eine Demenz verstärken
- 3.3 Das Standardparadigma von Demenz nach Kitwood
- 4. Der Person-zentrierte Ansatz Kitwoods
- 4.1 Die Bedürfnisse von Personen (mit Demenz)
- 4.2 Maligne, bösartige Sozialpsychologie
- 4.3 Die positive Arbeit an der Person
- 5. Sozialpädagogik und Soziale Arbeit
- 5.1 Sozialpädagogisches Handeln (Können) nach Burkard Müller
- 5.2 Der Prozess professioneller Fallarbeit
- 5.3 Soziale Arbeit, Soziale Probleme und Demenz
- 5.4 Der Erhalt der Menschenwürde als Aufgabe von Sozialer Arbeit
- 5.5 Wohlbefinden und Lebensqualität von Menschen mit Demenz
- 6. Die Dementia Care Mapping Methode
- 6.1 Wohlbefinden und Unwohlsein im DCM
- 6.2 Der methodische Aufbau von DCM
- 6.2.1 Das Kodieren von Affekt und Kontakt
- 6.2.2 Das Kodieren von Verhalten
- 6.2.3 Personale Detraktionen
- 6.2.4 Personale Aufwerter
- 6.3 Reliabilität und Validität von DCM
- 7. Eine DCM Untersuchung in einem Alzheimer Tageszentrum
- 7.1 Planung und Einsatz von DCM
- 7.2 Räumlichkeiten und Tagesrhythmik im Tageszentrum
- 7.3 Eine kurze Beschreibung der Therapieinhalte
- 7.4 Graphisch gestützte Datenanalysen
- 7.5 Auswertung und Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Bedeutung Sozialer Arbeit für Menschen mit Demenz. Ziel der Arbeit ist es, die Bedeutung professioneller Pflege und Betreuung im Kontext der Demenzerkrankung zu beleuchten und die Notwendigkeit eines menschenwürdigen Umgangs mit betroffenen Personen hervorzuheben.
- Entwicklungen über den Verlauf der Lebensspanne
- Eine kurze Beschreibung von Demenz
- Der Person-zentrierte Ansatz Kitwoods
- Sozialpädagogik und Soziale Arbeit
- Die Dementia Care Mapping Methode
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung schildert die persönliche Motivation der Autorin, sich mit dem Thema Demenz auseinanderzusetzen. Die Kapitel 2 und 3 liefern einen Überblick über die Entwicklungen im Alter, die Symptome von Demenz und das Standardparadigma von Demenz nach Kitwood.
Kapitel 4 widmet sich dem Person-zentrierten Ansatz Kitwoods und beleuchtet die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz. In Kapitel 5 werden die Aufgabenfelder und Handlungsprinzipien der Sozialen Arbeit im Kontext von Demenz diskutiert.
Kapitel 6 erläutert die Dementia Care Mapping Methode als Instrument zur Erfassung von Wohlbefinden und Unwohlsein bei Menschen mit Demenz. Kapitel 7 präsentiert die Ergebnisse einer DCM-Untersuchung in einem Alzheimer Tageszentrum.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen Demenz, Sozialarbeit, Person-zentrierter Ansatz, Dementia Care Mapping, Wohlbefinden, Lebensqualität, Menschenwürde und Professionelles Handeln.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der person-zentrierte Ansatz nach Tom Kitwood?
Dieser Ansatz stellt das „Personsein“ in den Mittelpunkt und betrachtet Demenz nicht nur als medizinischen Abbau, sondern als Wechselwirkung zwischen Individuum und sozialem Umfeld.
Was kritisiert Kitwood am „Standardparadigma von Demenz“?
Er kritisiert die rein negative, medizinische Sichtweise, die Demenz als irreversiblen Verfall des Gehirns ohne Berücksichtigung psychosozialer Einflüsse sieht.
Was bedeutet „maligne Sozialpsychologie“?
Damit sind schädliche Interaktionsformen im Umfeld von Demenzkranken gemeint (z.B. Bevormundung, Ignorieren), die das Wohlbefinden und die Würde der Person verletzen.
Was ist Dementia Care Mapping (DCM)?
DCM ist eine Beobachtungsmethode, um die Lebensqualität und das Wohlbefinden von Menschen mit Demenz in Pflegeeinrichtungen objektiv zu erfassen und zu verbessern.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit bei Demenz?
Soziale Arbeit zielt darauf ab, die Menschenwürde zu erhalten, das Personsein zu stärken und durch adäquate Interventionen die Lebensqualität der Betroffenen zu sichern.
Was besagt das SOK-Modell nach Baltes?
Es steht für Selektion, Optimierung und Kompensation und beschreibt, wie Menschen auch im Alter trotz Verlusten eine positive Lebensgestaltung erreichen können.
- Quote paper
- Anita Helm (Author), 2012, Die Bedeutung Sozialer Arbeit für Menschen mit Demenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/208606