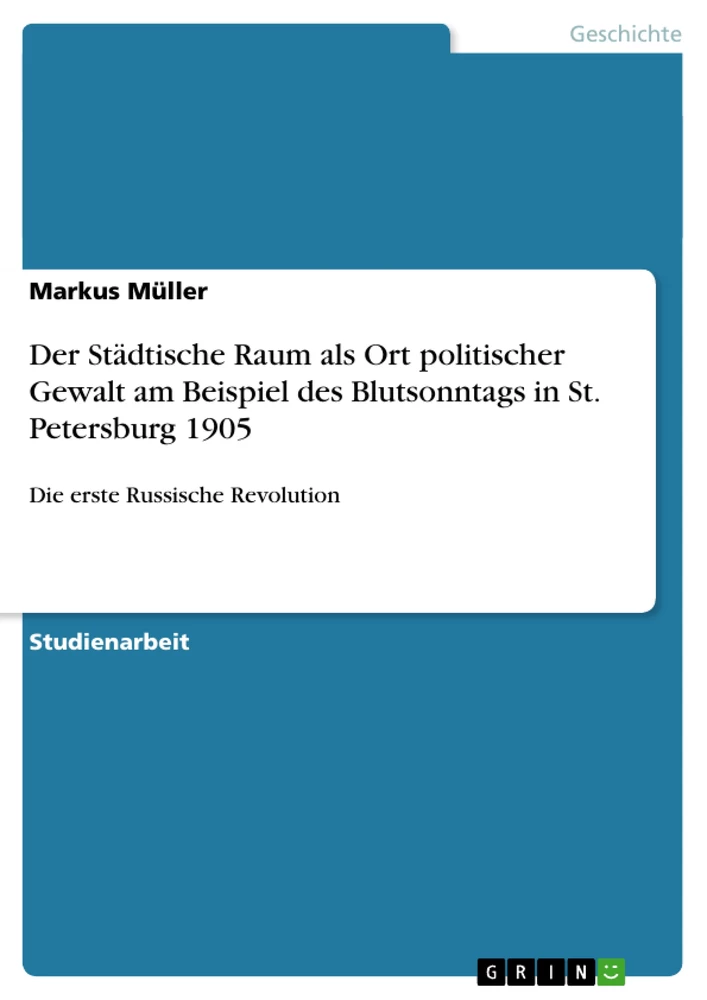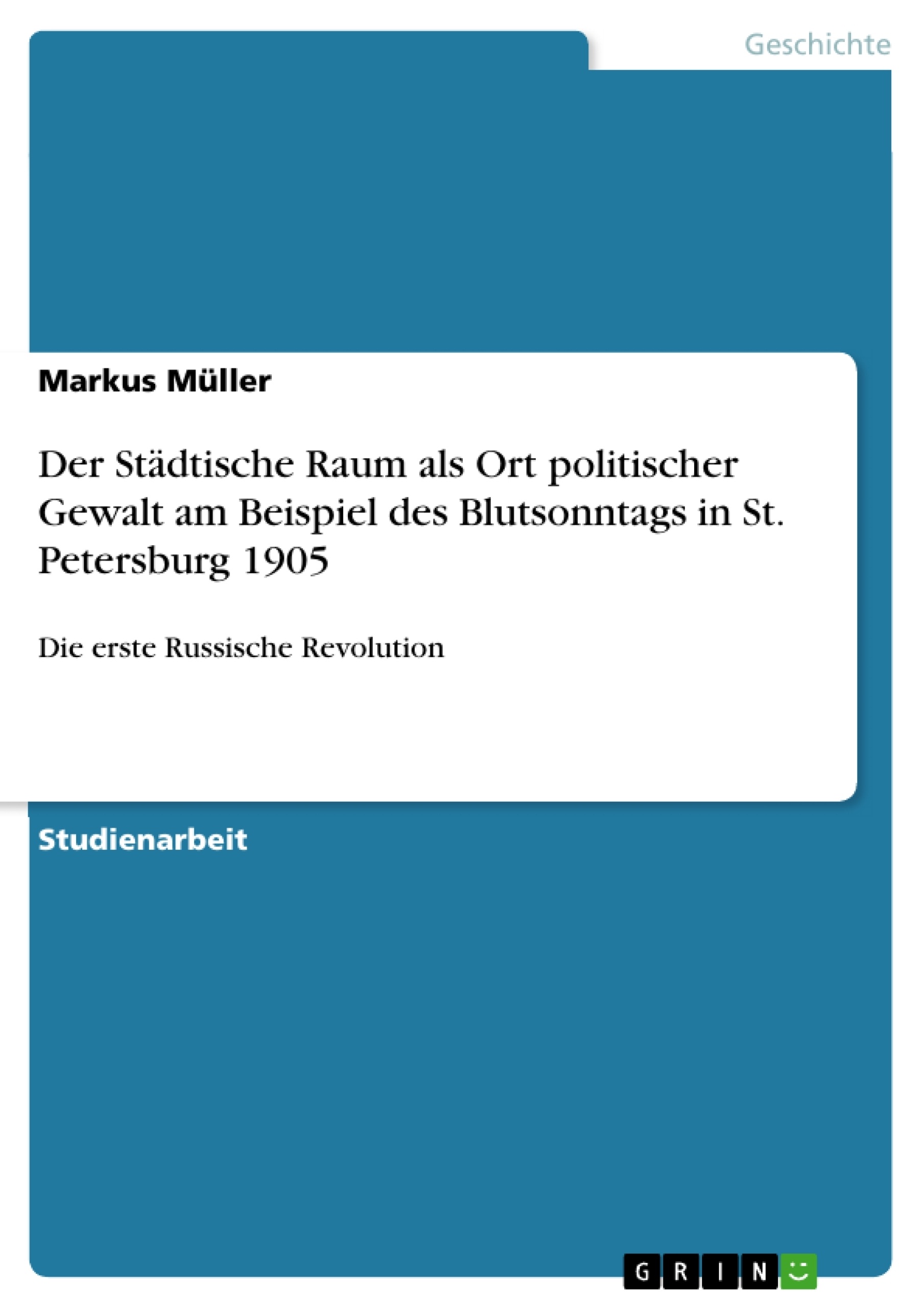„Hm … ja … alles liegt in den Händen eines Menschen, und er lässt alles vorbeigehen, einzig und allein aus Feigheit … das ist ein Axiom … Ich möchte wissen, was die Menschen am meisten fürchten. Sie fürchten sich am meisten vor einem neuen Schritt, vor einem neuen, eigenen Wort“
Wie in Fjodor Michailowitsch Dostojewskis Roman Schuld und Sühne auf den einzelnen Menschen bezogen, ist der Mensch in seiner Vielheit erst recht ein regelrechter Zweifler. Gerade wenn es sich um die Psychologie der Massen handelt, so bedarf es stets eines geraumen Maßes an Zeit, ehe sich die Gesamtheit der Bevölkerung zu einem entscheidenden Schritt gegen Repression und Unterdrückung, für die Revolution, für den politischen Aufstand entscheidet. Zunächst einmal muss ein Grund für die Revolution vorliegen: Unterdrückung, Ungerechtigkeit, Gewalt. Hat sich dieser letztendlich gefunden, so muss als nächstes jedoch von der großen, die sozialen Schichten überschreitenden Mehrheit auch die Staatsgewalt mit dem Aggressor gleichgesetzt werden. Ein gutes Beispiel für diese Dynamik ist die russische Revolution von 1905. Keineswegs kamen Generalstreik und Barrikadenkämpfe im St. Petersburg der Jahrhundertwelle urplötzlich vom Himmel gefallen. Die sich entladende Energie lud sich bereits weit im Vorfeld auf und elektrisierte dabei besonders Arbeiter und Intelligenzija der russischen Hauptstadt, von der aus eine umstürzlerische Welle über die Großstädte des gesamten Zarenreiches schwappte.
Warum gerade St. Petersburg zum Ausgangspunkt für das erste landesweite Aufbegehren in Russland wurde, soll dabei in der folgenden Arbeit geklärt werden. Hierbei soll es im Wesentlichen darum gehen, den städtischen Raum selbst als einen Ort politischer Gewalt in den Fokus zu nehmen, wozu St. Petersburg 1905 letztlich als Beispiel dienen soll. Gerade als ehemalige Residenz- und Militärmetropole, der sich die moderne Industrie und somit die moderne Urbanität Schicht für Schicht anlagerte, bietet die Struktur der einstigen Hauptstadt ein ideales Forschungsfeld, um herauszufinden, inwieweit Metropolen prädestiniert dafür sind, als Zentrum einer Revolution zu dienen. Im Rahmen dessen soll zum Vergleich ebenfalls ein kurzer Blick auf die Rolle Moskaus während der Wirren 1905 gewendet werden, um deutlicher zu zeigen, warum die Revolution vom „gespenstische[n] Palmyra“ St. Petersburg mit seinen „leeren Flächen stummer Plätze, wo Menschen hingerichtet werden vor Sonnenaufgang“ , seinen Ausgang nahm.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- St. Petersburg am Vorabend der ersten russischen Revolution
- Die Revolution von 1905
- Ein Tag in der russischen Geschichte - Der 9. Januar 1905
- Generalstreik und Revolution - Die Folgen des Bloody Sunday
- Was von der Revolution übrig blieb
- St. Petersburg als Ort der politischen Gewalt
- Warum St. Petersburg?
- Warum lief es in Moskau anders?
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ursachen und den Verlauf der ersten russischen Revolution von 1905, wobei der Fokus auf der Rolle St. Petersburgs als Zentrum des Aufstands liegt. Es wird analysiert, wie die sozioökonomischen Bedingungen und die städtische Struktur der Stadt zum Ausbruch der Revolution beitrugen.
- Sozioökonomische Bedingungen in St. Petersburg vor 1905
- Der Blutsonntag und seine Folgen
- Der städtische Raum als Ort politischer Gewalt
- Vergleich St. Petersburg – Moskau
- Die Rolle der Arbeiter und Intelligenzija
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die allgemeine menschliche Zögerlichkeit gegenüber revolutionärem Handeln und betont die Notwendigkeit von Unterdrückung und Ungerechtigkeit als Auslöser für einen Aufstand. Sie verweist auf die erste russische Revolution 1905 als Beispiel für die These, dass verpasste Gelegenheiten zur Kurskorrektur durch den Staat eine Revolution nahezu unausweichlich machen. Der Fokus wird auf St. Petersburg als Ausgangspunkt des Aufstands gelegt und die Forschungsfrage nach dem städtisch-strukturellen Warum formuliert.
St. Petersburg am Vorabend der ersten russischen Revolution: Dieses Kapitel beschreibt die sozioökonomischen Bedingungen in St. Petersburg um die Jahrhundertwende. Die Rückständigkeit des russischen Reiches trotz seiner Großmachtposition wird hervorgehoben. Die Bauernbefreiung von 1861 führte nicht zu einer Verbesserung der Lage der ländlichen Bevölkerung, sondern zu einer massiven Landflucht in die Städte. Die rasche Industrialisierung und das damit einhergehende Wachstum der Städte, insbesondere St. Petersburgs, führten zu katastrophalen Wohn- und Arbeitsbedingungen, geprägt von Überbevölkerung, mangelnder Infrastruktur und miserablen Arbeitsbedingungen. Die Kapitel beschreibt die Entstehung von Arbeitersiedlungen am Rande der Stadt mit unzureichender Hygiene und erschwerten Lebensbedingungen.
Schlüsselwörter
Russische Revolution 1905, St. Petersburg, Blutsonntag, sozioökonomische Bedingungen, Urbanisierung, Industrialisierung, politische Gewalt, Arbeiterbewegung, Intelligenzija, Moskau, städtische Struktur.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Die Russische Revolution von 1905 in St. Petersburg"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Ursachen und den Verlauf der ersten russischen Revolution von 1905, mit besonderem Fokus auf die Rolle St. Petersburgs als Zentrum des Aufstands. Es wird analysiert, wie sozioökonomische Bedingungen und die städtische Struktur der Stadt zum Ausbruch der Revolution beitrugen, und ein Vergleich mit Moskau gezogen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt sozioökonomische Bedingungen in St. Petersburg vor 1905, den Blutsonntag und seine Folgen, den städtischen Raum als Ort politischer Gewalt, einen Vergleich zwischen St. Petersburg und Moskau, und die Rolle der Arbeiter und der Intelligenzija in der Revolution.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über St. Petersburg am Vorabend der Revolution, ein Kapitel über die Revolution von 1905 (inkl. Blutsonntag und dessen Folgen), ein Kapitel über St. Petersburg als Ort politischer Gewalt (inkl. Vergleich mit Moskau), und eine Schlussfolgerung.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die Arbeit argumentiert, dass verpasste Gelegenheiten zur Kurskorrektur durch den russischen Staat, in Kombination mit den katastrophalen sozioökonomischen Bedingungen und der spezifischen städtischen Struktur St. Petersburgs, die Revolution von 1905 nahezu unausweichlich machten. St. Petersburg wird als der zentrale Ausgangspunkt des Aufstands herausgestellt.
Welche sozioökonomischen Bedingungen werden in der Arbeit beschrieben?
Die Arbeit beschreibt die Rückständigkeit des russischen Reiches, die Folgen der Bauernbefreiung von 1861 (Landflucht und Verelendung), die rasche Industrialisierung und das damit verbundene Wachstum der Städte, katastrophale Wohn- und Arbeitsbedingungen in St. Petersburg (Überbevölkerung, mangelnde Infrastruktur, miserable Arbeitsbedingungen) und die Entstehung von Arbeitersiedlungen am Stadtrand.
Welche Rolle spielt der Blutsonntag?
Der Blutsonntag (9. Januar 1905) wird als ein Schlüsselereignis der Revolution behandelt, welches den Generalstreik und die weiteren revolutionären Ereignisse auslöste. Seine Folgen und Bedeutung für den Verlauf der Revolution werden ausführlich analysiert.
Warum wird St. Petersburg im Vergleich zu Moskau betrachtet?
Der Vergleich zwischen St. Petersburg und Moskau dient dazu, die spezifischen städtisch-strukturellen Faktoren hervorzuheben, die zum Ausbruch der Revolution in St. Petersburg beitrugen, und die Unterschiede in den jeweiligen Verläufen des Aufstands zu beleuchten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Russische Revolution 1905, St. Petersburg, Blutsonntag, sozioökonomische Bedingungen, Urbanisierung, Industrialisierung, politische Gewalt, Arbeiterbewegung, Intelligenzija, Moskau, städtische Struktur.
- Quote paper
- Markus Müller (Author), 2006, Der Städtische Raum als Ort politischer Gewalt am Beispiel des Blutsonntags in St. Petersburg 1905, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/207967