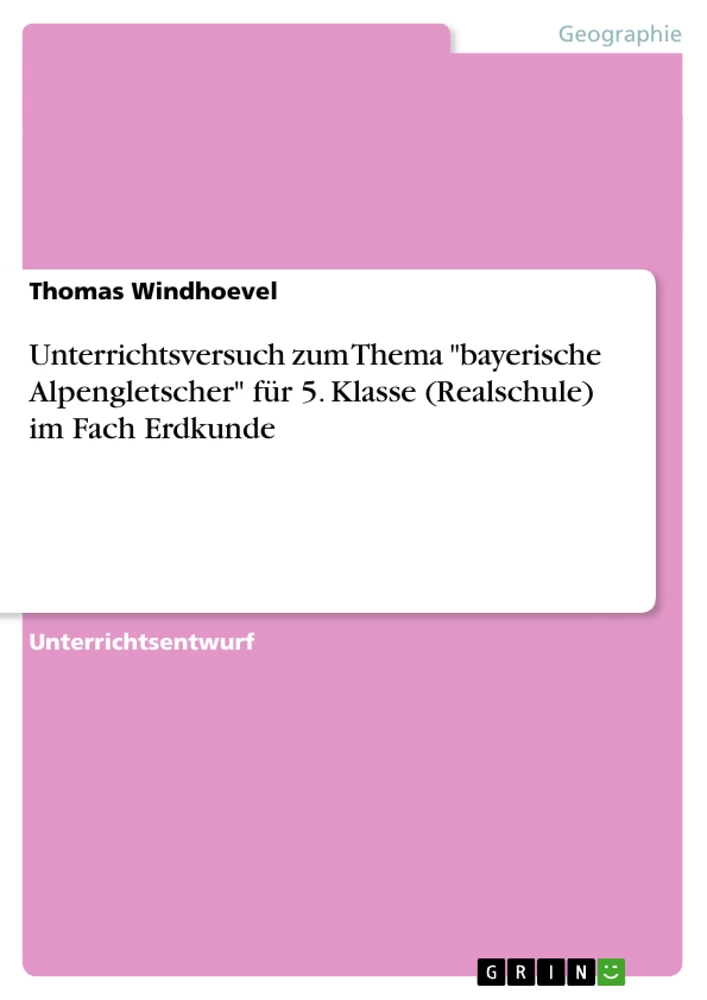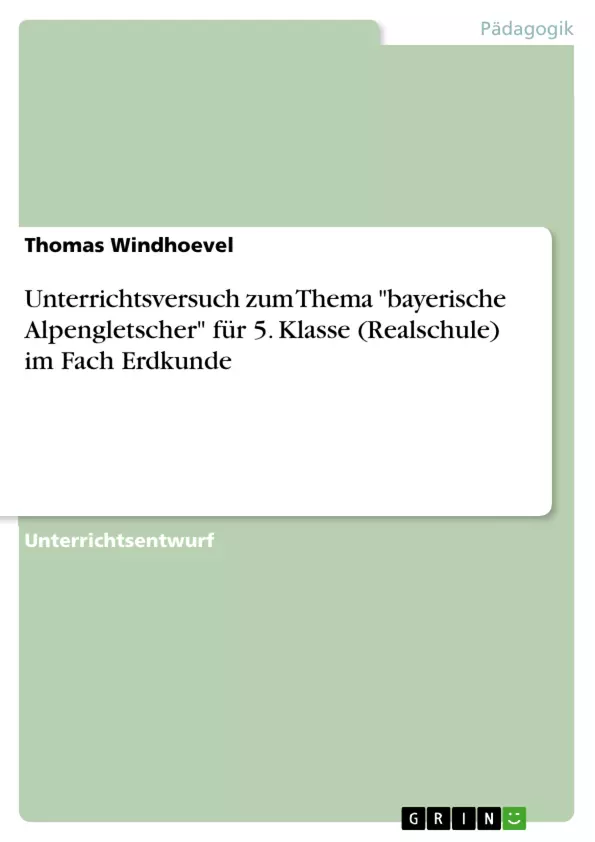Es handelt sich um einen Unterrichtsversuch für 5. Jahrgangsstufe Erdkunde zum Thema: "Exogene Kräfte verändern die Landschaft: Bsp. Gletscher."
Die Schüler in der 5. Klasse sollen erfahren, dass die Erdoberfläche stetigen Veränderungen unterworfen ist. Gemäß des Lehrplans für die bayerische sechsstufige Realschule ist diese Einheit dem Oberthema „Veränderungen der Erdoberfläche in Heimat und Welt“ (Ek 5.3) einzuordnen.
Besonders im südbayerischen Raum haben Gletscher die Erdoberfläche von außen (exogen) verändert. Sie haben so einen starken landschaftsgestaltenden Charakter. Die landschaftsprägenden Attribute aus der letzten Eiszeit werden nun beleuchtet.
Für die Veränderungen der Erdoberfläche sind insgesamt ungefähr 10 Unterrichtstunden zu veranschlagen.
(BAYERISCHES STAATSMINITERIUM FÜR UNTERRICHT UND KULTUS (Hrsg.), 2001, S. 189)
In der Vorstunde wurde die Entstehung und der Aufbau eines Alpengletschers behandelt.
Nun wird das Thema mit dieser Unterrichtseinheit fortgeführt, in dem besonders auf die landschaftsprägenden Einflüsse der Gletscher ein Augenmerk gerichtet wird. Mit dieser Einheit sind die exogenen Einflüsse auf die Erdoberfläche ausreichend behandelt worden. In der Folgestunde wird dann zum Thema der endogenen Einflüsse auf die Erdoberfläche übergeleitet.
Stundenziel: Die Schüler sollen erkennen, dass die Erdoberfläche durch den Einfluss von Gletschern verändert wird.
Das Stundenziel wird für die Schüler noch in Teillernziele untereilt:
1. TLZ: Die Schüler erkennen, dass ein Trogtal durch die Einwirkung eines Gletschers entstanden ist.
2. TLZ: Die Schüler die erfahren, wie weit sich die Gletscher in das Alpenvorland vorgeschoben haben und wissen, wie ein Gletscher sich zusammensetzt.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Fachwissenschaftliche Analyse
- II. Didaktische Analyse
- 1. Einbettung des Themas in den Lehrplan
- 2. Lernziele
- 3. Methodische Überlegungen
- Einstieg
- Erarbeitung TLZ 1
- Sicherung TLZ 1
- Erarbeitung TLZ 2
- Sicherung TLZ 2
- Lernzielkontrolle
- Puffer
- Hausaufgabe
- III. Durchführung
- IV. Verzeichnis der Literatur
- V. Verzeichnis der Internetquellen
- VI. Verzeichnis der Abbildungen
- VII. Anhang die Unterrichtsmaterialien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Unterrichtsstunde zielt darauf ab, den Schülern der 5. Klasse die landschaftsprägenden Auswirkungen von Gletschern näherzubringen. Sie sollen erkennen, wie Gletscher die Erdoberfläche verändern und die Entstehung von charakteristischen Landschaftsformen verstehen.
- Die Gestaltungskraft von Gletschern
- Die Entstehung von Trogtälern
- Die Ablagerung von Moränen und Schotterebenen
- Die Vergletscherung im südbayerischen Raum
- Die Bedeutung von Gletschern für die Landschaftsformung
Zusammenfassung der Kapitel
I. Fachwissenschaftliche Analyse
Dieser Abschnitt beleuchtet die geomorphologischen Prozesse, die durch Gletscheraktivität in den Alpen und dem Alpenvorland stattfinden. Er beschreibt die Kraft der Gletscher, Felsen zu brechen und zu zermahlen, sowie die Entstehung von Moränen, Grundmoränen und Trogtälern.
II. Didaktische Analyse
1. Einbettung des Themas in den Lehrplan
Dieser Abschnitt erklärt, wie das Thema „Gletscher und ihre landschaftsprägenden Einflüsse“ in den Lehrplan für die bayerische Realschule eingebettet ist. Es wird auf die Einheit „Veränderungen der Erdoberfläche in Heimat und Welt“ Bezug genommen und die Relevanz des Themas für den südbayerischen Raum hervorgehoben.
2. Lernziele
Dieser Abschnitt definiert das Stundenziel und die Teillernziele. Die Schüler sollen die Auswirkungen von Gletschern auf die Erdoberfläche erkennen, die Entstehung von Trogtälern verstehen und die Ausbreitung von Gletschern im Alpenvorland kennenlernen.
3. Methodische Überlegungen
Dieser Abschnitt erläutert die geplanten methodischen Vorgehensweisen. Es werden verschiedene Ansätze wie Bildfolien, Sandkastenmodelle und Wortkarten eingesetzt, um den Schülern die Thematik zu vermitteln und das Lernen interaktiv zu gestalten. Es wird auch auf die Bedeutung der Sicherung der Lernerfolge durch Arbeitsblätter und einer abschließenden Lernzielkontrolle eingegangen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Unterrichtsstunde sind: Gletscher, Trogtäler, Moränen, Grundmoräne, Seitenmoräne, Endmoräne, Zungenbecken, Schotterebene, Vergletscherung, Alpen, Alpenvorland, exogene Kräfte, Landschaftsformung.
- Arbeit zitieren
- Thomas Windhoevel (Autor:in), 2012, Unterrichtsversuch zum Thema "bayerische Alpengletscher" für 5. Klasse (Realschule) im Fach Erdkunde, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/207863