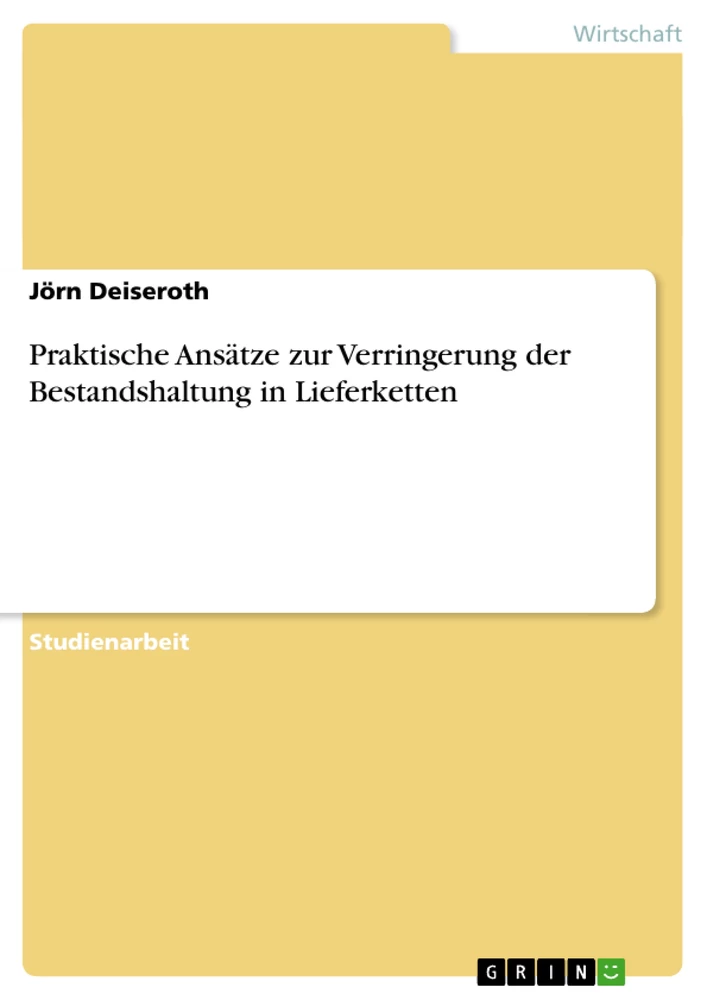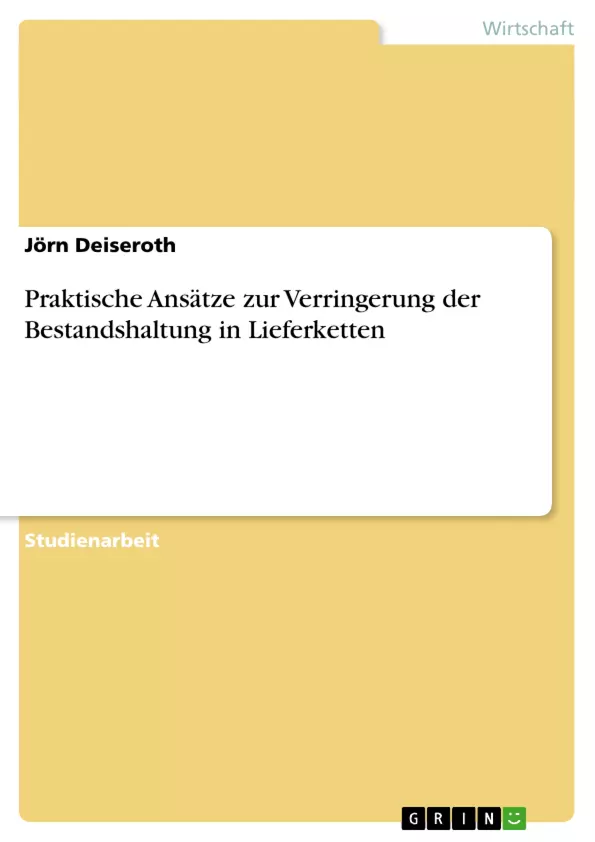In der Logistik ist das „Supply Chain Management“ Gegenstand vieler einschlägiger
Fachpublikationen. Die damit verbundenen Ziele sind im Allgemeinen die
Reduzierung der Durchlaufzeiten, die Verringerung der Bestände und die Erhöhung
der Liefertreue1. Es wird deutlich, dass die Lagerpolitik und alle damit verbundenen
Aktivitäten eine ganz entscheidende Rolle im Konzept des SCM spielen. Neben der
Relevanz der Lagerhaltung für die Unternehmensführung steigt auch die Intensität
von Handels- und Transportaktivitäten durch die Globalisierung und Trends wie den
der immer geringer werdenden Fertigungstiefe im Automobilbau. Daraus folgt, dass
ein Unternehmen über eine Optimierung seiner Lagerhaltungsaktivitäten und die
damit verbundenen geringeren Aufwendungen (z.B. i.S.d. Kapitalbindung oder des
Organisationsaufwandes) beträchtliche Einsparungen realisieren und seine
Wettbewerbssituation deutlich verbessern kann.
Ein Phänomen der betrieblichen Lagerhaltung in der Gegenwart ist der „Bullwhip-„
oder Peitscheneffekt2. Er beschreibt die Zunahme der Bestandsvalenz in
vorgelagerten Fertigungsstufen. Steigt die Nachfrage beim Einzelhändler, so erhöht
der Lieferant seinen Lagerbestand um auf die veränderte Nachfrage zu reagieren.
Spätestens in der dritten Stufe der Lieferkette führt dieses Verhalten zu stark
überhöhten Lagerbeständen, da den vorgelagerten Unternehmen der kausale
Zusammenhang für die Absatzschwankungen nicht mehr deutlich wird und sie
unnötige Sicherheitsbestände aufbauen.
Es verwundert also nicht, dass die Optimierung der Lagerhaltung sowohl von den
wirtschaftenden Unternehmen als auch den forschenden Einrichtungen in der
Bundesrepublik vorangetrieben wird. Diese Seminararbeit soll ein Beitrag hierzu
sein, indem sie praktische Ansätze zur Verringerung der Bestände in den
Unternehmen aufzeigt, indem sie sich absetzt von Schlagwörtern wie „Integration“
oder „Flexibilität“, Handlungsalternativen aufzeigt und konkrete
Handlungsanweisungen gibt.
1 Vgl. Hans Corsten / Ralf Gössinger, Einführung in das Supply Chain Management, Oldenbourg, S.
95
2 Vgl. Joachim Käschel, Vorlesungskript IBL IV, TU Chemnitz, Wintersemester 03/04
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Just-in-Time
- 1.1. Integrierte Informationsverarbeitung
- 1.2. Fertigungssegmentierung
- 1.3. Produktionssynchrone Beschaffung
- 2. Efficient Consumer Response
- 2.1. Supply Side ECR
- 2.2. Demand Side ECR
- 3. Collaborative Planning Forecasting and Replenishment
- 3.1. Stufenmodell
- 4. Advanced Planning & Scheduling
- 5. Fazit und Probleme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Optimierung der Lagerhaltung in Lieferketten und präsentiert praktische Lösungsansätze zur Reduzierung von Beständen. Sie setzt sich mit dem Ziel ab, gängige Schlagworte zu vermeiden und konkrete Handlungsalternativen mit klaren Handlungsanweisungen aufzuzeigen. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen die wichtigsten Konzepte zur Reduzierung von Bestandshaltung in Lieferketten.
- Just-in-Time-Prinzip
- Efficient Consumer Response (ECR)
- Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR)
- Advanced Planning & Scheduling (APS)
- Optimierung der Lagerhaltungspolitik im Kontext von Supply Chain Management (SCM)
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 0: Einleitung
Dieses Kapitel führt in das Thema Lagerhaltung in Lieferketten ein und erklärt die Bedeutung der Optimierung der Lagerhaltungspolitik im Kontext des Supply Chain Managements. Es werden die Ziele des SCM, wie z. B. die Reduzierung von Durchlaufzeiten und die Erhöhung der Liefertreue, hervorgehoben. Des Weiteren wird der „Bullwhip-Effekt“ als Phänomen der betrieblichen Lagerhaltung erläutert, welcher die Zunahme der Bestandsvalenz in vorgelagerten Fertigungsstufen beschreibt. - Kapitel 1: Just-in-Time
Das Kapitel erläutert das Just-in-Time-Prinzip und seine Entstehung in der japanischen Industrie. Es werden die wichtigsten Vorteile des JiT-Konzepts, wie z. B. die Minimierung der Lagerhaltung, die Optimierung von Durchlaufzeiten und die Erhöhung der Liefertreue, aufgezeigt. Des Weiteren werden die drei wesentlichen Bausteine des JiT-Konzepts, Integrierte Informationsverarbeitung, Fertigungssegmentierung und Produktionssynchrone Beschaffung, vorgestellt. - Kapitel 2: Efficient Consumer Response
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Efficient Consumer Response (ECR) Konzept, welches sich auf die Zusammenarbeit zwischen Herstellern und Einzelhändlern konzentriert, um die Effizienz der Lieferkette zu verbessern. Es werden die beiden Seiten des ECR, Supply Side ECR und Demand Side ECR, vorgestellt, welche sich auf die Optimierung der Lieferkette vom Hersteller zum Einzelhändler bzw. vom Einzelhändler zum Kunden fokussieren. - Kapitel 3: Collaborative Planning Forecasting and Replenishment
Das Kapitel erläutert das Collaborative Planning Forecasting and Replenishment (CPFR) Konzept, welches die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen entlang der Lieferkette fördert, um gemeinsam Bedarfsprognosen zu erstellen, Bedarfsplanung zu betreiben und die Wiederauffüllung des Lagerbestands zu koordinieren. Es wird ein Stufenmodell des CPFR vorgestellt, welches die verschiedenen Phasen der Zusammenarbeit verdeutlicht. - Kapitel 4: Advanced Planning & Scheduling
Dieses Kapitel befasst sich mit der Advanced Planning & Scheduling (APS) Technologie, welche die Planung und Steuerung von komplexen Produktionsprozessen in Unternehmen unterstützt. Die APS Technologie bietet vielfältige Möglichkeiten, die Lagerhaltung zu optimieren, z. B. durch die Optimierung von Produktionsplänen, die Reduzierung von Stillstandzeiten und die Verbesserung der Materialflüsse.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit konzentriert sich auf die Reduktion der Bestandshaltung in Lieferketten und stellt verschiedene Konzepte und Lösungsansätze vor, die Unternehmen in der Praxis anwenden können. Die wichtigsten Schlüsselbegriffe und Themenbereiche der Arbeit umfassen:
Just-in-Time, Efficient Consumer Response (ECR), Collaborative Planning Forecasting and Replenishment (CPFR), Advanced Planning & Scheduling (APS), Supply Chain Management (SCM), Lagerhaltungspolitik, Bestandsoptimierung, Durchlaufzeiten, Liefertreue, Bullwhip-Effekt.
- Quote paper
- Jörn Deiseroth (Author), 2003, Praktische Ansätze zur Verringerung der Bestandshaltung in Lieferketten, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/20701