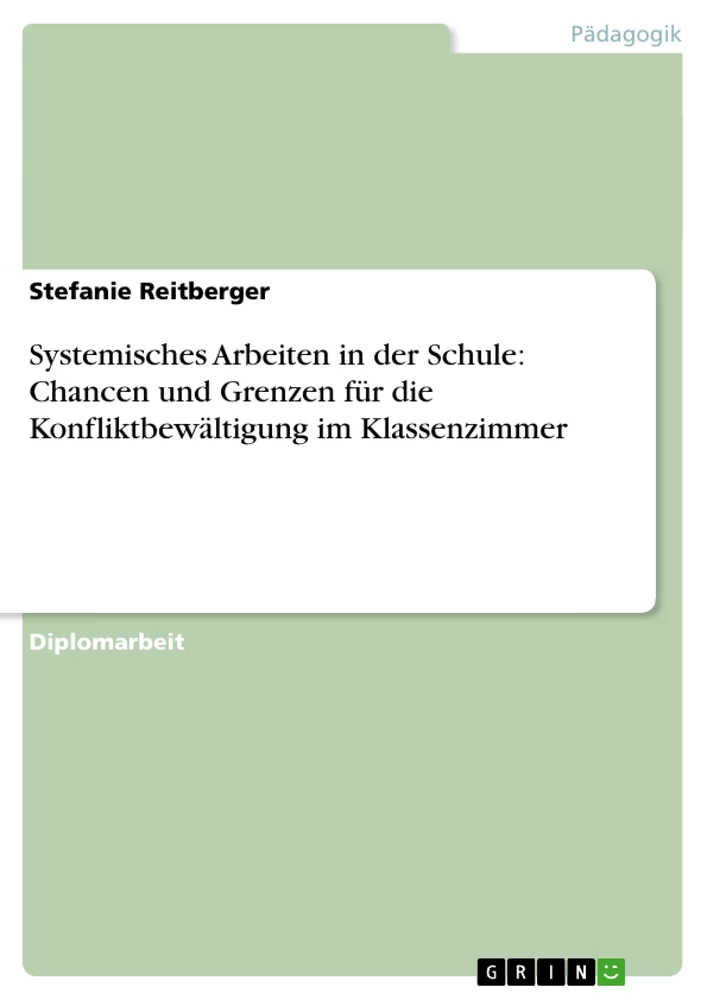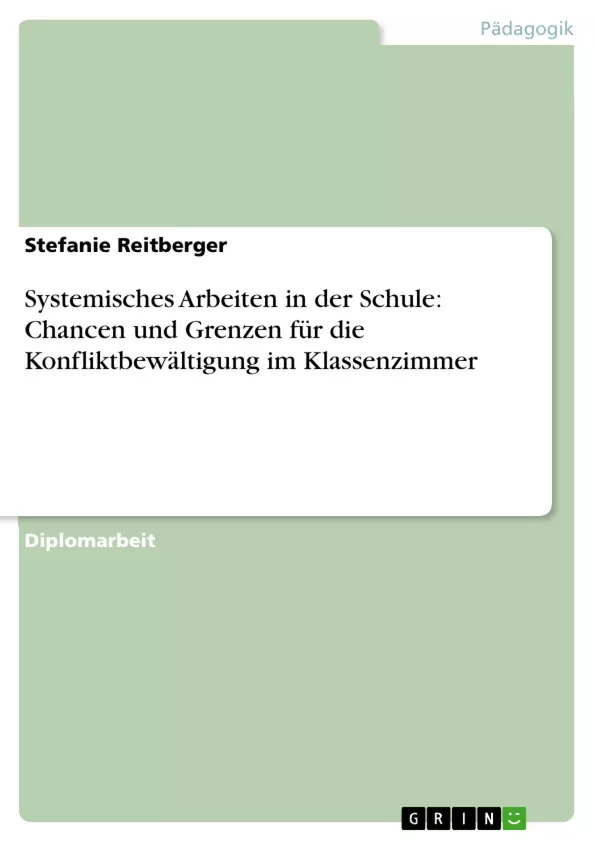[...] Immer mehr Lehrerinnen und Lehrer empfinden den Umgang mit
verhaltensauffälligen Schülern als schwierig und belastend. Es wird beklagt, dass
Schüler unsozial und egoistisch seien. Man benötigt mehr Zeit, um sie zu den
Verhaltensweisen zu bewegen, die für einen normalen Unterrichtsverlauf unerlässlich
sind. Darüber hinaus sind Lehrer und öffentliche Meinung der Ansicht, Konflikte würden
heute härter und rücksichtsloser ausgetragen als früher.1
Die Situation im Klassenzimmer hat sich im Verlauf der letzten Jahre offenbar drastisch
verändert. Die Lebensbedingungen heutiger Schülern verändern sich rasant und
spiegeln sich auch in deren schulischen Verhaltensweisen. Auffälliges Verhalten kann
nicht ausschließlich den Kindern zum Vorwurf gemacht werden. Denn es ist oft
Ausdruck von Problemen, die sie aus dem häuslichen Bereich in die Schule
hineintragen. Viele Schüler sind introvertiert oder aggressiv, weil sie sich mit Problemen
auseinandersetzen, die eigentlich ihre Eltern lösen müssten2.
Bei einer Scheidungsrate von 50 Prozent in Großstädten ist es natürlich, dass viele
Schulkinder lang andauernde Konfliktsituationen und Trennungen durchstehen müssen.
Innere Turbulenzen werden in der Schule und anderen sozialen Situationen ausgelebt.
Das Verhalten vieler Kinder verweist auf eine große Beziehungsunsicherheit.3
Ein Schüler ist in diesem Verständnis nach kein isoliertes Individuum, sondern in ein
System von sozialen Beziehungen eingebettet, das sein Verhalten beeinflusst. Ein
Problemschüler wird somit von seinem sozialen Netzwerk geprägt. Die Familie und die
Schule sind dabei die beiden Hauptbezugssysteme. Wiederum beeinflusst er durch sein
Verhalten die anderen Mitglieder seines Bezugssystems (Familie, Schulklasse).4
Die systemische Sichtweise ist, die individuellen Störungen unter dem Aspekt des an
der Störung beteiligten System zu betrachten. In diesem Kontext spricht man von
systemischer Familientherapie bzw. wenn ein weiteres soziales Umfeld betrachtet wird,
von Systemtherapie. Nach diesem Ansatz werden Disziplinstörungen bzw.
Verhaltensauffälligkeiten von Schülern in ihrem familiären Kontext betrachtet. Doch
welche Verhaltensauffälligkeiten weisen Schüler überhaupt auf?
1 Vgl. Jürgens, B., 2000, S. 1.
2 Vgl. Gebauer, K., 1997, S. 17.
3 Ebenda, S. 18.
4 Vgl. Hennig, C., Knödler, U., 1998, S. 25.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Fragestellungen der Arbeit
- 1.1 Disziplinstörungen in der Schule
- 1.2 Inhalt und Aufbau der Arbeit
- 2. Grundlagen der systemischen Familientherapie
- 2.1 Systemtheoretische Aspekte der Familientherapie
- 2.1.1 Was ist ein System?
- 2.1.2 Die Entwicklung der Systemtheorie
- 2.1.3 Systemtheoretische Begriffe
- 2.1.4 Das systemische-konstruktivistische Denken und Sehen
- 2.2 Basiskonzepte der Familientherapie
- 2.2.1 Das psychoanalytische Konzept
- 2.2.2 Das interaktionelle Konzept
- 2.2.3 Das strukturelle Konzept
- 2.3 Das system-phänomenologische Familienkonzept
- 3. Systembeschreibung und Systemanalyse
- 3.1 Die Familie als soziales System
- 3.2 Soziale Systeme und ihre Umwelt
- 3.3 Beziehungen im sozialen System
- 3.3.1 Interaktion
- 3.3.2 Kommunikation
- 3.3.3 Strukturen
- 3.4 Systemische Handlungsrichtlinien
- 3.4.1 Hypothesenbildung
- 3.4.2 Zirkularität
- 3.4.3 Ressourcen- und Lösungsorientierung
- 4. Systemtherapeutische Praxis
- 4.1 Das Problemverhalten vor dem familiären Hintergrund
- 4.2 Informationen und Hypothesen
- 4.2.1 Telefonerstgespräch, Anmeldebögen und Akten
- 4.2.2 Genogramme
- 4.2.3 Systemzeichnungen
- 4.2.4 Zuweisungskontext
- 4.3 Systemische Fragen
- 4.3.1 Zirkuläres Fragen
- 4.3.2 Anfangs- und Abschlussfragen
- 4.4 Metaphorische Techniken
- 4.4.1 Familienskulptur
- 4.4.2 Das Familienbrett
- 4.4.3 Familienstellen
- 4.5 Interventionen und Kommentare
- 4.5.1 Positive Konnotation
- 4.5.2 Umdeutung - Refraiming
- 4.5.3 Splitting Methode und Reflektierendes Team
- 4.5.4 Schlussintervention
- 4.6 Behandlungstechniken für Kinder
- 5. Möglichkeiten des systemischen Arbeitens in der Schule
- 5.1 Unterstützung der Schule im familiären Therapieprozess
- 5.1.1 Kontaktaufnahme des Therapeuten mit dem System Schule
- 5.1.2 Diagnostik und Unterrichtsbeobachtung
- 5.2 Systemische Supervision für Lehrer
- 5.3 Klassische Familientherapie in der Schulklasse
- 5.4 Das Landshuter Schulentwicklungsprojekt
- 5.4.1 Intention und Ziele
- 5.4.2 Struktur des Projekts
- 5.4.3 Hintergründe: Schule und das Thema „Gewalt”
- 5.4.4 Methoden
- 5.4.5 Evaluation und Ausblick
- 5.4.6 Das Projekt als Beitrag zur Schulentwicklung
- 6. Grenzen der Familientherapie in schulischen Konflikten
- 6.1 Familie entzieht sich dem Therapieprozess
- 6.2 Stationäre systemische Familientherapie
- 6.3 Schulische Überforderung
- 6.4 Defizit im Lern- und Arbeitsverhalten
- 6.5 Pädagogisches Ungeschick des Lehrers
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Chancen und Grenzen systemischen Arbeitens in der Schule zur Konfliktbewältigung im Klassenzimmer. Ziel ist es, die Anwendbarkeit systemischer Familientherapiemethoden im schulischen Kontext zu evaluieren und potenzielle Herausforderungen aufzuzeigen.
- Anwendbarkeit systemischer Methoden in der Schule
- Konfliktbewältigung im Klassenzimmer
- Herausforderungen bei der Umsetzung systemischer Ansätze
- Zusammenarbeit Schule-Familie
- Schulentwicklungsprojekte im Kontext von Gewaltprävention
Zusammenfassung der Kapitel
1. Fragestellungen der Arbeit: Dieses einführende Kapitel definiert die Forschungsfrage und strukturiert den Aufbau der Arbeit. Es skizziert den Kontext von Disziplinstörungen in der Schule und begründet die Wahl des systemischen Ansatzes als Untersuchungsmethode.
2. Grundlagen der systemischen Familientherapie: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Einführung in die systemische Familientherapie. Es beleuchtet systemtheoretische Aspekte, verschiedene Konzepte der Familientherapie und das system-phänomenologische Familienkonzept. Die Kapitelteile behandeln die Entwicklung der Systemtheorie, systemtheoretische Begriffe wie Zirkularität und Rückkopplung, und die verschiedenen Betrachtungsweisen von Familienproblemen.
3. Systembeschreibung und Systemanalyse: Hier wird die Familie als soziales System beschrieben und analysiert. Der Fokus liegt auf den Beziehungen innerhalb des Systems, der Interaktion und Kommunikation sowie den relevanten Strukturen. Es werden systemische Handlungsrichtlinien wie Hypothesenbildung, Zirkularität und Ressourcenorientierung erläutert, die für das systemische Arbeiten unerlässlich sind.
4. Systemtherapeutische Praxis: Dieses Kapitel beschreibt die praktische Anwendung systemischer Methoden in der Familientherapie. Es werden verschiedene Techniken wie zirkuläres Fragen, Genogramme, Familienskulpturen und Interventionen detailliert dargestellt und im Kontext der Familientherapie erläutert. Es geht um die Gewinnung von Informationen, die Hypothesenbildung und die Umsetzung der Interventionen.
5. Möglichkeiten des systemischen Arbeitens in der Schule: Dieses Kapitel untersucht die Übertragbarkeit systemischer Ansätze auf den schulischen Kontext. Es werden verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, wie systemisches Denken und Handeln die Zusammenarbeit zwischen Schule und Familie verbessern und zur Konfliktlösung beitragen können. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Landshuter Schulentwicklungsprojekt und dessen Methoden, Zielen und Evaluation.
6. Grenzen der Familientherapie in schulischen Konflikten: Das Kapitel widmet sich den Herausforderungen und Grenzen der Anwendung systemischer Familientherapie in der Schule. Es analysiert verschiedene Szenarien, in denen die Methode an ihre Grenzen stößt, beispielsweise wenn sich Familien der Therapie verweigern oder schulische Überforderungen im Vordergrund stehen. Es werden praktische Schwierigkeiten und die Rolle pädagogischen Geschicks des Lehrers beleuchtet.
Schlüsselwörter
Systemisches Arbeiten, Familientherapie, Schule, Konfliktbewältigung, Klassenzimmer, Disziplinstörungen, Systemtheorie, Kommunikation, Interaktion, Ressourcenorientierung, Schulentwicklung, Zusammenarbeit Schule-Familie, Landshuter Schulentwicklungsprojekt, Gewaltprävention.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Systemisches Arbeiten in der Schule
Was ist der Gegenstand der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Chancen und Grenzen des systemischen Arbeitens in der Schule zur Konfliktbewältigung im Klassenzimmer. Sie evaluiert die Anwendbarkeit systemischer Familientherapiemethoden im schulischen Kontext und zeigt potenzielle Herausforderungen auf.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Anwendbarkeit systemischer Methoden in der Schule, Konfliktbewältigung im Klassenzimmer, Herausforderungen bei der Umsetzung systemischer Ansätze, die Zusammenarbeit zwischen Schule und Familie und Schulentwicklungsprojekte im Kontext von Gewaltprävention. Sie beleuchtet die Grundlagen der systemischen Familientherapie, verschiedene systemtherapeutische Praktiken und analysiert die Grenzen der Methode im schulischen Kontext.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel. Kapitel 1 definiert die Forschungsfrage und strukturiert die Arbeit. Kapitel 2 liefert eine umfassende Einführung in die systemische Familientherapie. Kapitel 3 beschreibt und analysiert die Familie als soziales System. Kapitel 4 beschreibt die praktische Anwendung systemischer Methoden. Kapitel 5 untersucht die Übertragbarkeit systemischer Ansätze auf den schulischen Kontext, mit einem Fokus auf das Landshuter Schulentwicklungsprojekt. Kapitel 6 widmet sich den Herausforderungen und Grenzen der Anwendung systemischer Familientherapie in der Schule.
Was sind die zentralen Methoden und Konzepte der Arbeit?
Die Arbeit basiert auf den Grundlagen der systemischen Familientherapie. Zentrale Konzepte sind Systemtheorie, Kommunikation, Interaktion, Ressourcenorientierung, Zirkularität und Rückkopplung. Es werden verschiedene systemtherapeutische Techniken wie zirkuläres Fragen, Genogramme, Familienskulpturen und Interventionen erläutert.
Welche konkreten Methoden der systemischen Familientherapie werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt detailliert verschiedene Techniken der systemischen Familientherapie, darunter zirkuläres Fragen, Genogramme, Familienskulpturen, das Familienbrett, Familienstellen, positive Konnotation, Umdeutung (Reframing), die Splitting-Methode, das Reflektierende Team und Interventionen und Kommentare.
Welches Schulentwicklungsprojekt wird in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit untersucht das Landshuter Schulentwicklungsprojekt, analysiert dessen Intentionen, Ziele, Struktur, Methoden und Evaluation und bewertet dessen Beitrag zur Schulentwicklung im Kontext von Gewaltprävention.
Welche Herausforderungen und Grenzen des systemischen Arbeitens in der Schule werden angesprochen?
Die Arbeit analysiert verschiedene Szenarien, in denen die systemische Familientherapie an ihre Grenzen stößt, z.B. wenn sich Familien der Therapie verweigern, schulische Überforderungen im Vordergrund stehen, Defizite im Lern- und Arbeitsverhalten vorliegen oder pädagogisches Ungeschick des Lehrers besteht. Die Möglichkeit einer stationären systemischen Familientherapie wird ebenfalls diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Systemisches Arbeiten, Familientherapie, Schule, Konfliktbewältigung, Klassenzimmer, Disziplinstörungen, Systemtheorie, Kommunikation, Interaktion, Ressourcenorientierung, Schulentwicklung, Zusammenarbeit Schule-Familie, Landshuter Schulentwicklungsprojekt, Gewaltprävention.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Pädagogen, Schulpsychologen, Familientherapeuten, Studierende der Sozialen Arbeit, Erziehungswissenschaft und Psychologie sowie alle, die sich mit Konfliktbewältigung in der Schule und der Zusammenarbeit zwischen Schule und Familie auseinandersetzen.
- Quote paper
- Stefanie Reitberger (Author), 2003, Systemisches Arbeiten in der Schule: Chancen und Grenzen für die Konfliktbewältigung im Klassenzimmer, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/20614