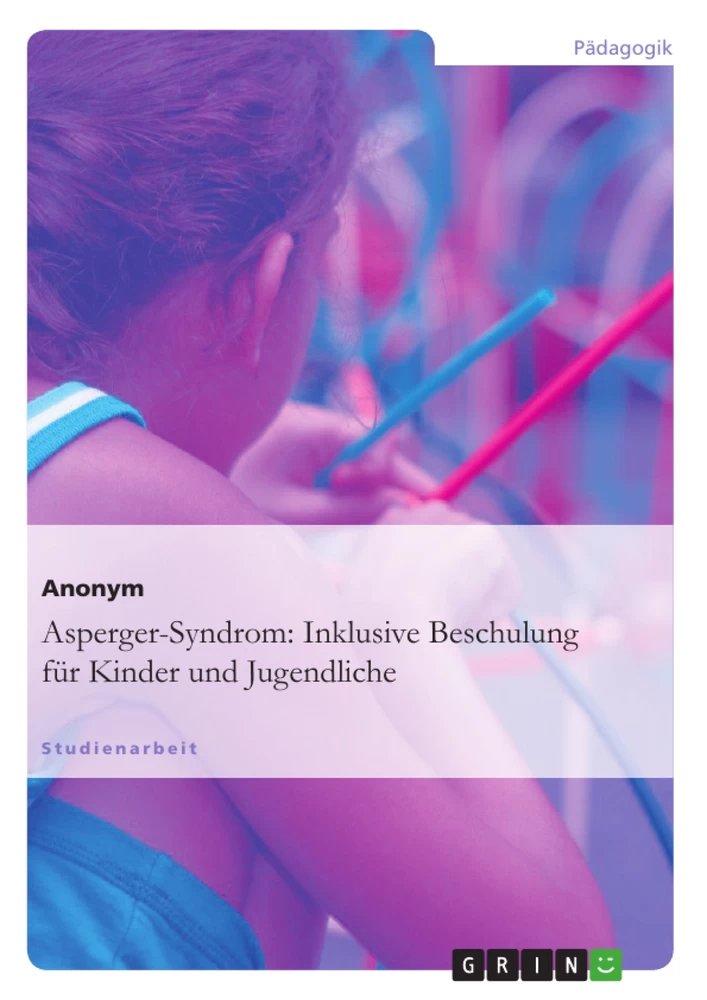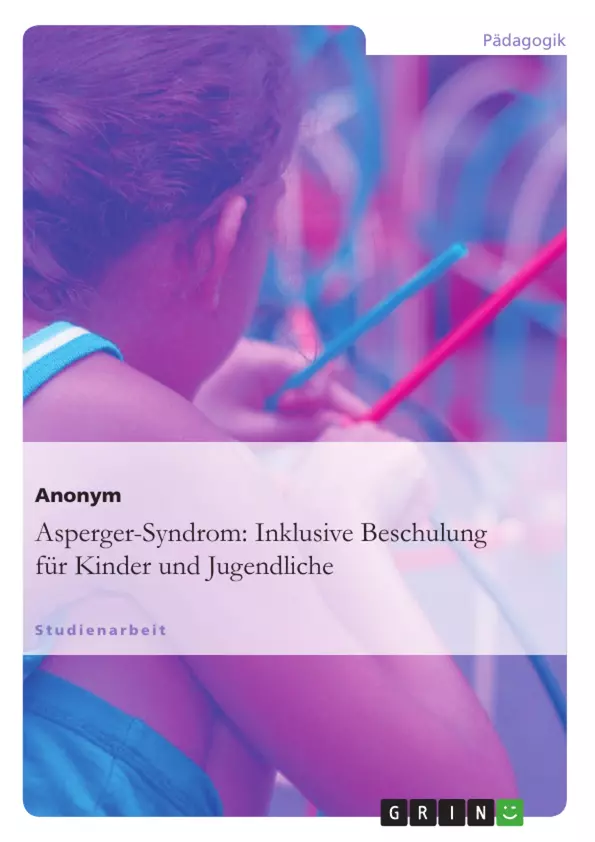„Asperger: Syndrom zwischen Autismus und Normalität“, "Oops-Wrong-Planet-Syndrom". Beide Bezeichnungen beschreiben dasselbe Syndrom: Die betroffenen Kinder bewegen sich zwischen den Polen Normalität und Andersartigkeit und versuchen, auf ihre Weise und mit ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten einen Platz in der Gesellschaft zu finden.
Ihr intellektuelles Potential macht es ihnen oftmals möglich, eine Regelschule zu besuchen – ihr besonderes Sozial- und Kommunikationsverhalten erschwert hingegen den Umgang mit anderen: Als Folge ist für viele Kinder der schulische Alltag mit Belastungen und Misserfolgen verbunden. Es kommt vor, dass sie sozial ausgegrenzt und nicht angemessen gefördert werden, so dass sie weder ihre Begabungen entfalten können noch die Schulzeit in guter Erinnerung behalten.
Die künftige inklusive Schule hat die Aufgabe, alle Kinder ohne Hierarchisierung anzunehmen und sich ihren individuellen Bedürfnissen anzupassen. Doch wie kann die inklusive Schule ein angenehmer und mit Erfolg verbundener Ort für diese Kinder sein? Unter welchen Bedingungen ist sie in der Lage, ihrer Besonderheit zu entsprechen und sie Gewinn bringend zu fördern?
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Definitionen: Was ist das Asperger Syndrom?
3. Merkmale des Asperger Syndroms
3.1 Kommunikation, Interaktion und Empathie
3.2 Sprache und Körpersprache
3.3 Interessen und Aktivitäten
3.4 Wahrnehmungen und Reizüberflutung
3.5 Begabungen und schulischer Alltag
4. Kinder mit Asperger Syndrom in der Schule
4.1 Empfehlungen der Kultusministerkonferenz
4.2 Die Gestaltung des Lern- und Lebensraumes Schule
4.2.1 Organisation
4.2.2 Unterricht
4.2.3 Arbeitsverhalten
4.2.4 Soziale Beziehungen
4.2.5 Zusätzliche Unterstützung in der Schule
4.2.5.1 Alternative Angebote
4.2.5.2 Schulbegleitung
5. Die inklusive Schule: Bausteine für gelingendes Lernen aller Kinder
6. Kommentar
7. Literatur
Häufig gestellte Fragen
Was charakterisiert Kinder mit Asperger-Syndrom im schulischen Kontext?
Sie verfügen oft über ein hohes intellektuelles Potenzial, zeigen jedoch Besonderheiten im Sozialverhalten, in der Kommunikation und in der Reizverarbeitung.
Welche Herausforderungen bietet die Regelschule für Asperger-Autisten?
Der schulische Alltag ist oft durch soziale Ausgrenzung, Reizüberflutung und Schwierigkeiten im Umgang mit unstrukturierten Situationen belastet.
Was sind wichtige Bausteine für eine gelingende Inklusion?
Dazu gehören die Anpassung des Lernraums, klare Strukturen im Unterricht, Schulbegleitung und die Akzeptanz individueller Bedürfnisse ohne Hierarchisierung.
Welche Rolle spielt die Schulbegleitung beim Asperger-Syndrom?
Schulbegleiter unterstützen die Kinder dabei, soziale Interaktionen zu bewältigen, Reize zu filtern und den schulischen Anforderungen besser gerecht zu werden.
Was empfiehlt die Kultusministerkonferenz zur Beschulung dieser Kinder?
Die KMK gibt Empfehlungen zur Gestaltung des Lern- und Lebensraumes Schule, um eine angemessene Förderung und Teilhabe sicherzustellen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2012, Asperger-Syndrom: Inklusive Beschulung für Kinder und Jugendliche, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/204988