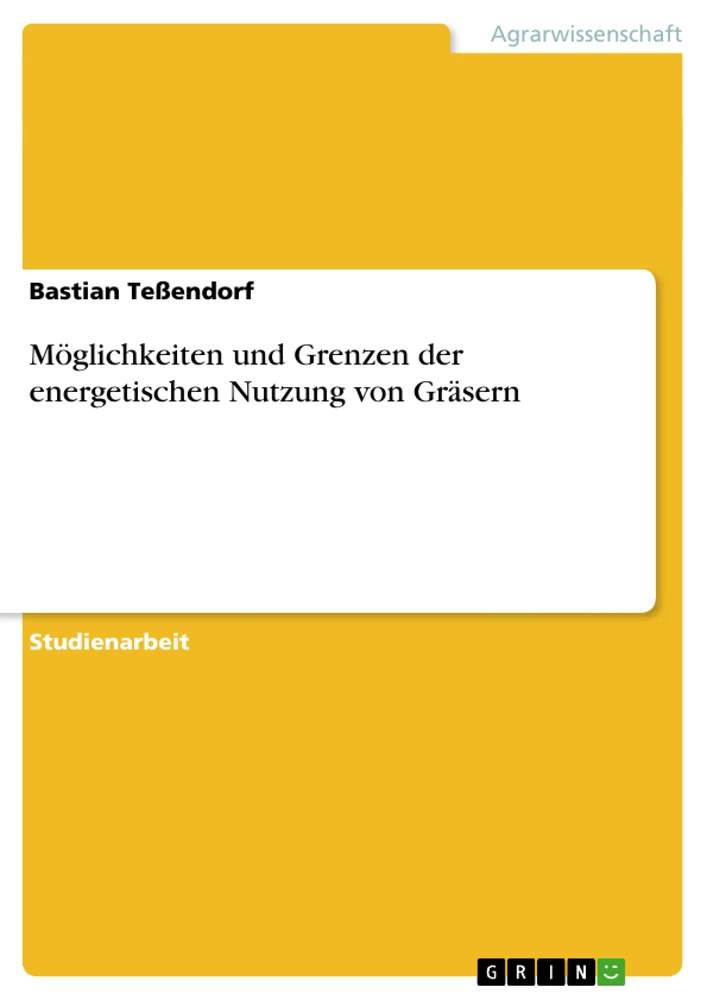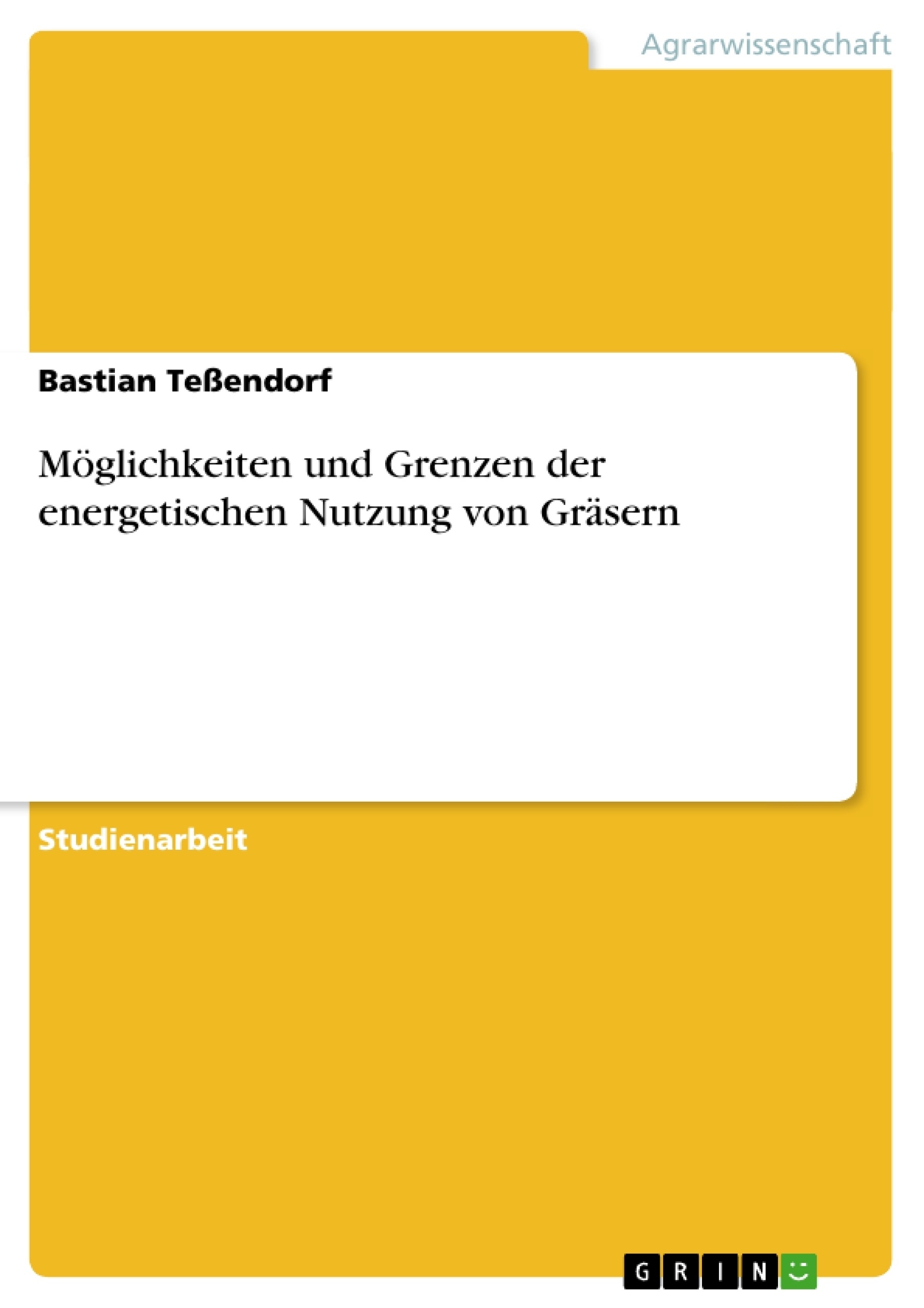Biogas aus nachwachsenden Rohstoffen erlebt derzeit einen regelrechten Boom. Die Zahl installierter Anlagen zur Gewinnung von Biogas ist in den letzten Jahren sprunghaft ge¬wachsen. Laut einer Schätzung des Fachverbands Biogas (FvB) gehen Experten momen¬tan von 5500-5800 Vergärern mit einer Leistung von ca. 2200 Megawatt bundesweit aus. Dies setzt eine gesicherte Basis für die Biomasseproduktion voraus.
Die Grünlandnutzung wird zunehmend zur Biogasproduktion genutzt. Sie hat einen Anteil von ca. 30% an der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Nach Mais ist es heute das zweitwichtigste Substrat. Besonders in ackerbaulich schwierigen Regio¬nen leistet es somit einen wichtigen Teil zur Biomasseproduktion. Der an vielen Orten ver¬zeichnete Rückgang der Milchproduktion eröffnet Perspektiven für die alternative Nutzung in der Biomasseerzeugung. Primär kann unter diesem Aspekt eine Konzentrierung auf die energetische Nutzung von Gräsern lohnenswert sein.
So werden weite Teile Deutschlands, die seither einer wirtschaftlichen Grünlandnutzung unterlagen, nicht mehr als Futterflächen benötigt. Grund für diese Entwicklung ist zum einen die veränderte Landwirtschaftstruktur, welche eine Folge der EU- Agrarpolitik ist. Hierbei ist zum einen die starke Förderung des Silomaisanbaus gemeint und zum anderen rührt sie aus der steigenden Tierleistung her. Diese führt zu veränderten Fütterungsanspruch der Tiere, so dass ein zunehmend erhöhter Einsatz von Kraftfutter, besonders in der Milchviehhaltung, zu verzeichnen ist. Damit eng verbunden sind die Grünlandflächen, die allein den hohen Bedarf an Futterstoffen der Tiere nicht mehr decken können und daher nur zum Teil in den Fütterungskreislauf einwirken, wo¬durch ein großer Teil nicht verwertet wird. Als Folge des nicht gebrauchten Mähgutes werden Grünlandflächen zu Brachflächen, Buschland oder Wald.
Die Förderung der energetischen Nutzung von pflanzlicher Biomasse ist durch das Stromeinspeisungsgesetz (EEG vom 01. April 2000) wesentlich verbessert worden ist. Darüber hinaus existiert mittlerweile die Möglichkeit der erzeugernahen Verbrennung, so dass die damit geringen Transportkosten die Gräserverbrennung in eine aussichtsreiche Position auf dem Agrarrohstoffmarkt. Ein weiterer positiver Effekt impliziert die Tatsache, dass nachwachsende Rohstoffe, wie z.B. Grünland, als Energieträger CO2- neutral sind.
Inhalt
1. Einleitung
2. Die energetische Nutzung
2.1. Was ist energetische Nutzung?
2.2. Die energetische Nutzung von Biomasse (insbesondere von Gras/ Grassilage)
2.2.Energetische Gewinnung aus Gräsern
2.3.Bedeutung der energetischen Nutzung von Gräsern / Biomasse
3.Fazit
4. Bibliographie
1. Einleitung
Biogas aus nachwachsenden Rohstoffen erlebt derzeit einen regelrechten Boom. Die Zahl installierter Anlagen zur Gewinnung von Biogas ist in den letzten Jahren sprunghaft gewachsen. Laut einer Schätzung des Fachverbands Biogas (FvB) gehen Experten momentan von 5500-5800 Vergärern mit einer Leistung von ca. 2200 Megawatt bundesweit aus. Dies setzt eine gesicherte Basis für die Biomasseproduktion voraus.
Die Grünlandnutzung wird zunehmend zur Biogasproduktion genutzt. Sie hat einen Anteil von ca. 30% an der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Nach Mais ist es heute das zweitwichtigste Substrat. Besonders in ackerbaulich schwierigen Regionen leistet es somit einen wichtigen Teil zur Biomasseproduktion. Der an vielen Orten verzeichnete Rückgang der Milchproduktion eröffnet Perspektiven für die alternative Nutzung in der Biomasseerzeugung. Primär kann unter diesem Aspekt eine Konzentrierung auf die energetische Nutzung von Gräsern lohnenswert sein.
So werden weite Teile Deutschlands, die seither einer wirtschaftlichen Grünlandnutzung unterlagen, nicht mehr als Futterflächen benötigt. Grund für diese Entwicklung ist zum einen die veränderte Landwirtschaftstruktur, welche eine Folge der EU- Agrarpolitik ist. Hierbei ist zum einen die starke Förderung des Silomaisanbaus gemeint und zum anderen rührt sie aus der steigenden Tierleistung her. Diese führt zu veränderten Fütterungsanspruch der Tiere, so dass ein zunehmend erhöhter Einsatz von Kraftfutter, besonders in der Milchviehhaltung, zu verzeichnen ist. Damit eng verbunden sind die Grünlandflächen, die allein den hohen Bedarf an Futterstoffen der Tiere nicht mehr decken können und daher nur zum Teil in den Fütterungskreislauf einwirken, wodurch ein großer Teil nicht verwertet wird. Als Folge des nicht gebrauchten Mähgutes werden Grünlandflächen zu Brachflächen, Buschland oder Wald.
Die Förderung der energetischen Nutzung von pflanzlicher Biomasse ist durch das Stromeinspeisungsgesetz (EEG vom 01. April 2000) wesentlich verbessert worden ist. Darüber hinaus existiert mittlerweile die Möglichkeit der erzeugernahen Verbrennung, so dass die damit geringen Transportkosten die Gräserverbrennung in eine aussichtsreiche Position auf dem Agrarrohstoffmarkt. Ein weiterer positiver Effekt impliziert die Tatsache, dass nachwachsende Rohstoffe, wie z.B. Grünland, als Energieträger CO2- neutral sind.
2. Die energetische Nutzung
2.1. Was ist energetische Nutzung?
Die Möglichkeiten der energetischen Nutzung aus Biomasse sind vielfältig und haben eine historische Bedeutung für Energiegewinnung für den Menschen. Zumal das ‚einfache‘ Verbrennen nicht immer der effizienteste Weg ist. Entwicklungen moderner Technologien haben in den letzten Jahren zu vielversprechenden Lösungen bzw. Ansätzen geführt, eine größtmögliche Energieausbeute zu erzielen. Grundsätzlich wird die energetische Nutzung auf u.a. die Energieprodukte Wärme, alkoholische Gärung (Ethanolproduktion), Gase (Methangärung) und elektrische Leistung (Kraft-Wärme-Kopplung- KWK) fokussiert.
Wege der Energieerschließung aus Biomasse:[1]
Verbrennung
Primär geht es bei der Verbrennung um Erzeugung von Wärme, dabei verbindet sich der in der Biomasse enthaltene Kohlenstoff mit Sauerstoff aus der Luft. Obwohl man wie oben erwähnt von einer neutralen CO2-Bilanz ausgeht (da bei der Verbrennung kein weiteres CO2 abgegeben wird), kommt es dennoch vereinzelt zur klima- und gesundheitsschädigenden Freisetzung von Nebenprodukten bei der Verbrennung.
Vergasen
Durch physikalisch-chemische Umwandlungsprozesse entsteht ein sehr energiereiches Gas, welches wiederrum zur effizienten Verbrennung herangezogen werden kann. Mit dem entstandenen Prozessgas lassen sich z.B. Motoren antreiben.
Vergärung
Unter dem Begriff Vergärung versteht man den Abbau von biogenem Material durch Mikroorganismen in Abwesenheit von Sauerstoff, d.h. unter anaeroben Bedingungen. Mehrere Bakteriengruppen, welche sehr eng zusammenarbeiten, verwandeln biogenes Material in Biogas.
Darüber hinaus stehen viele andere Prozesse zur energetischen Gewinnung aus Biomasse zur Verfügung (z.B. Wasserstoffproduktion durch Algen), die in diesem Kontext jedoch nicht näher betrachtet werden.
2.2. Die energetische Nutzung von Biomasse (insbesondere von Gras/ Grassilage)
Es gibt verschiedene Gründe für die Nutzung von Biomasse, einer dieser Gründe ist der Gedanke der Nachhaltigkeit. Doch auch wirtschaftliche Kriterien, politische Vorgaben und Ziele, nutzbare Potentiale technologischer Entwicklungen spielen eine wichtige Rolle. So hatte im Jahre 1995 die Energie aus Biomasse in der EU einen Anteil an der Primärenergie von lediglich 6%. Dieser Anteil sollte bis 2010 auf 12% verdoppelt werden. Zusätzlich spielt die Reduzierung der CO2- Emissionen (Reduzierung in der EU um 8% von 1990 bis 2010, dabei war der Beitrag Deutschlands eine Reduzierung von 25% von 1990-2005).[2]
Der Biogasertrag von Grassschnitt liegt (bei einem Wassergehalt von 45 bis 70%) zwischen 150 und 200 m³/t FM, der Methangehalt des Gases wird mit ca. 55% angegeben. Aus diesen Werten resultiert ein Energieertrag von 3 MJ/ kg. Da unterschiedliche Grasarten existieren - vom jungen und kurzen Golfrasenschnitt über landwirtschaftliches Futtergras bis zum überständigen Gras von nur einmal jährlich gemähten Nutzungsflächen - und damit verbunden die unterschiedliche Qualitäten der Gräser festgelegt werden müssen, sprechen wir von einer großen Spannweite der Biogaserträge der einzelnen Gräser.
Grün- und Rasenschnitte sind neben Verbrennung, in Nassfermentationsanlagen (Vergärung von tierischen Exkrementen wie Gülle) als Ko-Substrate nutzbar. Da sie jedoch dazu neigen eine Schwimmdecke zu bilden, ist eine abgestimmte Rührtechnik erforderlich. Doch auch die Möglichkeit der Trockenfermentation ist gegeben. Gegebenenfalls muss das Material vor dem Einbringen in die Biogasanlage von Störstoffen, wie Ästen oder Steinen befreit und homogenisiert werden. Eine Hygienisierung ist in der Regel nicht erforderlich. Da jedoch Grün- und Rasenschnitt nur saisonal anfällt, muss es für eine ganzjährige Bereitstellung siliert werden. Auch hierbei ist wieder zu beachten, dass es aufgrund des weit verstreuten Aufkommens zu hohen Transportkosten kommen kann.
Nass- und Trockenfermentation[3]
„Bei der Nassfermentation macht ein hoher Wasseranteil im Gärsubstrat die Masse rühr- und fließfähig und wird während der Fermentation durchmischt. Die Trockenfermentation oder auch Feststoffvergärung erfolgt mit stapelbarer organischer Biomasse. Im Gegensatz zur Nassvergärung wird hier das Gärgut weder verflüssigt, noch erfolgt eine ständige Durchmischung während der Vergärung. Die Verfahrenswahl hängt im Wesentlichen von den Substraten ab. Für die Güllenutzung kommt nur die Nassvergärung in Frage, während strukturreiche Biomasse oft die für die Nassvergärung nötigen Rührwerke blockiert. Bei der Nassvergärung muss daher die feste Biomasse gut zerkleinert und mit Flüssigkeit pumpfähig gehalten werden. In Deutschland ist die Nassvergärung vorherrschend, weil die meisten Anlagen von Landwirten mit Viehzucht errichtet wurden, die häufig sowohl Energiepflanzen als auch Gülle einsetzen.“ (aus Wikipedia).
Bei der Nassfermentation kommt es außerdem oft zum Einsatz von leistungsstarken Rührwerken (Tauchpropeller-, Paddel- bzw. Haspelrührwerke), da es bei der Beschickung der Anlagen mit Gülle-Gras-Mischungen bis zu einem Trockenmasseanteil von 12 % kommen kann (Lemmer und Oechsener 2001).[4]
Zu stark komprimierte Silagen führen auf der anderen Seite bei der Trockenfermentation zu einer schlechteren Benetzung des Gärsubstrates mit Flüssigkeit und somit zu ungleichmäßigen Abbauraten im Fermenter.
2.2.Energetische Gewinnung aus Gräsern
Voraussetzung für eine ordentliche Energieausbeute ist ein hoher Ertrag pro Schnitt. Im Allgemeinen gehen wird von vier bis max. fünf Schnitten ausgegangen. Für einen rentablen Ertrag sollte demnach das Zusammenspiel von Ertrag und Inhaltsstoffen möglichst günstig ausfallen.
Bei der Vergärung von Gräsern ist dementsprechend auf Folgendes zu achten
- Erntezeitpunkt: Der Energiegehalt der einzelnen Schnitte ist zu beachten, wobei gilt: Je älter das Gras, desto ungünstiger (die steigenden Ligningehalte sind als negativ für den Einsatz in Biogasanlagen zu betrachten)
- Halmlänge: Das Erntegut sollte möglichst kurz gehäckselt werden, um mechanische Probleme im Fermenter vorzubeugen und um der eventuellen Bildung von Schwimmschichten entgegenzuwirken oder aber auch die Verweilzeit zu verringern. Diese Ansprüche bestehen bei der Verbrennung nicht.
Zusammenfassend gilt also, dass die Gasausbaute von der jeweiligen Sorte der Pflanze, vom Aufwuchs (den einzelnen Schnitten) und dem Erntezeitpunkt abhängt.
Biogasausbeute von Gräsern und Silagen[5]
Frischgras 0,71 - 0,83 m³ Biogas / kg oTS
Silage 0,66 - 0,92 m³ Biogas / kg oTS
Dabei hat das deutsche Weidelgras (aber auch Wiesenschwingel) die höchste Gasausbeute. Dagegen haben das Knaulgras und Liechgras die niedrigsten Gasausbeuten. Eine Konservierung hat kaum Einfluss auf die Biomethanisierung. Gräser sind demnach ausnahmslos als Ko-Substrat geeignet (Nassfermentation mit Gülle). Dennoch erfordert eine ständige Beschickung die Form der Silage (6 MJ NEL / kg TS).
[...]
[1] Vgl. Das Wissensportal der Deutschen Energie-Agentur. In: http://www.thema-energie.de/energie-erzeugen/erneuerbare-energien/biomasse/grundlagen/energetische-nutzung-von-biomasse.html
[2] Vgl. Gülzower Fachgespräche (2001): Energetische Nutzung von Stroh, Ganzpflanzengetreide und weiterer halmgutartiger Biomasse. Stand der Technik und Perspektiven für den ländlichen Raum. Band 17, Tautenhain.
[3] Nass- und Trockenfermentaion aus Biogasanlage. In: http://de.wikipedia.org/wiki/Biogasanlage#Nass-_und_Trockenfermentation
[4] Vgl. Lemmer, A. u. H. Oechsler (2001): Einsatz von Gras- und Maissilage als Kosubstrat in landwirtschaftlichen Biogasanlagen. In: 10. Symposium Energie aus Biomasse. Contribution to conference 2001.
Häufig gestellte Fragen zum Inhalt
Was ist die energetische Nutzung von Biomasse?
Die energetische Nutzung von Biomasse bezieht sich auf die Gewinnung von Energie aus organischen Materialien. Dies kann in Form von Wärme, Alkohol (Ethanol), Gasen (Methan) oder elektrischer Leistung (Kraft-Wärme-Kopplung) erfolgen.
Welche Methoden gibt es zur Energiegewinnung aus Biomasse?
Es gibt verschiedene Methoden, darunter Verbrennung, Vergasung und Vergärung. Bei der Verbrennung wird die Biomasse verbrannt, um Wärme zu erzeugen. Bei der Vergasung wird die Biomasse in ein energiereiches Gas umgewandelt. Bei der Vergärung wird die Biomasse unter anaeroben Bedingungen von Mikroorganismen abgebaut, um Biogas zu erzeugen.
Welche Rolle spielt die Grünlandnutzung bei der Biogasproduktion?
Die Grünlandnutzung spielt eine zunehmend wichtige Rolle bei der Biogasproduktion. Gras wird als Substrat in Biogasanlagen verwendet, insbesondere in Regionen, in denen Ackerbau schwierig ist. Der Rückgang der Milchproduktion eröffnet Perspektiven für die alternative Nutzung von Grünland zur Biomasseerzeugung.
Was sind die Vorteile der energetischen Nutzung von Gräsern?
Die energetische Nutzung von Gräsern bietet mehrere Vorteile. Gräser sind CO2-neutral, da sie bei der Verbrennung nur so viel CO2 freisetzen, wie sie während des Wachstums aufgenommen haben. Darüber hinaus können Gräser in Nassfermentationsanlagen oder nach Silierung in Trockenfermentationsanlagen verwendet werden.
Was ist bei der Vergärung von Gräsern zu beachten?
Bei der Vergärung von Gräsern ist der Erntezeitpunkt wichtig, da der Energiegehalt mit zunehmendem Alter des Grases abnimmt. Die Halmlänge sollte kurz sein, um mechanische Probleme im Fermenter zu vermeiden. Die Gasausbeute hängt von der Grassorte, dem Aufwuchs und dem Erntezeitpunkt ab.
Was ist der Unterschied zwischen Nass- und Trockenfermentation?
Bei der Nassfermentation ist der Wasseranteil im Gärsubstrat hoch, wodurch die Masse rühr- und fließfähig ist. Bei der Trockenfermentation wird stapelbare organische Biomasse verwendet, die weder verflüssigt noch ständig durchmischt wird. Die Verfahrenswahl hängt von den verwendeten Substraten ab.
Wie hoch ist die Biogasausbeute von Gräsern und Silagen?
Die Biogasausbeute von Frischgras liegt zwischen 0,71 und 0,83 m³ Biogas / kg oTS (organische Trockensubstanz), während die Ausbeute von Silage zwischen 0,66 und 0,92 m³ Biogas / kg oTS liegt. Das deutsche Weidelgras hat die höchste Gasausbeute.
- Quote paper
- Bastian Teßendorf (Author), 2012, Möglichkeiten und Grenzen der energetischen Nutzung von Gräsern, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/204976