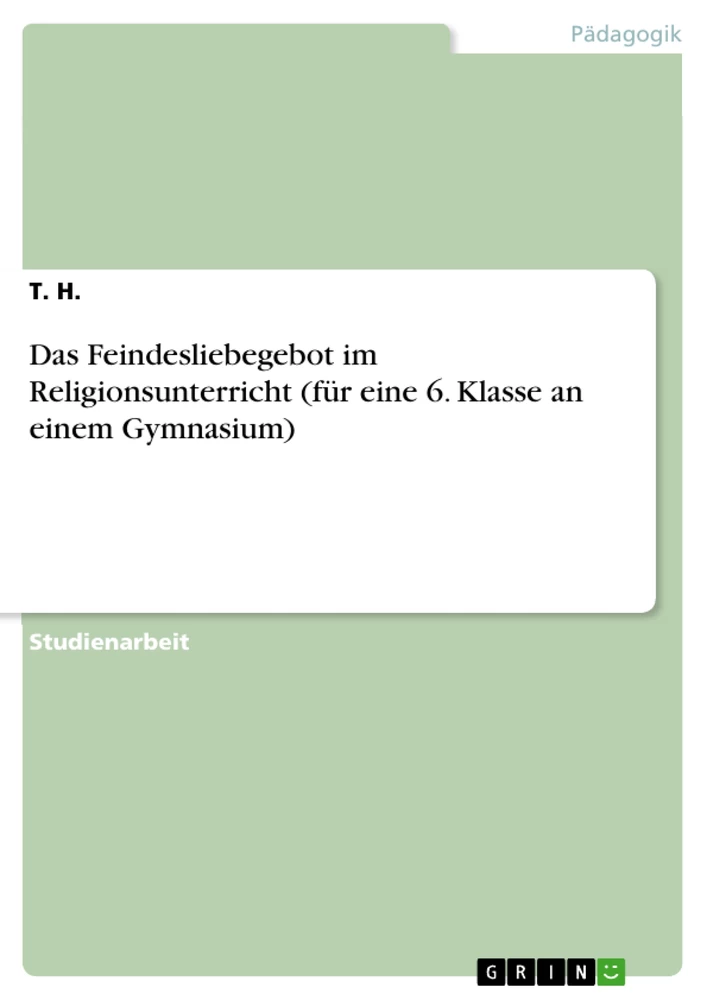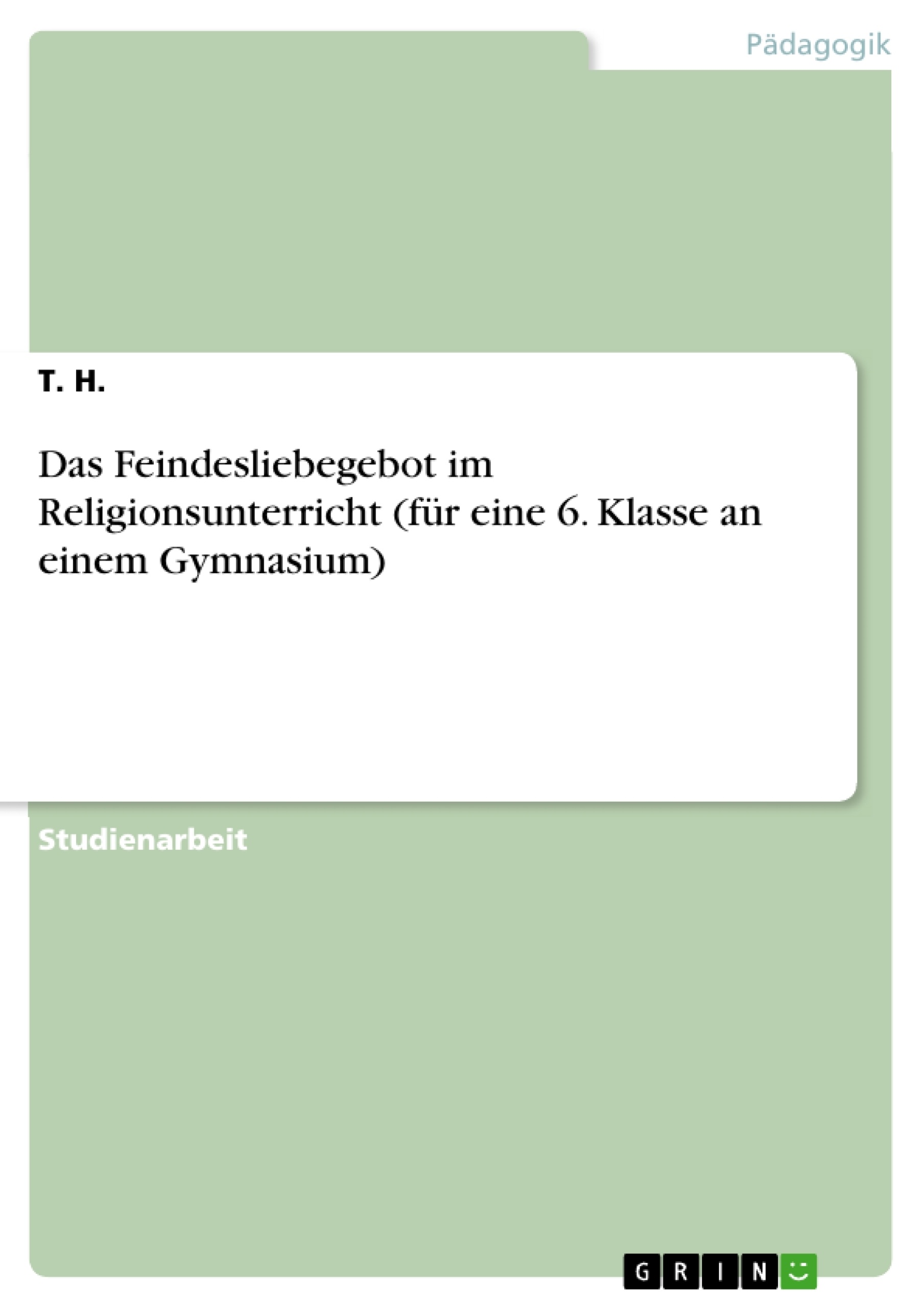Aufbau der Arbeit:
In der vorliegenden Arbeit wird das Thema der ,,Feindesliebe im Religionsunterricht“ für eine 6. Klasse an einem Gymnasium behandelt. Ziel der Arbeit wird sein, dass für eine Schulstunde (45 Minuten) das Thema der Feindesliebe näher entfaltet wird.
[Beispiele für Fragestellungen:] Zentral von Bedeutung ist dabei, dass sich die Schüler1 für die Feindesliebe öffnen und darüber nachsinnen, ob ihnen eine Radikalisierung der Nächstenliebe sinnvoll erscheint. Macht es Sinn, dass man eine Liebe ohne Grenzen lebt? Des Weiteren wird sich auch die Frage stellen, auf welche Weise man sich noch mit einem Feind ,,entfeinden“ kann?
Diese Fragestellungen sollen jedoch nur in aller Kürze umschreiben, was die grundlegende Ausrichtung des vorliegenden Unterrichtsentwurfs ist.
[Struktur/Aufbau der Arbeit:] Zu Beginn der Arbeit wird auf die Lern- und Lehrbedingungen (2.) eingegangen, die in der genannten Klassenstufe zu erwarten sind. Entwickelt wird das Thema für keine spezielle Klasse und deshalb wird darauf geachtet, dass die Feindesliebe in allgemeiner Weise an die Schüler altersgerecht herangetragen wird.
Nach den Lern- und Lehrbedingungen wird die fachdidaktische Analyse (3.) folgen, die den größten Raum der Arbeit ausfüllen wird.
Innerhalb der fachdidaktischen Analyse wird zu Beginn darauf eingegangen, welche Stellung das hier erarbeitete Thema zu seinem Kontext in der Unterrichtseinheit hat. Im Anschluss an diese Frage wird die ,,elementarisierende Erschließung“ folgen, die u. a. auf elementare Strukturen, Erfahrungen, Zugänge, Wahrheiten und Lernformen eingehen wird.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Analyse der Lern- und Lehrbedingungen
2.1 Die Lerngruppe
2.2 Einordnung in entwicklungspsychologische Modelle
2.3 Beschreibung des Sozial-, Arbeits- und Lernverhaltens
2.4 Die Beziehung zwischen dem Religionslehrer und den Schülern
3. Fachdidaktische Analyse
3.1 Didaktischer Zusammenhang
3.2 Elementarisierende Erschließung
3.2.1 Elementare Strukturen
3.2.2 Elementare Erfahrungen
3.2.3 Elementare Zugänge
3.2.4 Elementare Wahrheiten
3.2.5 Elementare Lernformen
4. Formulierung der Lernziele
5. Begründung und Diskussion des Lernwegs
6. Synoptischer Verlaufsplan des Unterrichts
7. Anhang (Materialien)
8. Bibliographie
- Quote paper
- T. H. (Author), 2011, Das Feindesliebegebot im Religionsunterricht (für eine 6. Klasse an einem Gymnasium), Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/204966