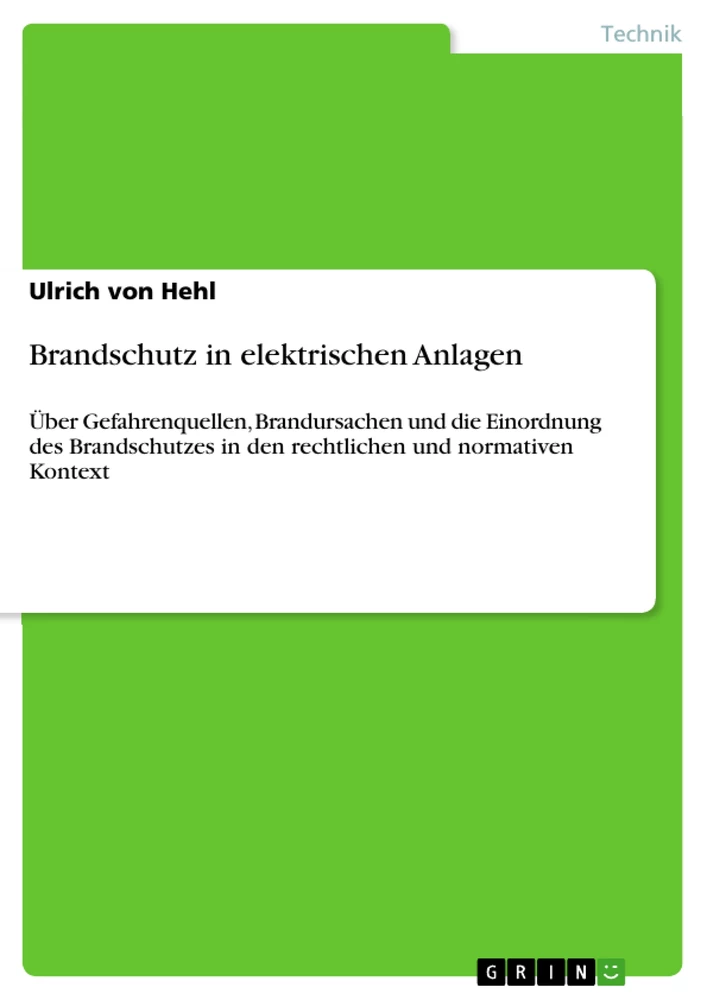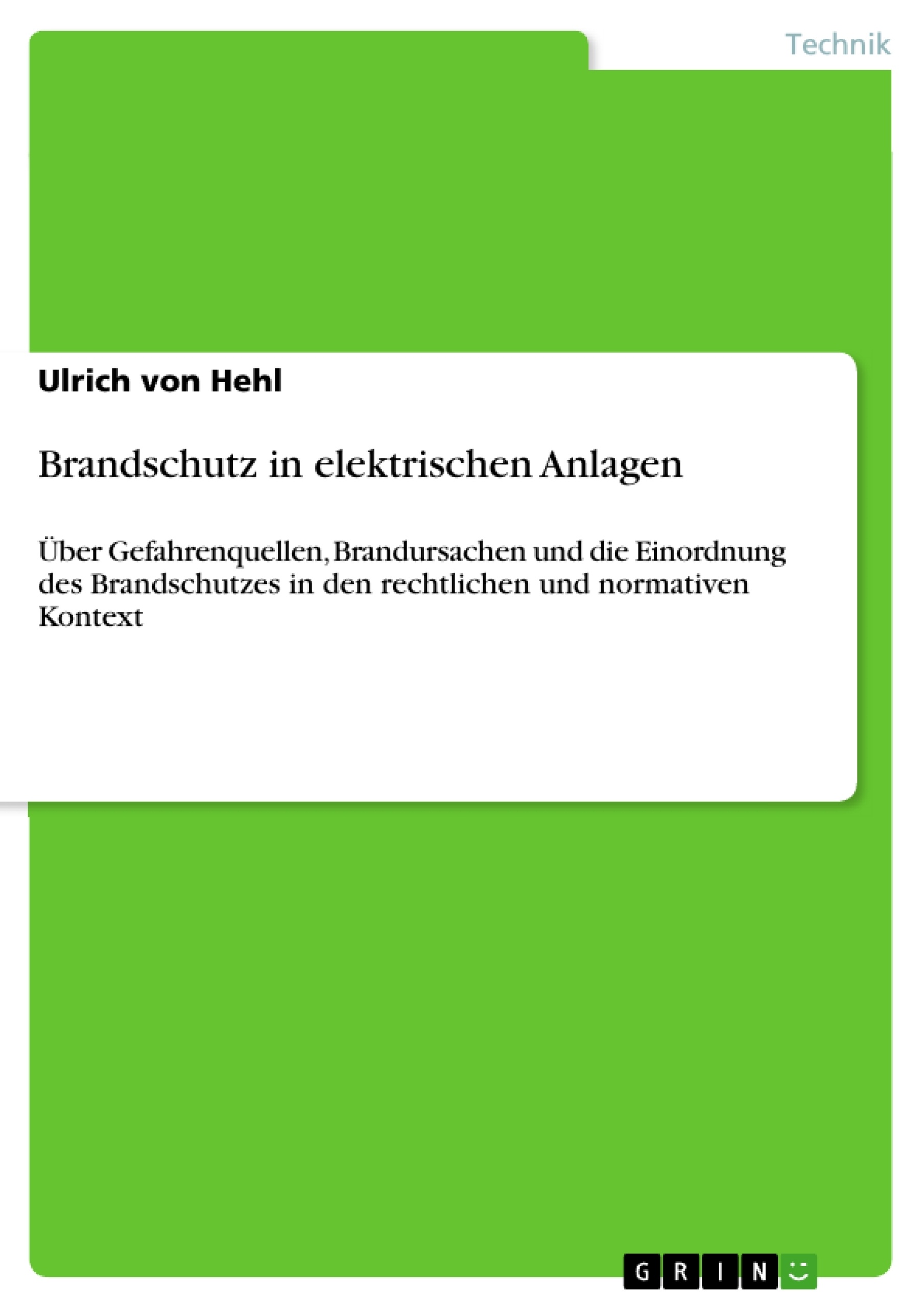Elektrotechnische Anlagen stellen aus Sicht des Brandschutzes immer ein erhöhtes Risiko dar. Die Gefährdungen, die durch fehlerhafte Planung, mangelhafte Ausführung und unterlassene Wartung in elektrischen Anlagen hervorgerufen werden, zeigen trotz Weiterentwicklung und Verbesserung von technischen Normen keine rückläufige Tendenz. In dieser Arbeit werden diese Risiken durch die Auswertung von einschlägiger Fachliteratur, Publikationen aus Sachverständigenkreisen und Versicherungen sowie von zahlreichen Normen und Gesetzen untersucht und die Ursachen von Schadensfeuern in elektrischen Anlagen technisch dargestellt. Neben einer wissenschaftlichen Betrachtung des Feuers und dessen Gefährdungspotential werden Statistiken zu schadensträchtigen Bränden ausgewertet und Anhaltspunkte für die zukünftig zunehmende Bedeutung des Brandschutzes in unserer Gesellschaft abgeleitet. Mit dem Ziel, eine Planungsgrundlage zur Verfügung zu stellen, werden weiterhin die komplexen Zusammenhänge zwischen Rechtsvorschriften und technischen Normen erklärt und deren Wichtigkeit für den planenden Ingenieur verdeutlicht.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Über den Autor
Einleitung
1 Brandschutz
2 Der Brand und seine Auswirkungen
2.1 Das Wesen des Feuers
2.2 Entstehen des Feuers und Brandverlauf
2.3 Physiologische Wirkungen des Feuers auf den Menschen
2.4 Wirtschaftliche Auswirkungen von Bränden
3 Rechtliche und normative Grundlagen des Brandschutzes
3.1 Baugesetzgebung in der Bundesrepublik Deutschland
3.1.1 Bundesrecht
3.1.2 Landesrecht
3.1.3 Europäische Einflüsse
3.2 Der Brandschutznachweis und Abweichungen vom Baurecht
3.3 Normative Grundlagen
3.3.1 DIN-Normen
3.3.2 VDE-Vorschriftenwerk
3.3.3 Richtlinien und Merkblätter der Versicherer
3.3.4 Sonstige technische Regelwerke
3.4 Überblick
4 Statistische Größen der Brandforschung
4.1 Brandopfer
4.2 Brandfälle in Deutschland
4.3 Brandschäden der Sachversicherer
4.4 Brandursachen
4.5 Mängelstatistik in elektrischen Anlagen nach VdS 2837
5 Elektrische Anlagen als Gefahrenquellen
5.1 Elektroanlage als Brandursache
5.1.1 Isolationsfehler, Überlastung und Kurzschluss
5.1.2 Unterlassene Wartung und mangelnde Sauberkeit elektrischer Anlagen
5.1.3 Mangelhafte elektrische Anschlüsse und Verbindungen
5.1.4 Neutralleiterbelastung und Oberschwingungen
5.1.5 Falsche Betriebsmittelauswahl
5.1.6 Unzureichende Sicherheitsabstände wärmeabstrahlender Betriebsmittel
5.2 Maßgebliche Brandentwicklung und -ausbreitung durch elektrische Anlagen
5.3 Ausfall des Funktionserhalts baurechtlich geforderter sicherheitstechnischer Einrichtungen
6 Zusammenfassung und Ausblick
Formelzeichen, Indizes, Einheiten
Literatur- und Quellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Brandschutzmaßnahmen
Abb. 2: Feuerdreieck
Abb. 3: Darstellung des typischen Brandverlaufs
Abb. 4: Einheitstemperaturkurve nach DIN 4102
Abb. 5: Hierarchie technischer Regeln
Abb. 6: Rechtsgrundlagen für den Brandschutz elektrischer Anlagen in Deutschland
Abb. 7: Anzahl der Brandopfer
Abb. 8: Brandausbreitung bei Gebäudebränden
Abb. 9: Unterteilung der Brandobjekte
Abb. 10: Sterbealter der Brandopfer
Abb. 11: Ermittelte Brandursachen 2006-2010
Abb. 12: Vereinfachtes Ersatzschaltbild einer Mantelleitung
Abb. 13: Ersatzschaltbild des Fehlerstromkreises
Abb. 14: Auslösekennlinie Leitungsschutzschalter Typ B
Abb. 15: Wirkprinzip des Fehlerstromschutzschalters (RCD)
Abb. 16: Temperaturerhöhung an einer Sicherung durch schlechte Kontaktierung
Abb. 17: Neutralleiterunterbrechung
Abb. 18: Neutralleiterbelastung
Abb. 19: Beschädigtes Brandschott
Abb. 20: Fehlende Zugentlastung
Abb. 21: Unsachgemäße Funktionserhaltverlegung
Abb. 22: Ordnungsgemäße Funktionserhaltverlegung
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Übersicht über Flammpunkte und Zündtemperaturen ausgewählter Stoffe
Tab. 2: Abbrandgeschwindigkeiten und Heizwerte ausgewählter Stoffe
Tab. 3: Brandgase und Ausgangsstoffe
Tab. 4: Sauerstoffmangelerkrankungen
Tab. 5: Brandopfer in Abhängigkeit vom Gebäudetyp
Tab. 6: Anzahl der Feuerwehreinsätze bei Bränden und Explosionen 2004-2008
Tab. 7: Versicherungsschäden durch Brände
Tab. 8: Ermittelte Brandursachen des IFS
Tab. 9: Häufigkeit von Mängeln bei Prüfungen nach SK 3602
Tab. 10: IP-Schutzarten 74
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Über den Autor
Ulrich von Hehl, geboren 1982, nach Abitur und Wehrdienst zunächst Ausbildung im Elektroinstallateurhandwerk und berufliche Tätigkeit als Bauleiter in München, anschließend berufsbegleitendes Diplom-Studium der Elektrotechnik an der Wilhelm Büchner Hochschule in Darmstadt und Erlangung des Meistertitels im Elektrohandwerk an den Meisterschulen München, Auszeichnung mit dem Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung, seit 2007 Projektingenieur bei einem Münchner Ingenieurbüro für Gebäudetechnik, freiberufliche Tätigkeit als Sachverständiger und Autor von Fachbüchern und -beiträgen, weiterbildende Studien im Bauingenieurwesen an der technischen Universität Dresden, seit 2012 Master-Studium an der Technischen Universität Kaiserslautern (baulicher Brandschutz und Sicherheitstechnik)
Einleitung
In den letzten zehn Jahren starben in Deutschland durchschnittlich 485 Menschen jährlich in Gebäuden an den Folgen eines Brandes und dessen zerstörerischen Folgen. Alleine die direkt zuordenbaren Versicherungsschäden, die durch Brände verursacht wurden, betragen jährlich nahezu 2,8 Milliarden Euro, die Folgeschäden der Betroffenen übersteigen diese Summe häufig noch um ein Vielfaches. Obwohl durch die stetige Aktualisierung der Bauvorschriften und der bei der Errichtung anzuwendenden Regeln der Technik der Brandschutz immer detaillierter in den Vordergrund tritt, muß, bedingt durch die ungebremste Zunahme von elektrischen Einrichtungen und damit des Energiebedarfs innerhalb der Gebäude, die Elektrizität nach wie vor als eine der häufigsten Brandursachen genannt werden. Fehler und Defekte in elektrischen Anlagen sind aber oftmals nicht nur Auslöser eines verheerenden Brandes, sondern tragen auch zur Weiterleitung des Feuers und zur Einschränkung der Fluchtmöglichkeiten bei.
Das vorliegende Werk, das einen überarbeiteten Ausschnitt meiner an der Wilhelm Büchner Hochschule verfaßten Diplomarbeit wiedergibt, soll die von Gesetzgeber, Normengremien und Versicherern auferlegten Umsetzungsvorschriften für die Brandschutzsicherheit von elektrischen Anlagen in Gebäuden beschreiben, die Ursachen und Folgen der entstandenen Brände anhand von Statistiken analysieren und konkrete Gefahrenquellen in elektrischen Anlage darstellen. Die Themenfindung beruht auf meiner beruflichen Tätigkeit bei der IBF Ingenieurgesellschaft mbH in München. Die Betätigungsfelder des Unternehmens liegen in der technischen und wirtschaftlichen Beratung von Bauherren und Investoren zu allen Fragen der technischen Gebäudeausrüstung, der Begutachtung und Bewertung und ebenso der Fachplanung und Projektierung aller technischen Anlagen sowie dem Projektmanagement. Einen hohen Stellenwert bei meiner Tätigkeit in diesem Unternehmen hat die technische Objektüberwachung und Qualitätssicherung bei Bauvorhaben aller Art sowie die Durchführung von Anlagenbegutachtungen und -bewertungen. Die dabei häufig feststellbaren Mängel an elektrischen Anlagen gaben mir den Anlass, das Thema Brandschutz und Anlagensicherheit auch in den Mittelpunkt meiner Studienabschlussarbeit zu legen.
Zu Beginn dieser Arbeit werden in Kap. 1 die Begrifflichkeiten des Brandschutzes beschrieben und in Kap. 2 durch Auswertung von gängiger Fachliteratur die wissenschaftlichen Hintergründe des Feuers und seiner schädigenden Auswirkungen dargestellt. Danach folgt in Kap. 3 eine Übersicht über die rechtlichen und normativen Grundlagen des Brandschutzes und eine Erläuterung der komplexen Zusammenhänge zwischen Gesetzen und technischen Normen. In Kap. 4 werden Statistiken von Behörden, Versicherungen, wissenschaftlichen Instituten, Feuerwehrverbänden und Sachverständigenkreisen ausgewertet und Schlussfolgerungen für die Bedeutung von sicheren Elektroanlagen für den Brandschutz in unserer Gesellschaft gezogen. Eine detaillierte Darstellung von speziellen Gefahrenquellen, die durch elektrische Anlagen ausgehen, wird durch Analyse von einschlägigen Normen, Publikationen von Sachverständigen und anhand eigener Erfahrungen in Kap. 5 durchgeführt.
Ulrich von Hehl
Unterhaching, November 2012
1 Brandschutz
Der Begriff Brandschutz steht für alle Maßnahmen, die zur Vermeidung von Bränden und zur Minimierung von Brandschäden führen, also sowohl für den vorbeugenden Brandschutz als auch den abwehrenden Brandschutz. Unter vorbeugendem Brandschutz sind alle - vor allem bauliche und technische - Maßnahmen zusammengefasst, die getroffen werden, um einen Brandausbruch zu verhindern, die Brandausbreitung einzuschränken und Brandschäden zu begrenzen. Auch die Installation stationärer Löscheinrichtungen wie Sprinkleranlagen und die Sicherstellung der Feuerwehrangriffswege durch rauchfreie Flure und Treppenhäuser mit auch im Brandfall funktionstüchtiger Beleuchtung gehört zu den Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes, dessen grundlegende Bestandteile in
Abb. 1 dargestellt sind. Im Hinblick auf elektrotechnische Belange sind auch Untersuchungen der elektrischen Brandursachen und technische Maßnahmen zur Minimierung der Risiken Bestandteile des vorbeugenden Brandschutzes. Demzufolge beschreibt der abwehrende Brandschutz konkrete Brandbekämpfungsmaßnahmen durch öffentliche und Werks-Feuerwehren, die damit verbundenen Einsatzpläne und das Löschwesen an sich.
Alle Brandschutzmaßnahmen verfolgen die Schutzziele des Personenschutzes (Schutz von Leben und Gesundheit von Personen im jeweiligen Gebäude und in dessen Umgebung) und des Sachwertschutzes (Schutz von Eigentum und Begrenzung finanzieller Schäden).[1]
In dieser Arbeit sollen vor allem die in den Bereich der elektrischen Gebäudetechnik fallenden Maßnahmen zur Brandvermeidung, Branderkennung und Verhinderung der Brandausbreitung untersucht werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Brandschutzmaßnahmen
2 Der Brand und seine Auswirkungen
Die Bekämpfung und vor allem die Verhütung schadensträchtiger Brände ist nur möglich, wenn die dafür notwendige Kenntnis über das Feuer, seine Entstehung, die Ausbreitung und vor allem der davon ausgehenden Gefahren vorhanden sind. In diesem ersten Kapitel sollen daher die wichtigsten wissenschaftlichen Hintergründe des Feuers, dessen physiologische Auswirkungen auf den Menschen und die mit Bränden einhergehenden wirtschaftlichen Schäden dargestellt werden.
2.1 Das Wesen des Feuers
Feuer ist dem Menschen seit jeher Freund und Fluch zugleich. Kontrollierte Feuer spenden Licht und Wärme, bieten Schutz und können als Hilfsmittel bei verschiedenen Tätigkeiten genutzt werden. Die Entwicklung der Menschheit wurde maßgeblich durch das Zunutzemachen des Feuers bestimmt.
Und doch es ist ein Irrglaube zu meinen, der Mensch hätte das Feuer gebändigt. Jede noch so kleine Unachtsamkeit muß unter Umständen bitter bezahlt werden. Wie schon der griechische Philosoph Empedokles von Akragas (495-435 v. Chr.) feststellte, ist es daher um so wichtiger, das Feuer zu kennen und zu verstehen, um es bekämpfen und beherrschen zu können.[2]
Detaillierte Kenntnisse über die Voraussetzungen für die Entstehung und das Weiterbestehen eines Feuers und den Brandverlauf sind nicht nur für die Feuerwehreinsatzkräfte von enormer Bedeutung, sondern ebenso für die Planer des vorbeugenden Brandschutzes, also Architekten und Fachingenieure.
2.2
Entstehen des Feuers und Brandverlauf
Zum Entfachen eines Feuers müssen die im nachfolgenden Feuerdreieck dargestellten Voraussetzungen erfüllt sein.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Feuerdreieck
Für die Erwärmung eines Brennstoffs, der unter bestimmten Bedingungen brennt, ist (Wärme)-Energie erforderlich. Wenn der Brennstoff durch die äußere Energiezufuhr eine bestimmte, von der Art des Stoffes abhängige Oberflächentemperatur erreicht hat, beginnt er zu brennen, vorausgesetzt, es ist in der Umgebungsluft ausreichend Sauerstoff vorhanden. Dabei unterscheidet man zwischen Flammpunkt und der Zündtemperatur eines Stoffes. Als Flammpunkt bezeichnet man die niedrigste Temperatur, bei der sich brennbare Dämpfe entwickeln, die durch eine äußere Zündquelle (z. B. Funken) gezündet werden können. Unter der Zündtemperatur versteht man die Temperatur, bei der sich ein brennbarer Stoff ohne äußere Zündung von selbst entzündet.[3] Die Flammpunkte und Zündtemperaturen einiger ausgewählter Stoffe sind in Tab. 1 dargestellt.[4]
Tab. 1: Übersicht über Flammpunkte und Zündtemperaturen ausgewählter Stoffe
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Feuer ist eine chemische Reaktion des Sauerstoffs mit dem aufgeheizten Brennstoff. Nach dem Zündvorgang produziert das Feuer durch den chemischen Verbrennungsvorgang selber Wärme und erhitzt damit den umliegenden Brennstoff weiter. Erreicht dieser wieder seine Zündtemperatur, schlägt das Feuer auf benachbarte Flächen um. Unter der Voraussetzung, daß genügend Sauerstoff und Brennstoff zur Verfügung stehen, erhält sich das Feuer also von selbst.
Gemäß DIN EN ISO 13943 ist ein Brand definiert als „unkontrollierte, selbstständige Verbrennung, die nicht absichtlich in Gang gesetzt worden (…) und (…) in Bezug auf die Dauer und Ausdehnung nicht begrenzt ist.“ Im Gegensatz dazu werden bei einem bestimmungsgemäß entstandenen Feuer die Reaktionsprodukte Licht und Wärme nicht als zerstörerische Abfallprodukte angesehen, sondern bewusst herbeigeführt.
Der innerhalb eines definierten Gebäudeabschnittes verfügbare Brennstoff wird auch Brandlast genannt. Unter Brandlast wird nach v. g. Norm „die Summe der Wärmeenergie, die bei Verbrennung aller brennbaren Stoffe in einem Gebäudebereich einschließlich der Bekleidungen von Wänden, Decken und Fußboden sowie aller brennbaren Gebäudeinhalte wie z. B. Arbeitsmittel frei werden könnte“, verstanden.
Die zuvor erwähnte Wärmeproduktion durch den Verbrennungsvorgang leitet sich aus der Stabilität brennbarer Stoffe her. Die Mehrzahl der organischen Stoffe ist ab einer Temperatur von 400 °C chemisch nicht mehr stabil. Der Umwandlungs- und Zersetzungsprozess dieser Stoffe setzt ein, wenn sie in einen Temperaturbereich gehoben werden, der größer ist als das Niveau, in dem sie gebildet wurden. In diesem Zustand setzt nun der Abbauprozess des Stoffes ein, bei dem die bei der Bildung des Stoffes einst benötigte Energie in Form von Reaktionswärme wieder abgegeben wird. In diesem Zusammenhang spricht man auch von einer exothermen Reaktion. Mit zunehmender Temperatur zerfallen die Stoffmoleküle in reaktionsfreudige Radikale. Ein Verbrennungsvorgang ist also eine immer weiter beschleunigte chemische Reaktion, in der hochwertige Substanzen durch Oxidation und Energieabgabe in Form von Wärme und Licht in ihre Ausgangsstoffe zurückgebildet werden.[5]
Schadenverursachende Brände in Gebäuden sind überwiegend mit dem Abbrand brennbarer Feststoffe verbunden. Die meisten festen Brennstoffe pyrolisieren brennbare Gase im Temperaturbereich von 400-1.000 °C. Unter Pyrolyse versteht man die „Zersetzung bzw. Entgasung von festen, flüssigen oder gasförmigen, brennbaren Stoffen bei hohen Temperaturen“.[6]
Bei der Pyrolysephase werden Stoffe durch äußere Wärmeeinwirkung erhitzt und beginnen sich zu zersetzen, wobei bereits kleinste Partikel mit einigen Nanometern Durchmesser (Aerosole) freigesetzt werden. Eine offene Flamme liegt in diesem Zustand noch nicht vor.[7] Ist der Flammpunkt dieser Gase erreicht, die Sauerstoffkonzentration ausreichend hoch und existiert eine Zündquelle, die stark genug ist, diese zu zünden, so wird der Verbrennungsprozess eingeleitet. Liegt keine ausreichende Zündquelle vor, so wird der (Fest-)Stoff weiter aufgeheizt.
Auf die Pyrolysephase (Zündphase) folgt nach dem Glimmen und zunehmender Rauchentwicklung die Schwelbrandphase, bei der ohne offene Flamme ein langsames Verbrennen unter Sauerstoffmangel erfolgt. Immer mehr Gase werden freigesetzt, und der Stoff erwärmt sich weiter, bis sein Zündpunkt erreicht ist, ab dem eine Selbstzündung auftritt.
In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß Flammen grundsätzlich nur bei der Verbrennung von Gasen und Dämpfen entstehen. Feststoffe verbrennen mit Glut, können aber durch Pyrolyse brennbare Gase freisetzen, deren Zündung für die charakteristische Flamme verantwortlich ist. In der auf die Schwelbrandphase folgenden Erwärmungsphase werden in näherer Umgebung befindliche Brennstoffe durch direkte Berührung mit dem brennbaren Stoff, durch Kontakt mit der konvektiven heißen Luft oder durch Wärmestrahlung ebenfalls weiter erhitzt. Insbesondere naheliegende Stoffe gehen unmittelbar in den Verbrennungsprozess über. Durch die immer weitere Erhöhung der durch die Brandausbreitung abgegebenen Wärmeenergie und dem quadratischen Anstieg der Wärmestrahlung bei zunehmender Temperatur können sich auch einige Meter vom Brandherd entfernte Stoffe so weit aufheizen, daß deren Zündung erfolgt.
Gehen alle im Raum befindlichen, brennbaren Materialien in den Verbrennungsprozess mit ein, spricht man vom s. g. flash-over.
Liegt im Brandraum Sauerstoffmangel vor, der den Brennvorgang behindert und wurden zuvor alle Brandlasten thermisch ausreichend aufbereitet, kann durch den back- draft insbesondere für Feuerwehreinsatzkräfte eine ernstzunehmende Bedrohung entstehen, weil durch das Öffnen einer Türe oder eines Fensters und den damit verbundenen Sauerstoffeintrag eine explosionsartige Zündung des gesamten Rauminhaltes erfolgen kann.
Die Raumtemperaturen steigen durch die fortschreitende Verbrennung auf eine Maximaltemperatur von ca. 1.000-1.200 °C. Die Verringerung des Brennstoffs durch die stoffliche Zersetzung ist Grund für die schließlich einsetzende Abkühlphase, die solange anhält, bis das gesamte Brennmaterial verbrannt ist, durch Löschmaßnahmen eine Abkühlung eingeleitet oder durch Sauerstoffentzug das Oxidationsmittel entzogen wurde. Insbesondere bei der Sauerstoffzufuhr ist jedoch zu beachten, daß Brände zwar durch Sauerstoffmangel von allein in die Schwelbrandphase zurückgeführt werden können, jedoch ohne weiteres bei erneuter Sauerstoffzufuhr den o. g. back-draft auslösen können, wenn die Menge des Restbrennstoffes und dessen Temperatur entsprechend groß sind.[8]
Der Brandverlauf selber ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Neben Art, Menge und Anordnung der Brandlasten, der Menge des in der Luft zugeführten Sauerstoffs, des durch die Raumgeometrie bestimmten Wärmeverlustes oder der Wärmeaufnahmekapazität angrenzender Bauteile bestimmt maßgeblich der Heizwert der einzelnen Brandlasten die Brandausbreitungsgeschwindigkeit. Unter dem Heizwert versteht man die Wärmemenge, die bei der vollständigen Verbrennung eines brennbaren Stoffes bei konstantem Druck freigesetzt wird. Die Geschwindigkeit, in der ein Material seinen Heizwert freisetzen kann, wird durch die Abbrandgeschwindigkeit des Stoffes bestimmt.[9] Eine Übersicht über Abbrandgeschwindigkeiten und Heizwerte gibt die nachstehende Tab. 2.[10]
Tab. 2: Abbrandgeschwindigkeiten und Heizwerte ausgewählter Stoffe
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Unterbrechung der Verbrennungsfunktion, umgangssprachlich auch als „Löschen“ bekannt, erfolgt durch das Aufbrechen des Feuerdreiecks. Fehlt eine der dort dargestellten Komponenten, so ist ein Fortbestehen des Feuers nicht möglich.
Die typischen Phasen des Brandverlaufes bei Feststoffen sind in der folgenden Abb. 3 dargestellt.[11]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3: Darstellung des typischen Brandverlaufs
Die in der nachstehenden Abb. 4 dargestellte Einheitstemperaturkurve nach DIN 4102 charakterisiert die im Zeitverlauf zu erwartende Temperaturentwicklung eines Brandes, die auch als Grundlage für die Prüfung des Brandverhaltens und die Zertifizierung der Feuerwiderstandsdauer von Baustoffen Anwendung findet.[12]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 4: Einheitstemperaturkurve nach DIN 4102
Sowohl Abb. 3 als auch Abb. 4 verdeutlichen sehr anschaulich, daß der Zeit eine herausragende Rolle bei der Brandbekämpfung und der Verhinderung der Brandausbreitung zukommt.
2.3 Physiologische Wirkungen des Feuers auf den Menschen
Verbrennungen der Haut des menschlichen Körpers können bereits bei langer Einwirkdauer relativ niedriger Temperaturen (ca. 35 °C) ausgelöst werden. Ab einer Temperatur von ca. 50 °C sind Verbrennungen der Haut mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten. Angesichts der hohen, in Abb. 4 dargestellten Brandtemperaturen sind bei Annäherung des Menschen an den Gefahrenbereich Verbrennungen innerhalb kürzester Zeit möglich. Ab einer Hautverbrennungsfläche von 10 % bei Kleinkindern und 15 % bei Erwachsenen können Störungen der Vitalfunktionen durch einen Verbrennungsschock ausgelöst werden. Unter Verbrennungsschock versteht man ein globales komplexes Kreislaufversagen, das durch den Plasmaverlust infolge gestörter Permeabilität von Zellmembranen und Gefäßwänden hervorgerufen wird.[13]
Neben den enormen Brandtemperaturen, die beim Menschen schwerste Verbrennungen mit Todesfolge hervorrufen können, ist insbesondere die mit dem Brand verbundene Rauchentwicklung die größte Gefahr, die von einem Feuer ausgeht.
Die überwiegende Mehrzahl der Brandopfer stirbt nicht an direkter Flammeneinwirkung oder Verbrennungen, sondern durch den Kontakt mit toxischen Rauchgasen, die als Zersetzungsprodukte beim Abbrand freigesetzt werden. Der Anteil der Brandopfer, die durch Rauchvergiftungen ums Leben gekommen sind, wird in der gängigen Literatur auf ca. 95 % geschätzt.
Die Zusammensetzung des Brandrauchs ist von der Art des Brennstoffs und den Brandbedingungen abhängig. Die toxische Gesamtwirkung des Brandrauchs ist bisher noch nicht vollständig geklärt, jedoch sind vor allem die toxischen Eigenschaften von Kohlenstoffmonoxid (CO) und Kohlenstoffdioxid (CO2) in Verbindung mit dem durch den Brand ausgelösten Sauerstoffmangel für die Vergiftungserscheinungen beim Menschen verantwortlich.[14]
Typische Bestandteile des Brandrauchs, ihre Ausgangsstoffe und typische Vergiftungssymptome sind in Tab. 3 zusammengefasst:[15]
[...]
[1] Vgl. U. Schneider, M. Franssen, C. Lebeda: Baulicher Brandschutz, 2., aktualisierte und erweiterte Auflage, Bauwerk Verlag, Berlin, 2008, S. 26.
[2] Vgl. A. Merschbacher: Brandschutz: Praxishandbuch für die Planung, Ausführung und Überwachung, 1. Auflage, Verlagsgesellschaft Rudolf Müller, Köln, 2006, S. 11.
[3] Vgl. H.-D. Fröse: Brandschutz für Kabel und Leitungen, 2., völlig neu bearbeitete Auflage, Hüthig & Pflaum Verlag, München/Heidelberg, 2005, S. 12.
[4] Quellen: H.-D. Steinleitner, E. Achilles: Brandschutz- und sicherheitstechnische Kennwerte gefährlicher Stoffe, Band 1, Staatsverlag der DDR, Berlin 1988, S. 13; J. Mayr, L. Battran: Handbuch Brandschutzatlas: Baulicher Brandschutz, 2. Auflage, Feuertrutz Verlag, Köln, 2011, S. 182-183; A. Merschbacher: Brandschutz: Praxishandbuch für die Planung, Ausführung und Überwachung, 1. Auflage, Verlagsgesellschaft Rudolf Müller, Köln, 2006, S. 13.
[5] Vgl. S. Bussenius: Wissenschaftliche Grundlagen des Brand- und Explosionsschutzes, Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1996, S. 22.
[6] H. Portz: Brand- und Explosionsschutz von A-Z: Begriffserläuterungen und brandschutztechnische Kennwerte, 1. Auflage, Vieweg & Sohn Verlag, Wiesbaden, 2005, S. 139.
[7] Vgl. G. Gerber: Brandmeldeanlagen: Planen, Errichten, Betreiben, 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Hüthig & Pflaum Verlag, München/Heidelberg, 2009, S. 14.
[8] Vgl. H.-D. Fröse: Brandschutz für Kabel und Leitungen, 2., völlig neu bearbeitete Auflage, Hüthig & Pflaum Verlag, München/Heidelberg, 2005, S. 14.
[9] Vgl. S. Bussenius: Wissenschaftliche Grundlagen des Brand- und Explosionsschutzes, Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1996; S. 155.
[10] Quelle: Ebenda S. 83-84.
[11] Quelle: H.-D. Fröse: Brandschutz für Kabel und Leitungen. 2., völlig neu bearbeitete Auflage, Hüthig & Pflaum Verlag, München/Heidelberg, 2005, S. 13.
[12] Quelle: DIN 4102-02:1977-09: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, Teil 2: Bauteile, Be- griffe, Anforderungen und Prüfungen.
[13] Vgl. Roche Lexikon Medizin, 4., neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Urban & Fischer Verlag, München/Jena, 1998; S. 1750.
[14] Vgl. Pleß, Georg; Seliger, Ursula: Entwicklung von Kohlenmonoxid bei Bränden in Räumen, Teil 1, Forschungsbericht Nr. 145 des Arbeitskreises V - Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten, Katastrophenschutz und zivile Verteidigung - der Ständigen Konferenz der Innenminister und Senatoren der Länder, Heyrothsberge, 2007, S. 8.
[15] Quellen: Bussenius, Siegfried: Wissenschaftliche Grundlagen des Brand- und Explosionsschutzes, Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1996, S. 11, Daunderer, Max: Klinische Toxikologie – 143. Erg.-Lfg., ecomed Verlag, Landsberg/Lech, 2000, S. 1-2.
- Arbeit zitieren
- Ulrich von Hehl (Autor:in), 2012, Brandschutz in elektrischen Anlagen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/204215