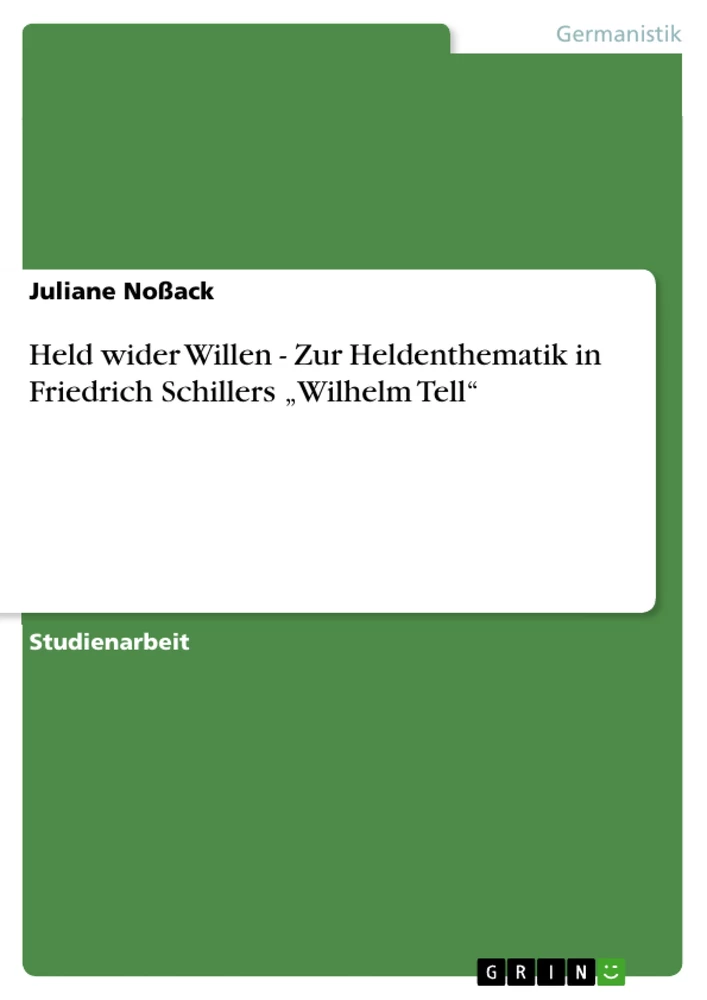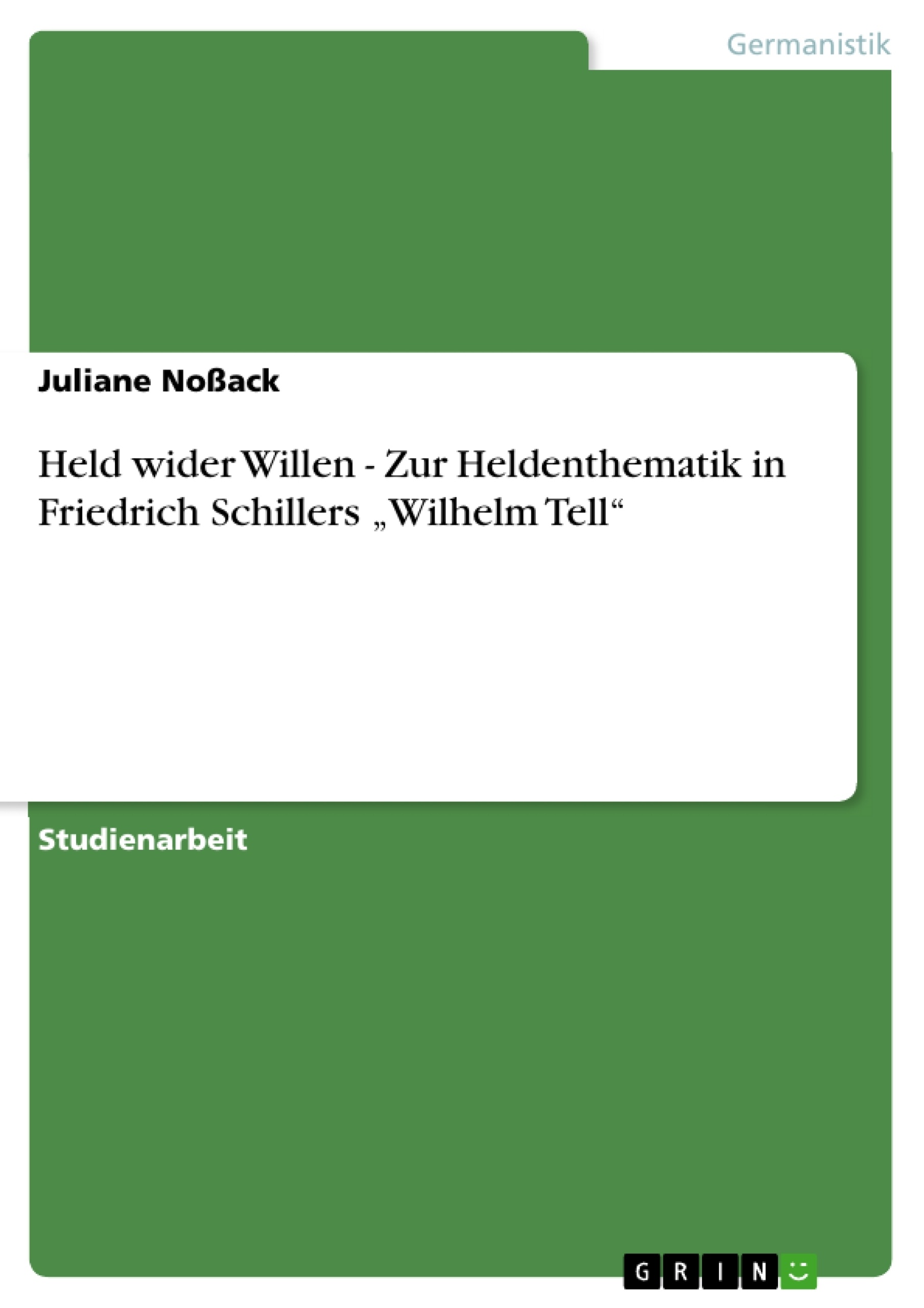„Das Werck ist fürtrefflich gerathen, und hat mir einen schönen Abend verschafft.“ Mit diesen Worten beurteilt Goethe nach erstmaligem Lesen das Manuskript, das Friedrich Schiller ihm kurz zuvor zugesandt hatte. Die Rede ist hier von Schillers Drama Wilhelm Tell, veröffentlicht 1804, im selben Jahr in Weimar uraufgeführt. Das letzte fertiggestellte Drama Friedrich Schillers steht am Ende der Reihe seiner fünf klassischen Dramen, zu denen, neben Wilhelm Tell, die Wallenstein-Trilogie (1799), Maria Stuart (1801), Die Jungfrau von Orleans (1801) und Die Braut von Messina (1803) gehören. Dabei kann Wilhelm Tell thematisch sehr gut in das Werkganze, und besonders in die klassischen Dramen des Autors, eingeordnet werden und steht somit repräsentativ für dieses: „Die wichtigste inhaltliche Gemeinsamkeit [der oben genannten fünf Werke] […] besteht in der durchgängig verhandelten Frage nach den Konstellationen der Macht und insbesondere nach der Legitimität von Herrschaft.“ Rein formal betrachtet bildet wohl in der Reihe der Dramen Schillers jedes für sich eine Singularität. Somit weicht auch Wilhelm Tell von der Gattungstradition ab: „Von der Dramenform her unterscheiden sie sich gerade zu extrem: […] das opernhafte, mit Kulissenbildern hintermalte und Musikeinlagen angereicherte Wilhelm Tell (1804) divergieren so stark, dass zurecht von einer Reihe radikaler Formexperimente gesprochen wird.“ Gerade deshalb ist das Gesamtwerk Schillers auch heute noch immer so interessant und facettenreich. Wilhelm Tell sticht dabei durch seine Massenszenen und ausführlichen Regieanweisungen, die oftmals auch „den Einsatz von Musikinstrumenten und Gesangsstimmen“ fordern, als „[theatralisches] Gesamtkunstwerk“ heraus. Außerdem zeigt sich die Vielfältigkeit und Komplexität dieses Stückes in den drei vorhandenen Handlungssträngen des Dramas, die das gesamte Werk thematisch gesehen besonders hervorheben: „So lassen sich mit der Tell-Handlung, der Rütli-Handlung und der Berta-Rudenz-Handlung zugleich verschiedene Dimensionen des Textes voneinander unterscheiden, die gleichwohl alle um die Frage nach der Freiheit kreisen; Wilhelm Tell ist ein Freiheitsdrama par excellence.“ Die Frage, die ich nun an den Gegenstand Wilhelm Tell herantrage, ist, in wieweit sich Tell als Held innerhalb dieses Dramas hervortut und ob er überhaupt als ein solcher bezeichnet werden kann. Diese Fragestellung ist von Relevanz, da der Rezipient des Werkes von Grund her davon ausgeht [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Heldenbegriff zu Zeiten Schillers
- Tell als Held des Dramas - Handlungsdarstellung, Figurenrede und Charakterisierung
- Tells (Helden-)Taten
- Tell rettet Baumgarten
- Die Apfelschuss-Szene
- Die Ermordung Gesslers
- Verschiedene Sichtweisen bezüglich Tells Heldentum
- Tells (Helden-)Taten
- Schluss und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Heldenthematik in Friedrich Schillers „Wilhelm Tell“. Die zentrale Frage ist, inwieweit Wilhelm Tell als Held des Dramas betrachtet werden kann, berücksichtigt man sowohl seine eigenen Handlungen als auch die Perspektiven anderer Figuren. Die Arbeit analysiert, ob der oberflächliche Eindruck Tells als Held durch eine genauere Textanalyse bestätigt wird.
- Der Wandel des Heldenbegriffs im 18. Jahrhundert
- Analyse von Tells Taten (Rettung Baumgartens, Apfelschuss, Mord an Gessler)
- Untersuchung der unterschiedlichen Sichtweisen auf Tell und sein Heldentum
- Konflikt zwischen Tells Selbstwahrnehmung und seiner Darstellung als Held
- Die Rolle von Handlung, Figurenrede und impliziter Charakterisierung in der Darstellung Tells
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Heldendarstellung in Schillers „Wilhelm Tell“ ein. Sie verortet das Drama im Kontext von Schillers Gesamtwerk und hebt die Besonderheiten des Stücks hervor, insbesondere die Frage nach der Legitimität von Herrschaft und die Darstellung der Freiheit. Die Arbeit stellt die zentrale Forschungsfrage nach Tells Heldentum und formuliert die These, dass Tell zwar als Held präsentiert wird, sich selbst aber nicht als solchen wahrnimmt. Die Methodik der Arbeit wird skizziert, welche die Analyse von Tells Taten und die Betrachtung verschiedener Perspektiven umfasst.
Der Heldenbegriff zu Zeiten Schillers: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Heldenbegriffs im 18. Jahrhundert. Es zeigt den Wandel vom kraftvollen Einzelkämpfer hin zum idealtypischen Vorbild, der Tugenden verkörpert und Verantwortung für die Gemeinschaft übernimmt. Der Text untersucht, wie diese zeitgenössische Vorstellung des Helden mit der Darstellung Tells in Einklang steht oder im Konflikt gerät. Dieser Abschnitt liefert den analytischen Rahmen für die spätere Untersuchung Tells.
Tell als Held des Dramas - Handlungsdarstellung, Figurenrede und Charakterisierung: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung Tells als Held im Drama. Es untersucht Tells drei Haupttaten – die Rettung Baumgartens, den Apfelschuss und die Ermordung Gesslers – und beleuchtet, inwieweit diese als Heldentaten interpretiert werden können und welche Widersprüche sich in Tells Charakter und Handlungsweise offenbaren. Die Analyse berücksichtigt sowohl die explizite als auch die implizite Charakterisierung Tells, wobei der Fokus auf der impliziten Charakterisierung liegt, die aus seinen Taten abgeleitet werden kann. Die unterschiedlichen Perspektiven der Figuren auf Tell und sein Handeln werden ebenfalls berücksichtigt.
Schlüsselwörter
Wilhelm Tell, Friedrich Schiller, Held, Heldenthematik, Freiheit, Macht, Legitimität, Charakterisierung, Handlung, Figurenrede, Apfelschuss, Widerstand, Gemeinschaft, Selbstwahrnehmung.
Häufig gestellte Fragen zu Friedrich Schillers "Wilhelm Tell" - Heldendarstellung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Heldendarstellung Wilhelm Tells in Friedrich Schillers gleichnamigem Drama. Im Zentrum steht die Frage, inwieweit Tell als Held des Dramas betrachtet werden kann, unter Berücksichtigung seiner Handlungen und der Perspektiven anderer Figuren. Die Arbeit untersucht, ob der oberflächliche Eindruck von Tell als Held durch eine detaillierte Textanalyse bestätigt wird.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Wandel des Heldenbegriffs im 18. Jahrhundert, analysiert Tells Taten (Rettung Baumgartens, Apfelschuss, Mord an Gessler) und untersucht die unterschiedlichen Sichtweisen auf Tell und sein Heldentum. Weiterhin wird der Konflikt zwischen Tells Selbstwahrnehmung und seiner Darstellung als Held beleuchtet, sowie die Rolle von Handlung, Figurenrede und impliziter Charakterisierung in der Darstellung Tells.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Heldenbegriff im 18. Jahrhundert, ein zentrales Kapitel zur Analyse Tells als Held (mit Unterkapiteln zu seinen Taten und verschiedenen Perspektiven) und einen Schluss mit Ausblick. Die Einleitung führt in die Thematik ein und skizziert die Methodik. Das Kapitel zum Heldenbegriff liefert den analytischen Rahmen. Das zentrale Kapitel analysiert Tells Handlungen und die verschiedenen Perspektiven auf ihn. Der Schluss fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick.
Wie wird Tell als Held dargestellt?
Die Arbeit untersucht, ob und wie Tells Handlungen (Rettung Baumgartens, Apfelschuss, Ermordung Gesslers) als Heldentaten interpretiert werden können. Dabei werden sowohl explizite als auch implizite Charakterisierungen Tells berücksichtigt, insbesondere die aus seinen Taten abgeleitete implizite Charakterisierung. Die Arbeit analysiert Widersprüche in Tells Charakter und Handlungsweise und berücksichtigt die verschiedenen Perspektiven der Figuren auf Tell und sein Handeln.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine textanalytische Methode, die die Analyse von Tells Taten und die Betrachtung verschiedener Perspektiven auf sein Handeln umfasst. Explizite und implizite Charakterisierungen werden analysiert, um ein umfassendes Bild von Tells Rolle und seiner Darstellung als Held zu gewinnen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wilhelm Tell, Friedrich Schiller, Held, Heldenthematik, Freiheit, Macht, Legitimität, Charakterisierung, Handlung, Figurenrede, Apfelschuss, Widerstand, Gemeinschaft, Selbstwahrnehmung.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage ist, inwieweit Wilhelm Tell als Held des Dramas betrachtet werden kann.
Welche These wird aufgestellt?
Die Arbeit stellt die These auf, dass Tell zwar als Held präsentiert wird, sich selbst aber nicht als solchen wahrnimmt.
- Quote paper
- Juliane Noßack (Author), 2011, Held wider Willen - Zur Heldenthematik in Friedrich Schillers „Wilhelm Tell“, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/204150