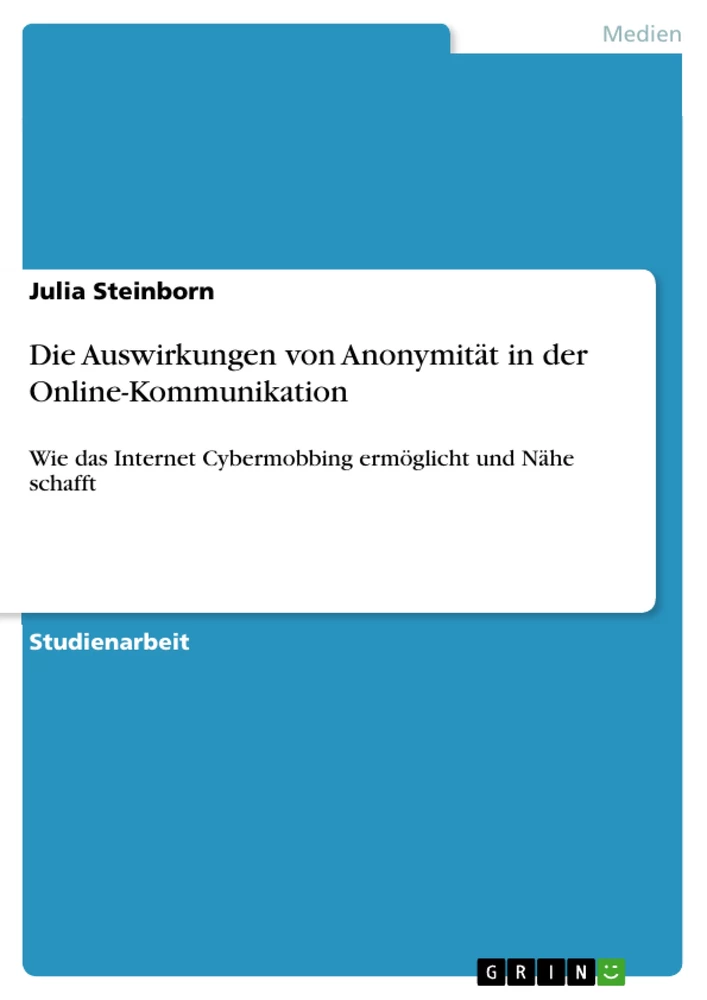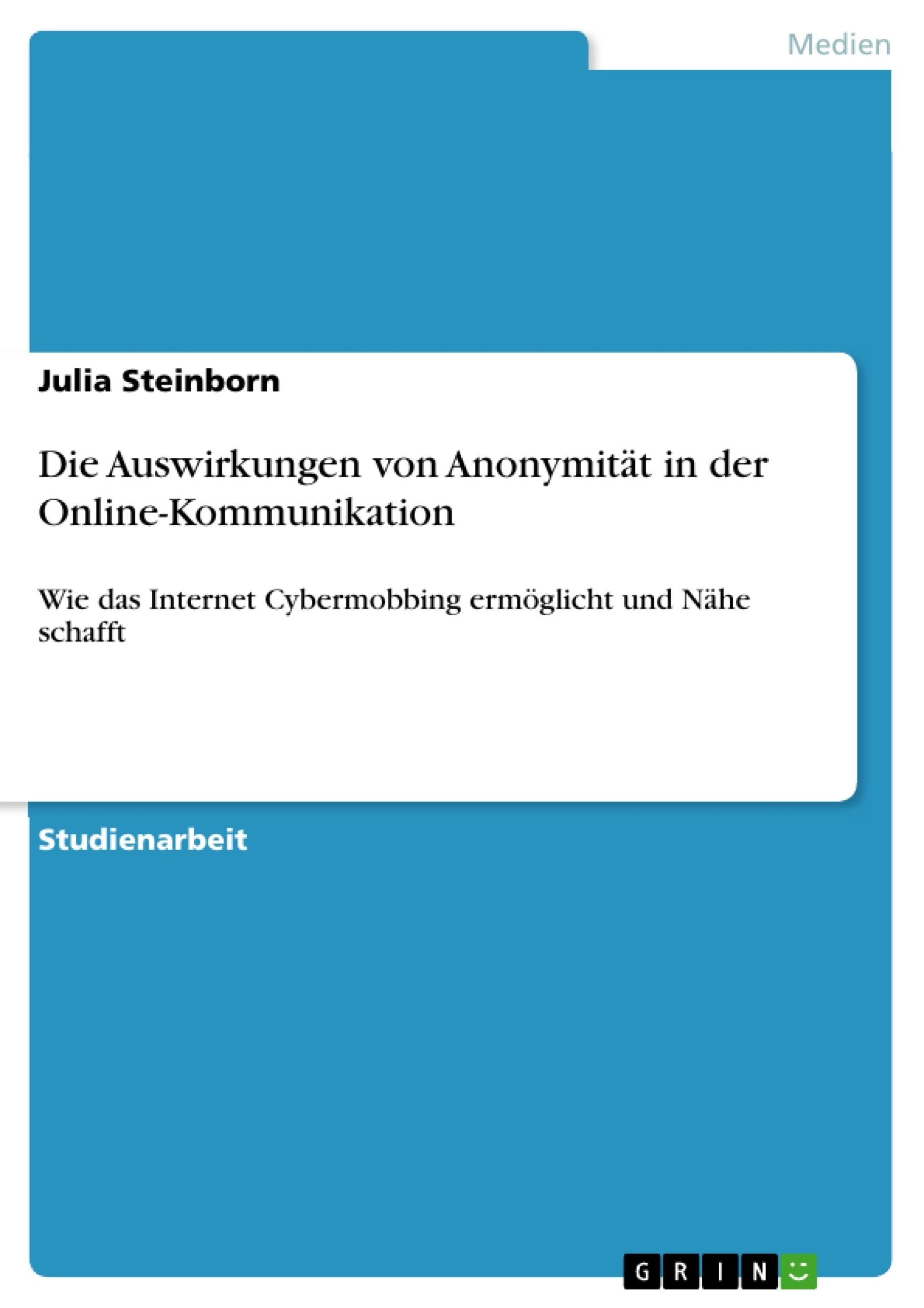1 Einleitung
2 Kommunikation im Internet
2.1 Sprachliche Besonderheiten
2.2 Theoretische Modelle
2.2.1 Kanal-Reduktions-Modell
2.2.2 Social Information Processing Theory
2.2.3 Reduced Social Context Cues Theory
3 Anonymität im Internet
3.1 Positive Auswirkungen
3.2 Negative Auswirkungen
4 Cybermobbing
5 Fallbeispiel: Nana Davis
5.1 Untersuchungsgegenstand
5.2 MrMooMooChocolate und die Anonymität
5.3 Sprachliche Merkmale
6 Schlusswort
7 Anhang
7.1 Abbildungsverzeichnis
7.2 Quellenverzeichnis
7.3 Selbständigkeitserklärung
Seit das Internet mitsamt seiner Möglichkeiten für die Menschen nutzbar ist, hat es sich ausgeweitet, verbessert und erneuert. Neue Seiten entstanden, neue Anwendungen wur-den erschaffen und der computervermittelte Kommunikationsprozess auf mobile Geräte erweitert.
"Für die neuen Entwicklungen hat sich das Schlagwort Web2.0
durchgesetzt. Web 2.0 assoziiert eine neue Dimension von
Kommunikation und Interaktion im Netz, für welche die Ausdrücke
social networking, collaboration und participation geläufig
wurden."
Neue Kommunikationswege eröffnen jedoch auch immer neue Kommunikationssituati-onen. Besonders die Diskussion über die Folgen der Anonymität im Internet ist weit verbreitet und wird häufig mit negativen Themen wie Cybermobbing und Internetkri-minalität in Verbindung gebracht. Fördert Anonymität tatsächlich gesetzeswidriges, negatives Handeln? Und falls ja, wie macht es sich bemerkbar? Gibt es auch positive Auswirkungen?
Diese Arbeit wird sich mit den oben stehenden Fragen beschäftigen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den negativen Folgen, besonders auf Cybermobbing. Nach einer ein-führenden Betrachtung der computervermittelten Kommunikation wird in Kapitel 3 die Anonymität mitsamt ihrer Vor- und Nachteile beleuchtet. Anschließend rückt das The-ma Cybermobbing in den Vordergrund, das nach einer theoretischen Betrachtung in Kapitel 4 schließlich direkt am Youtubefall Nana Davis aufgezeigt wird.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Kommunikation im Internet
2.1 Sprachliche Besonderheiten
2.2 Theoretische Modelle
2.2.1 Kanal-Reduktions-Modell
2.2.2 Social Information Processing Theory
2.2.3 Reduced Social Context Cues Theory
3 Anonymität im Internet
3.1 Positive Auswirkungen
3.2 Negative Auswirkungen
4 Cybermobbing
5 Fallbeispiel: Nana Davis
5.1 Untersuchungsgegenstand
5.2 MrMooMooChocolate und die Anonymität
5.3 Sprachliche Merkmale
6 Schlusswort
7 Anhang
7.1 Abbildungsverzeichnis
7.2 Quellenverzeichnis
- Quote paper
- B.A. Julia Steinborn (Author), 2012, Die Auswirkungen von Anonymität in der Online-Kommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/203488