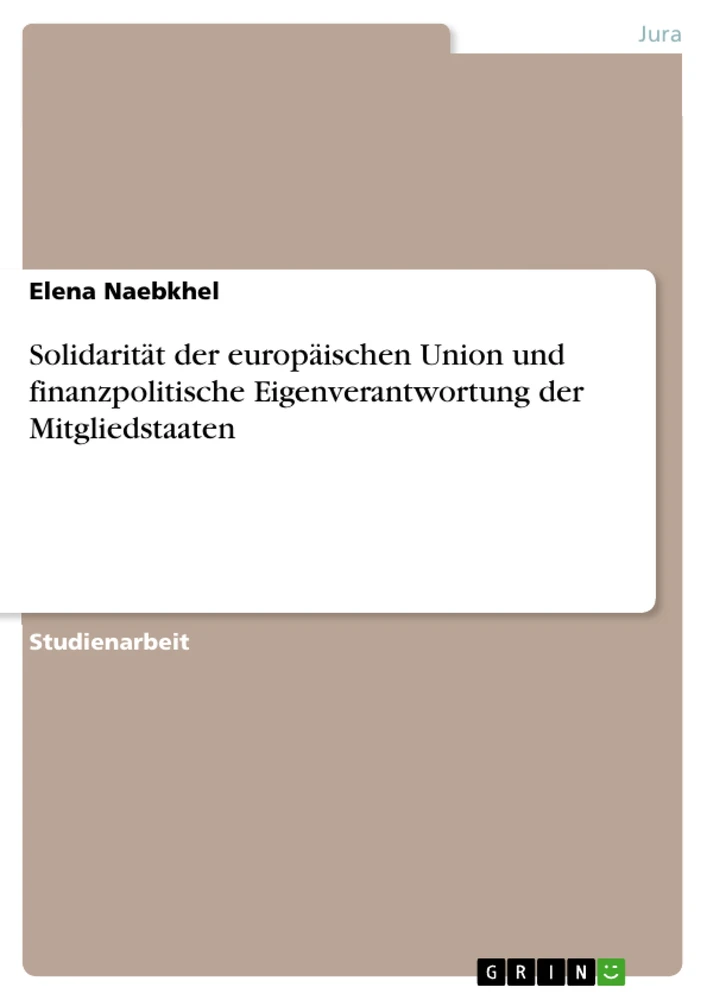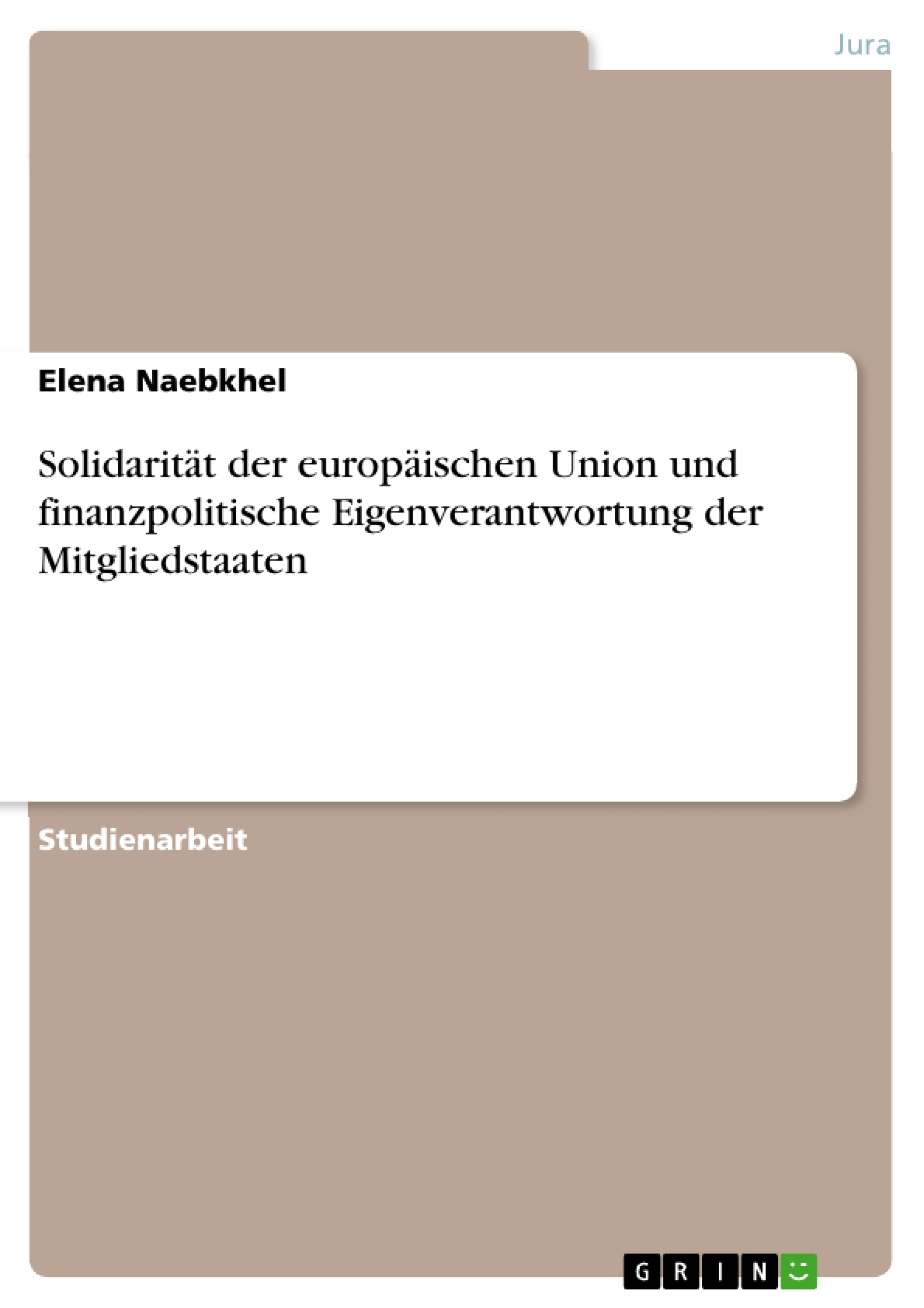Der Vertrag von Lissabon wurde im Dezember 2007 unterzeichnet und trat am 1. Dezember 2009 in Kraft. Er bedeutet nunmehr eine große Veränderung für die Europäische Union in vielerlei Hinsicht. Nun bildet der EUV mit dem AEUV gemeinsam die einheitliche Rechtspersönlichkeit der EU, auf die ihr Handeln gestützt wird und durch die auch die Individuen der Mitgliedstaaten erstmals persönlich Recht besitzen. Es stellt eine verfassungsähnliche Grundordnung der Union dar, aber die EU bleibt ein nichtstaatlicher Staatenverbund. Den Mitgliedstaaten wird mehr Mitspracherecht und dadurch auch mehr Macht zuteil. Das Ziel einer „Mega-Union“ wurde dadurch aber nicht erreicht. Ein Aspekt, der an Bedeutung gewonnen hat ist die generelle Stärkung des europäischen Solidaritätsprinzips im Vertrag von Lissabon und miteinhergehenden Folgen für die Mitgliedstaaten der Union. Dieser Bereich hat besondere Aktualität gewonnen durch die Finanzkrise und die Griechenland-Problematik. Diesen Aspekt werde ich in der folgenden Arbeit weiter erörtern, indem ich zunächst auf die allgemeine Solidarität in der EU eingehe und dann speziell auf das Verhältnis von Solidarität und Eigenverantwortung der EU-Mitgliedstaaten im Finanzbereich der Wirtschafts-und Währungsunion.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einführung
- B. Die Solidarität der Europäischen Union
- I. Der Begriff der Solidarität
- II. Entwicklung der Solidarität
- 1. Vor dem Vertrag von Lissabon
- 2. Nach dem Vertrag von Lissabon
- III. Die Ziele und Werte der Union
- 1. Allgemeine Werte und Ziele
- 2. Die Solidarität in Art. 2 S.2 EUV
- 3. Das Grundprinzip der Solidarität in Art. 3 III 3 EUV
- 4. Die gegenseitige Loyalität in Art. 4 III 1 EUV
- IV. Solidarität in den Unionspolitiken
- 1. Die GASP
- 2. Asyl und Einwanderung
- 3. Energiepolitik
- 4. Sozial- und Gesundheitspolitik
- 5. Transeuropäische Netze
- 6. Industrie- und Agrarpolitik
- 7. Katastrophenschutz
- 8. Die Solidaritätsklausel in Art. 222 AEUV
- 9. Die Vertragssolidarität in Art. 351 II S.2 AEUV
- 10. Die Flexibilitätsklausel in Art. 352 AEUV
- V. Die Solidarität in der EGRC
- VI. Die Justiziabilität des solidarischen EU-Charakters
- C. Die Solidarität und die Eigenverantwortlichkeit der EU-Mitgliedstaaten in der Wirtschafts- und Währungsunion
- I. Der wirtschaftspolitische Solidaritätsbegriff
- II. Die finanzielle EU-Solidarität
- 1. Rechtliche Grundlagen
- a.) Handeln innerhalb der Eurozone
- (1) Art. 126 AEUV
- (2) Art. 121 I AEUV
- (3) Art. 122 AEUV
- b.) Handeln außerhalb der Eurozone
- c.) Finanzieller Beistand gemäß Art. 352 AEUV
- d.) Problematik der Durchsetzung
- 2. Die Finanzkrise
- a.) Die Griechenland-Problematik
- b.) Gefährdung durch andere Staaten
- c.) Folgen der Schuldenkrise
- III. Die finanzpolitische Eigenverantwortung der EU-Mitgliedstaaten
- 1. Art. 120 S.1 AEUV
- 2. Das Subsidiaritätsprinzip in Art. 5 III EUV
- 3. Art. 126 I AEUV
- 4. Die No Bail-out Klausel gem. Art. 125 AEUV
- a.) Der Begriff
- b.) Das Eigenverantwortungsprinzip
- c.) Ökonomische Erwägungen
- d.) Schwierigkeiten der Klausel
- D. Das Spannungsverhältnis zwischen Solidarität und Eigenverantwortung der Mitgliedsstaaten in der EU
- I. Das Spannungsverhältnis
- II. Die Eigenverantwortung in der Union
- III. Die Solidarität in der Union
- E. Zukunftsaussichten für das solidarische Europa
- Die rechtliche Konstruktion des Solidaritätsbegriffs in der EU
- Die Entwicklung der Solidarität vor und nach dem Vertrag von Lissabon
- Die Rolle der Solidarität in verschiedenen Unionspolitiken
- Das Spannungsverhältnis zwischen Solidarität und Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten
- Die Herausforderungen der Finanzkrise für die Solidarität in der EU
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Entwicklung der Solidarität innerhalb der Europäischen Union im Kontext des Vertrags von Lissabon. Sie analysiert die rechtlichen Grundlagen und die praktische Umsetzung des Solidaritätsprinzips im europäischen Kontext, insbesondere im Hinblick auf die Wirtschafts- und Währungsunion.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema der Solidarität in der EU. Anschließend werden die Entwicklung und die rechtlichen Grundlagen des Solidaritätsprinzips in den verschiedenen Unionsverträgen untersucht. Das Kapitel beleuchtet die zentralen Ziele und Werte der Europäischen Union, einschließlich der Solidarität, und analysiert die konkrete Anwendung des Solidaritätsprinzips in verschiedenen Politikbereichen. Des Weiteren wird die Solidarität im Kontext der Wirtschafts- und Währungsunion beleuchtet, mit einem Fokus auf die rechtlichen Grundlagen und die Herausforderungen durch die Finanzkrise.
Schlüsselwörter
Solidarität, Eigenverantwortung, Europäische Union, Vertrag von Lissabon, Wirtschafts- und Währungsunion, Finanzkrise, Eurozone, No Bail-out Klausel, Subsidiaritätsprinzip.
- Quote paper
- Elena Naebkhel (Author), 2012, Solidarität der europäischen Union und finanzpolitische Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/203065